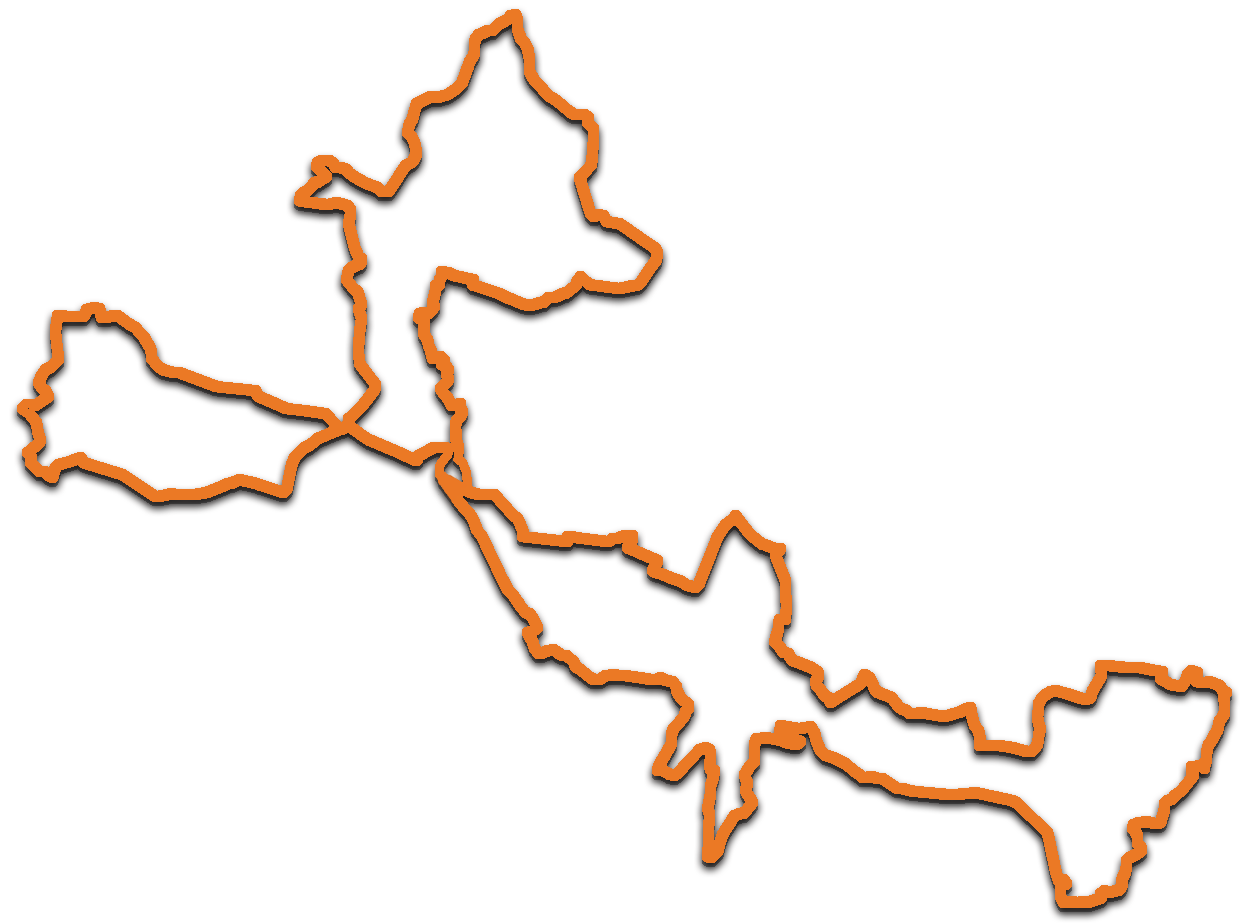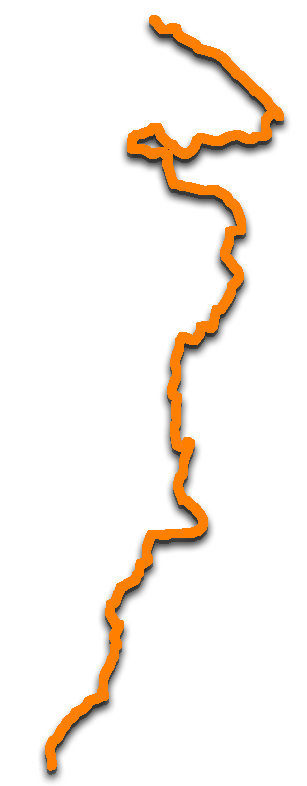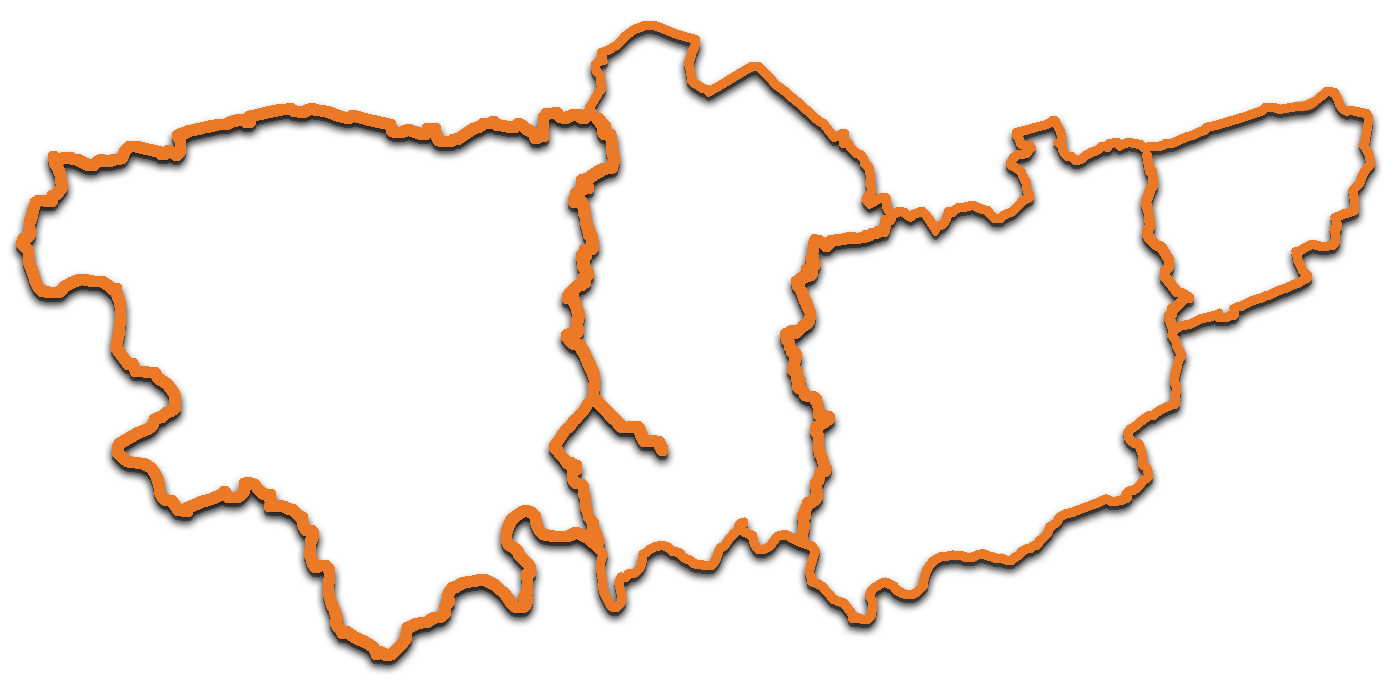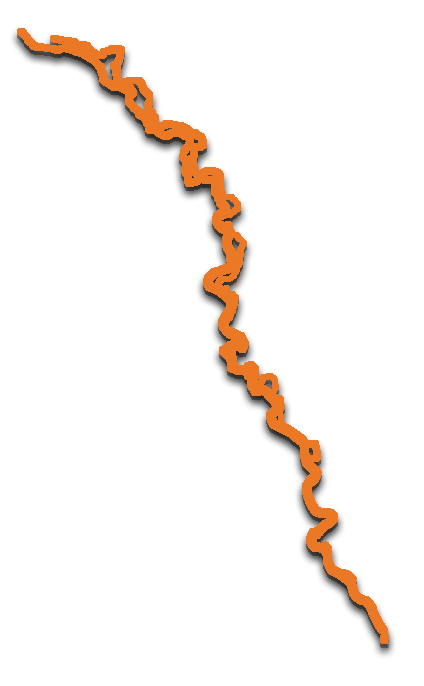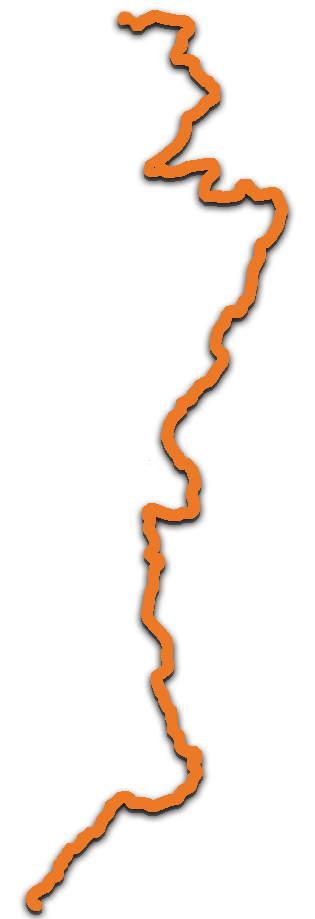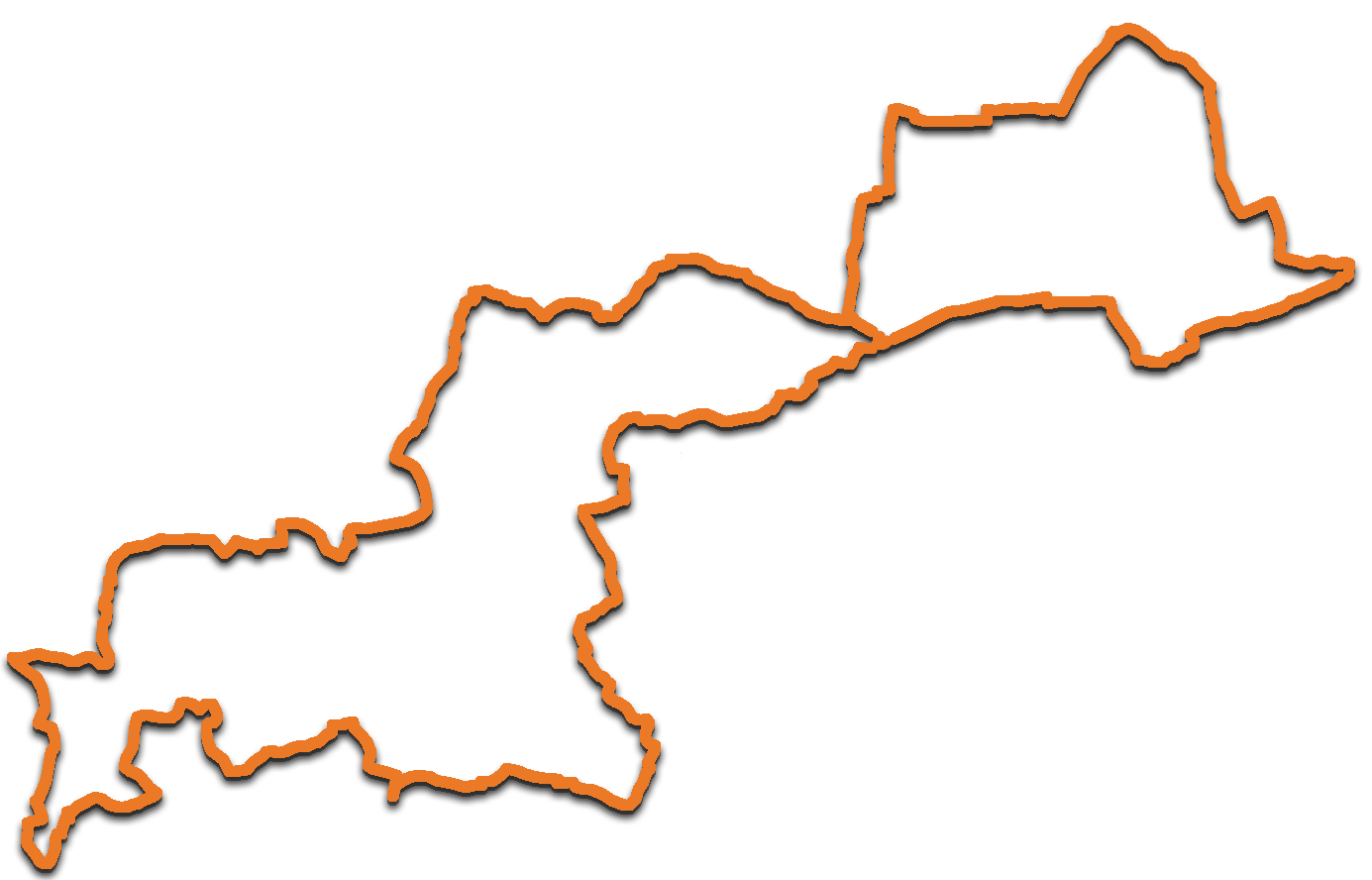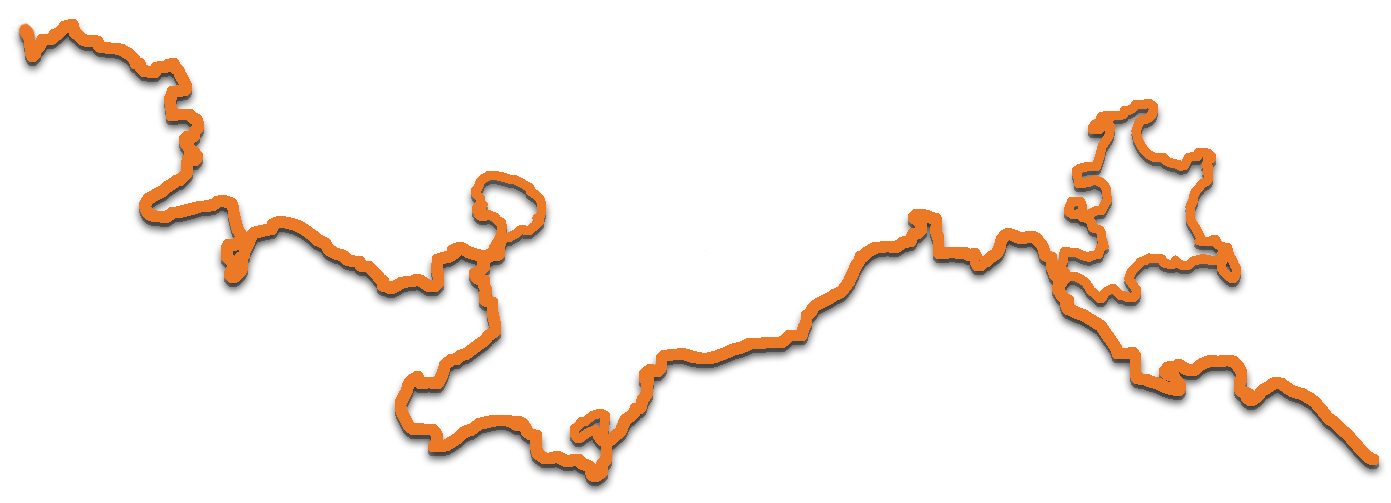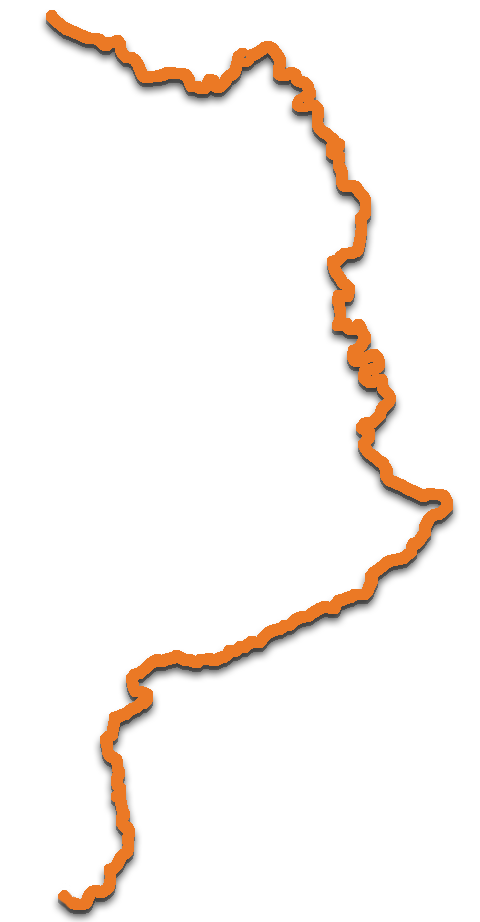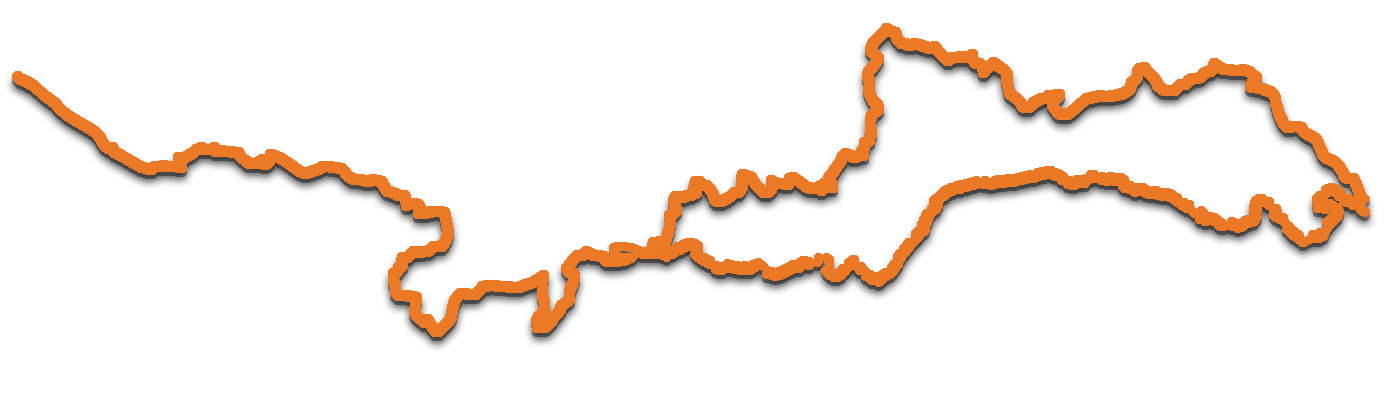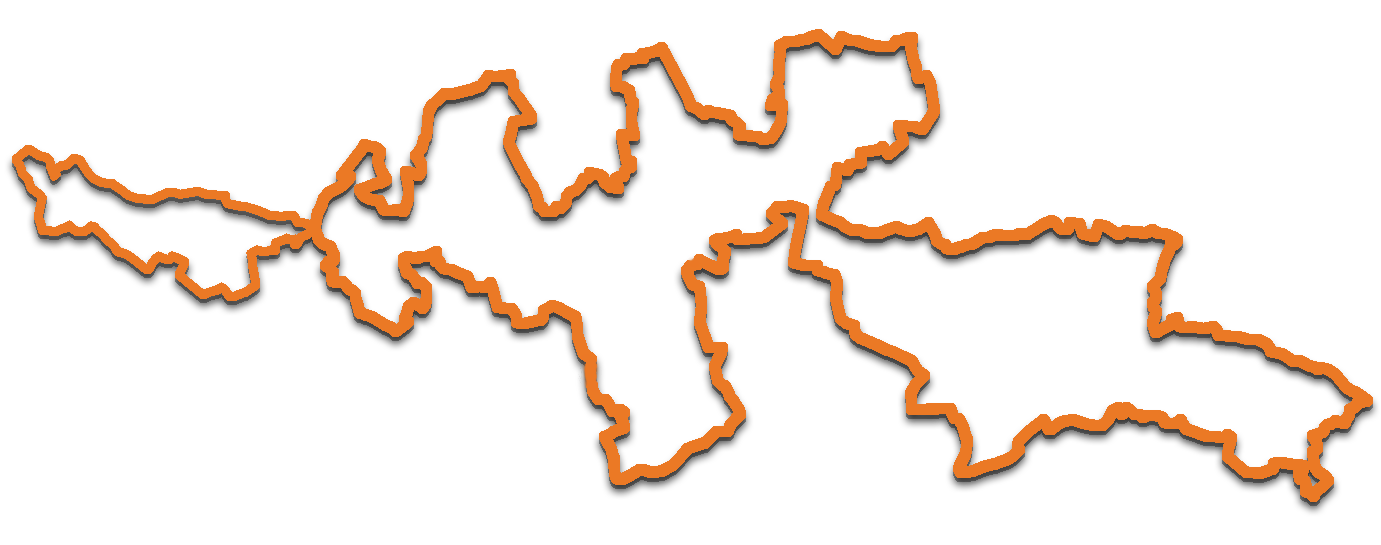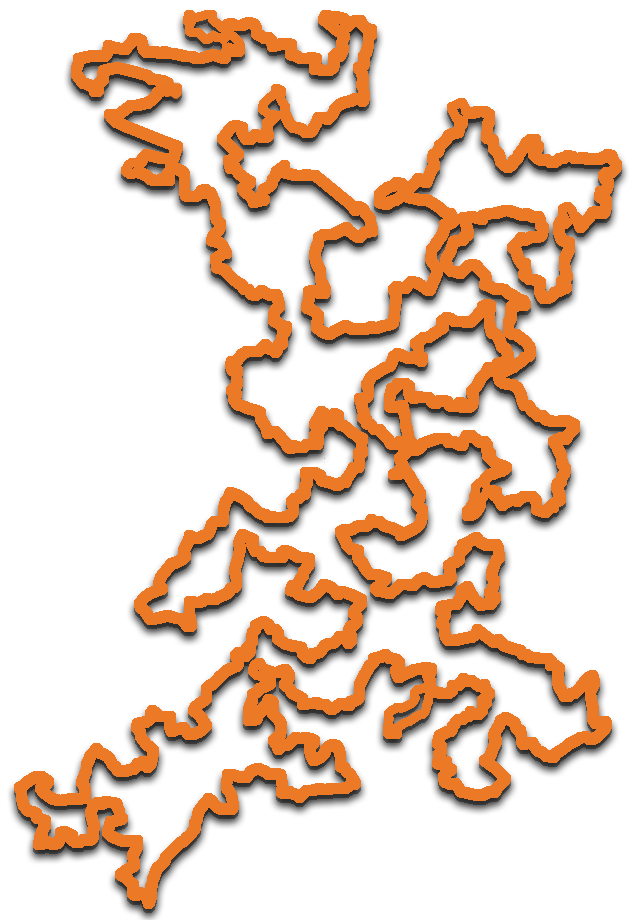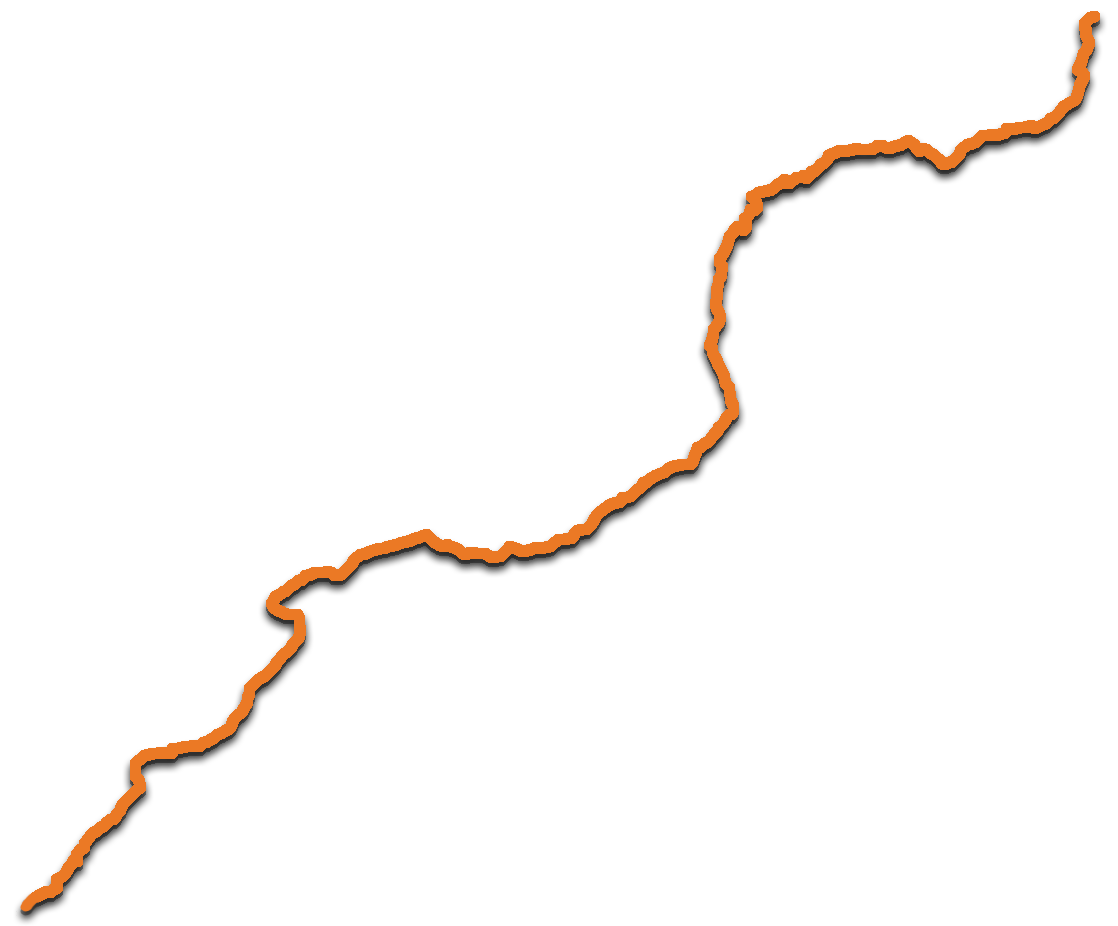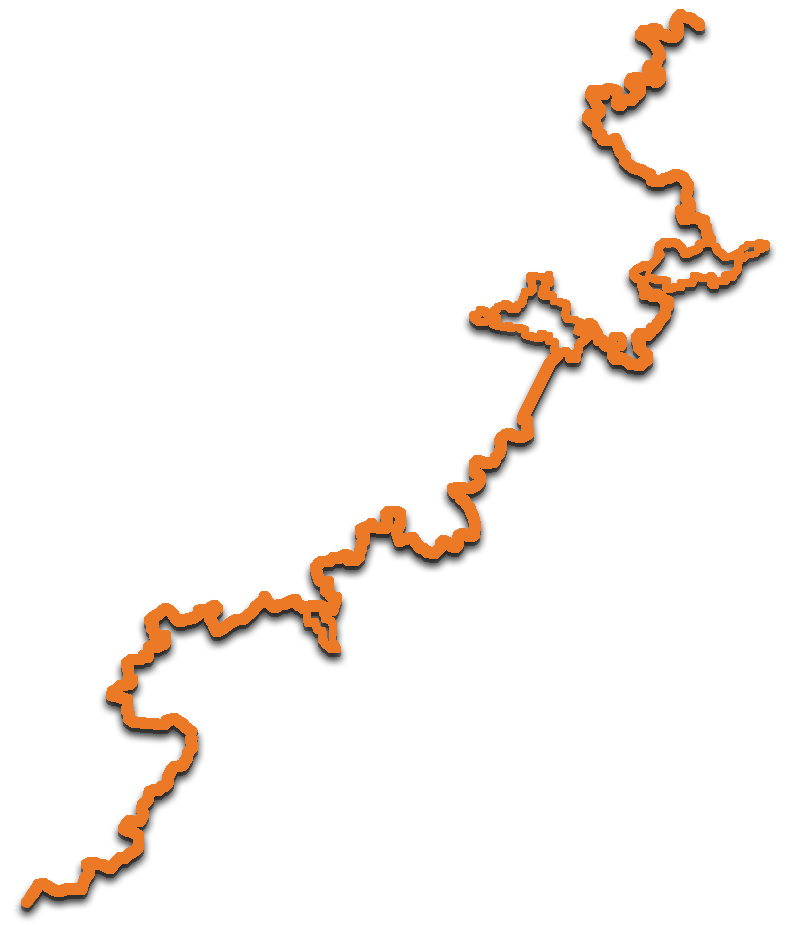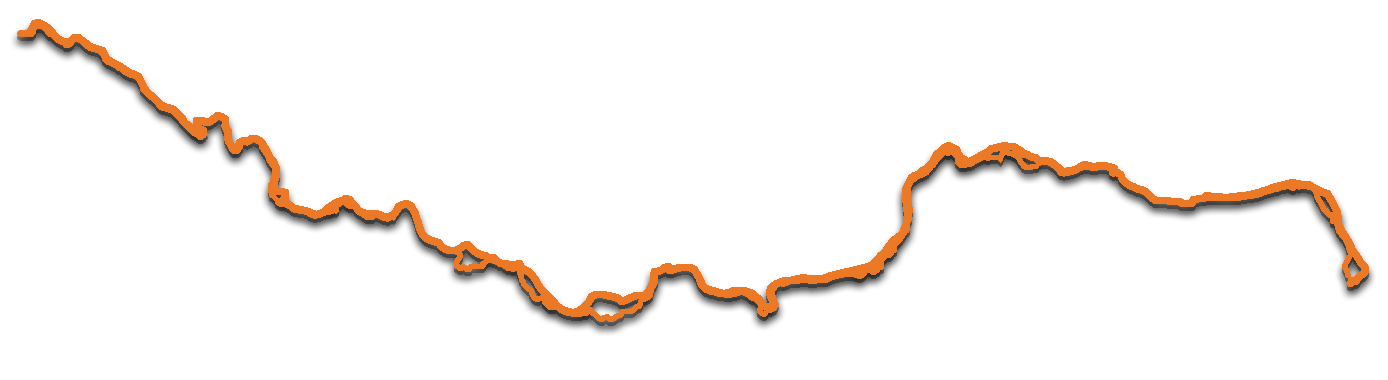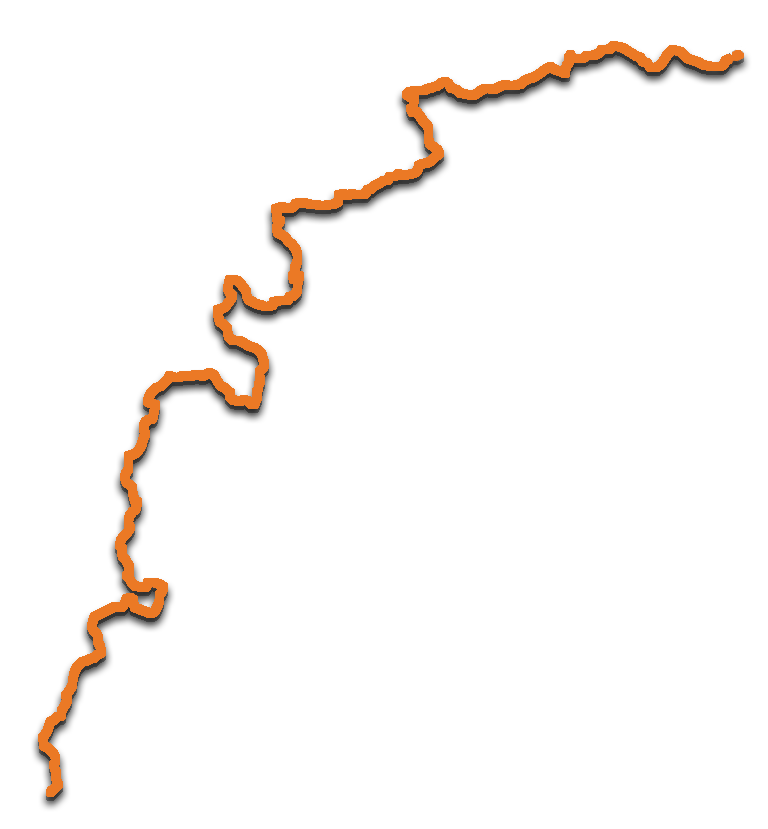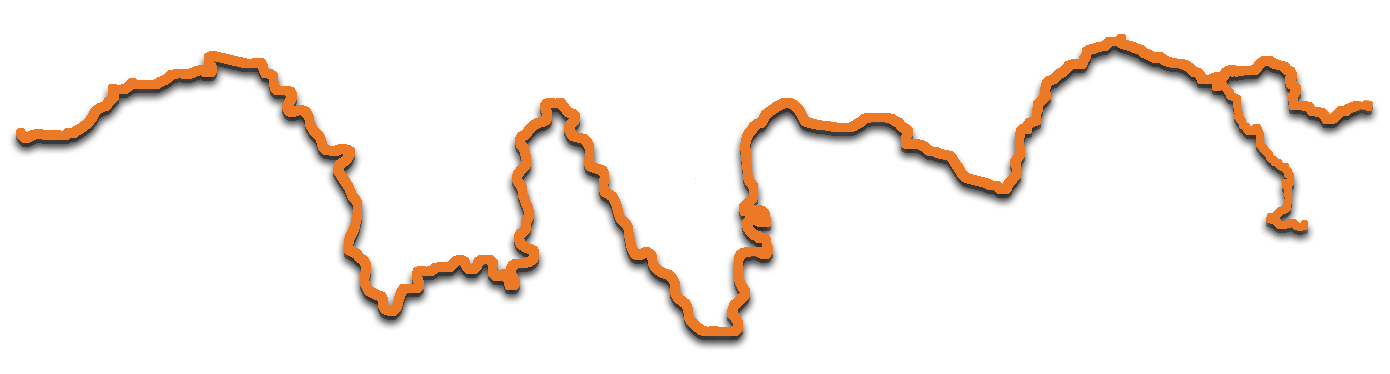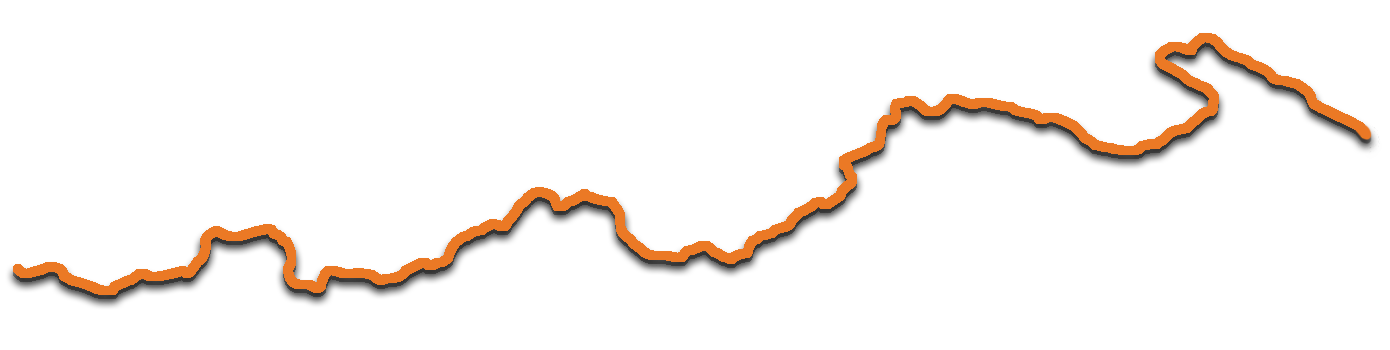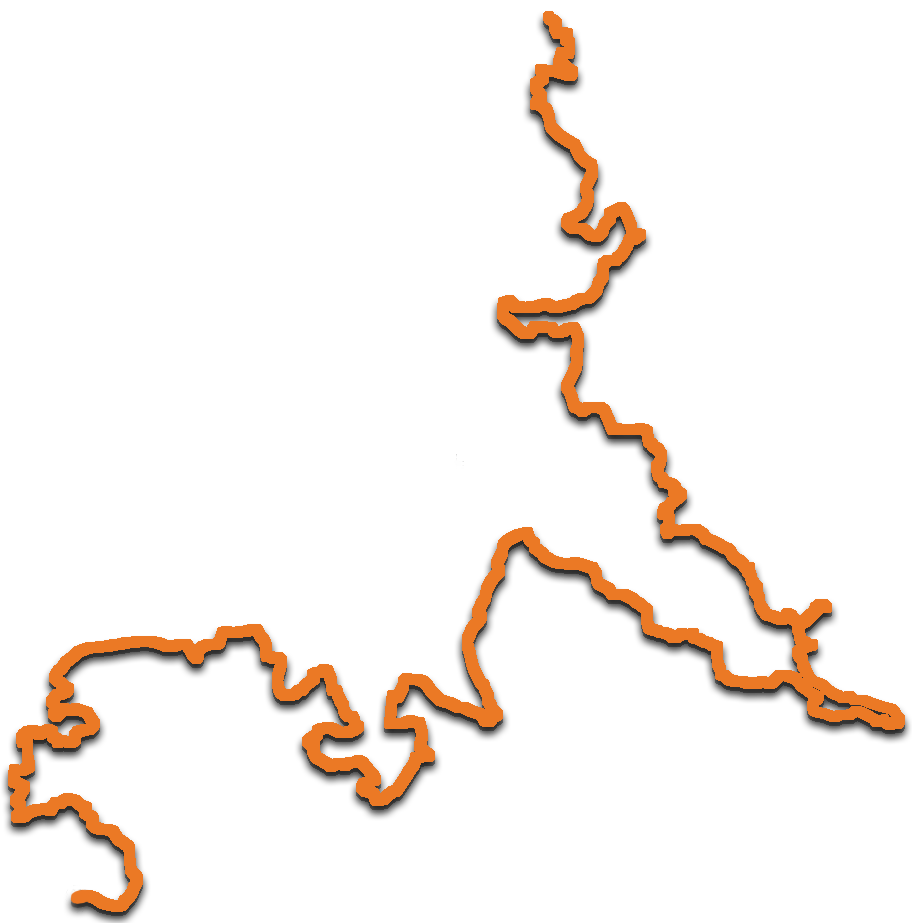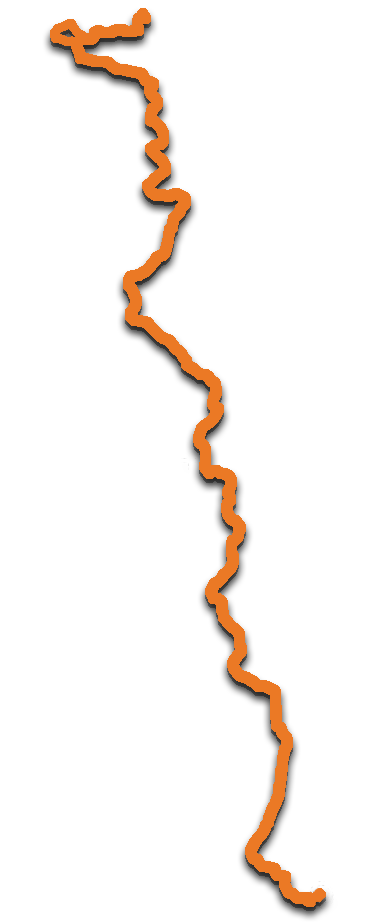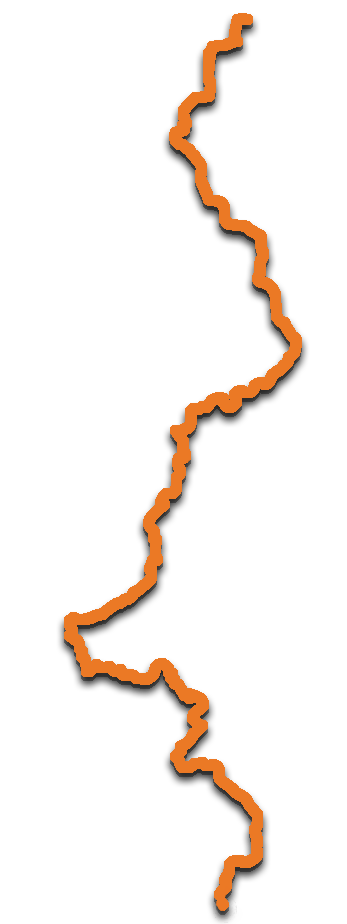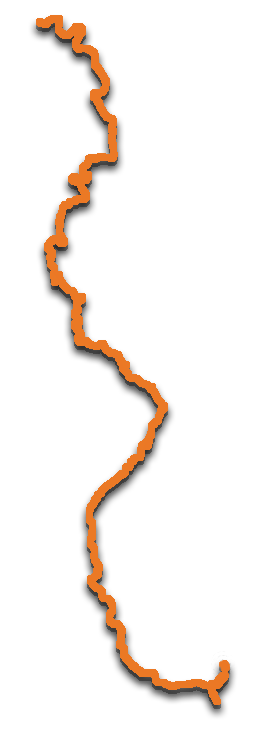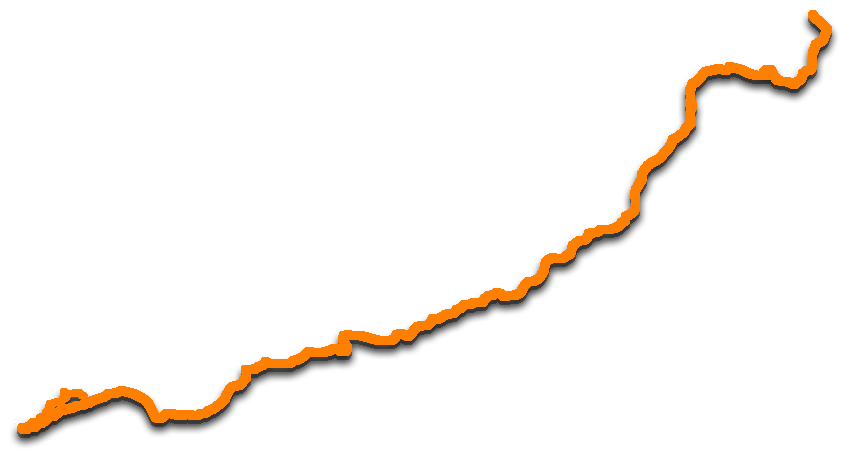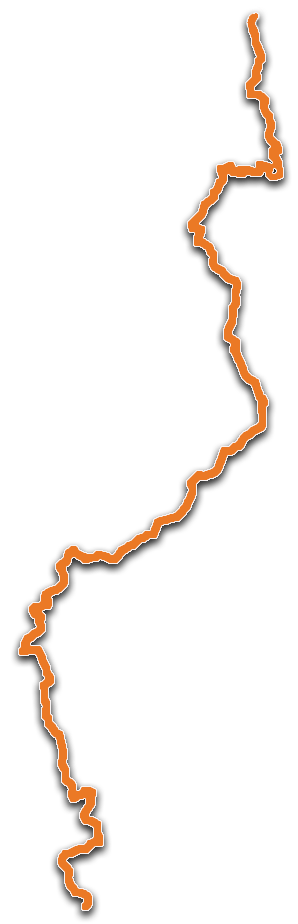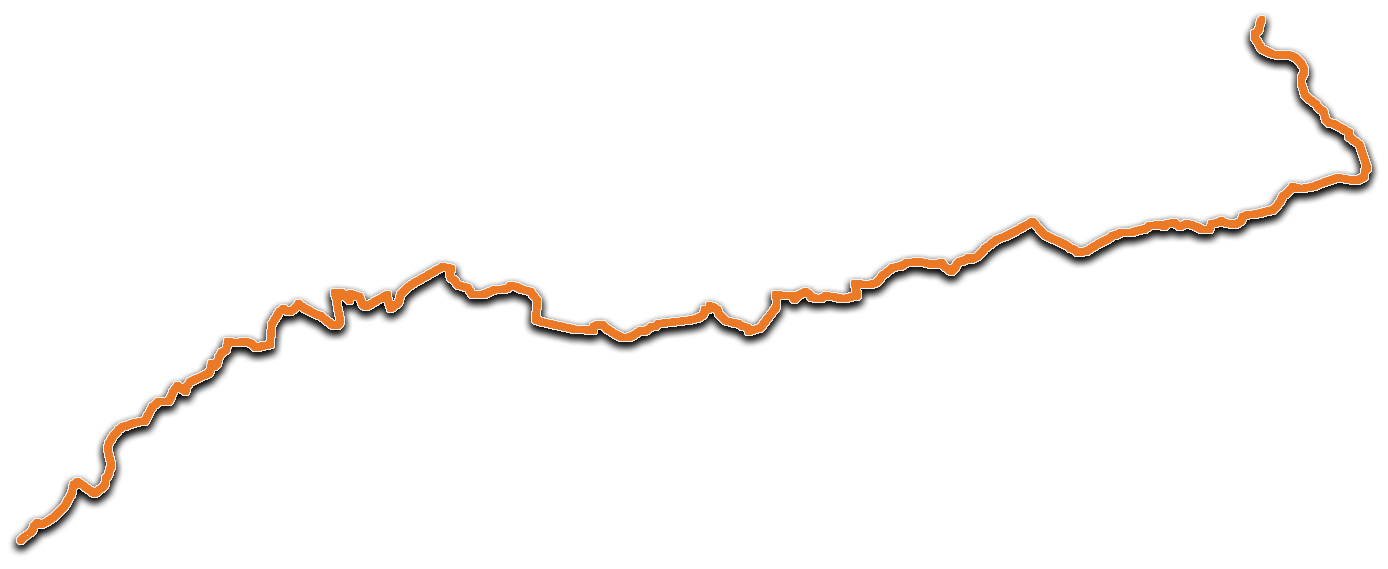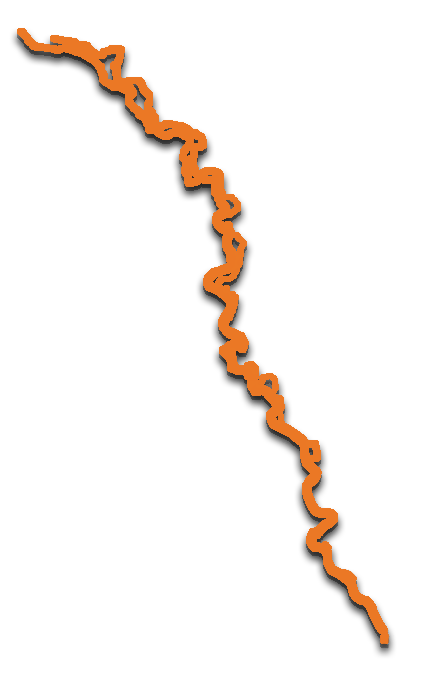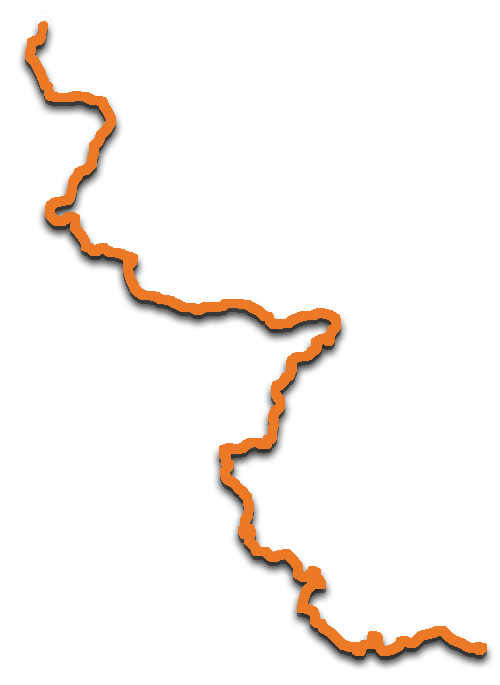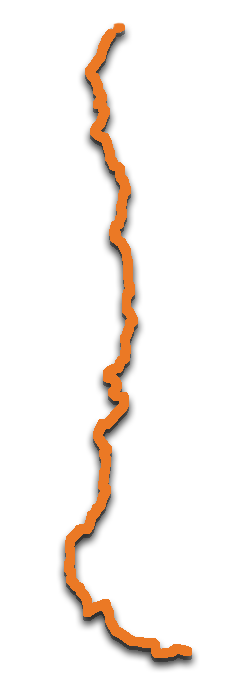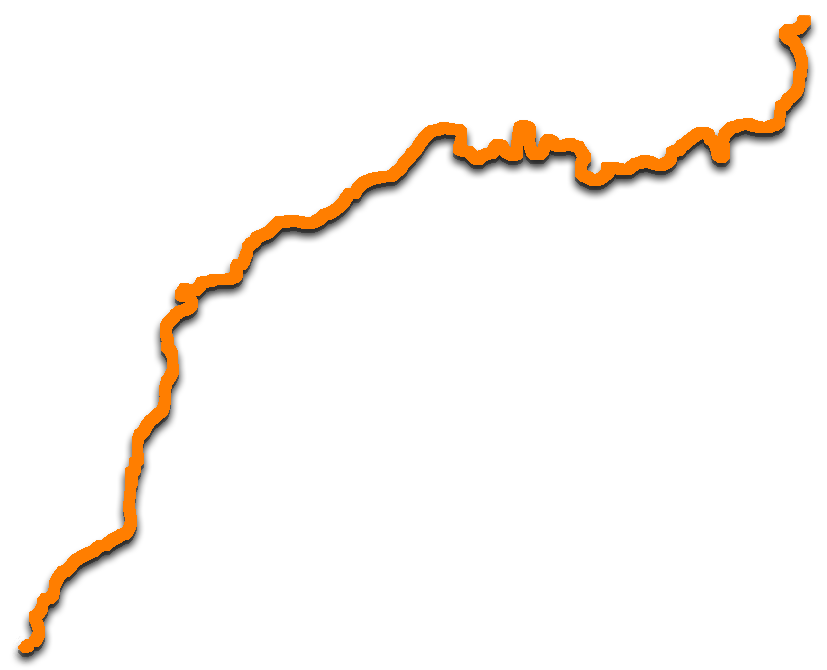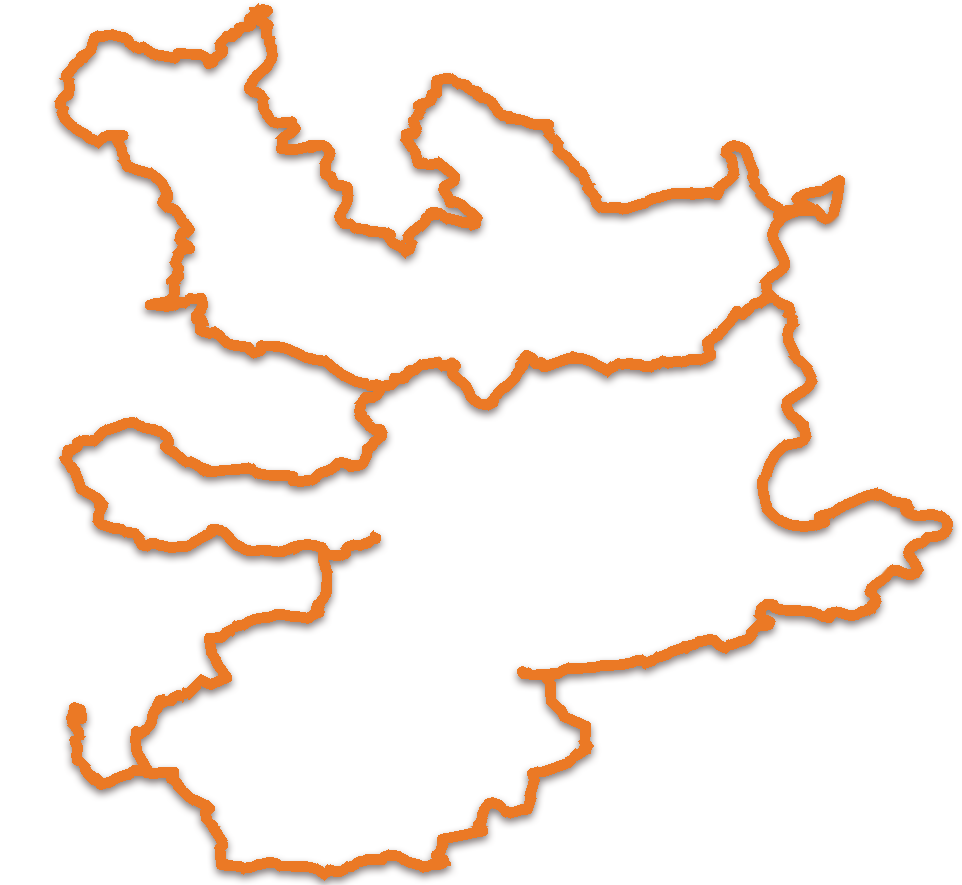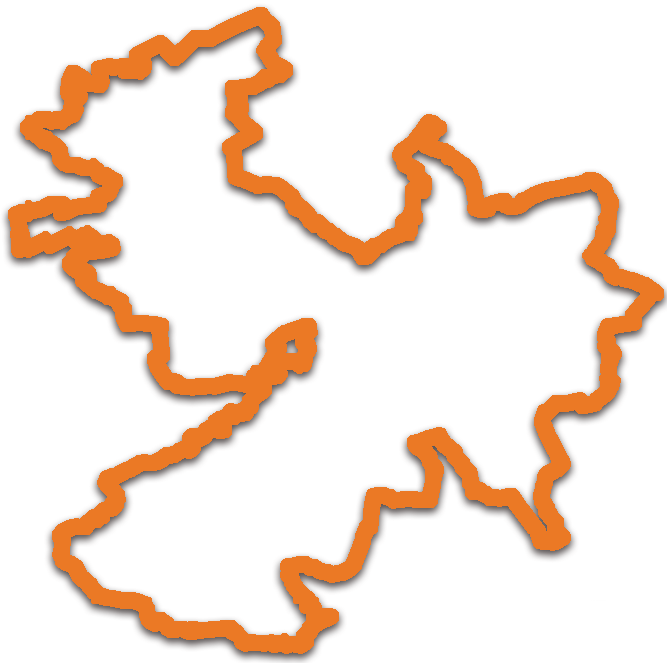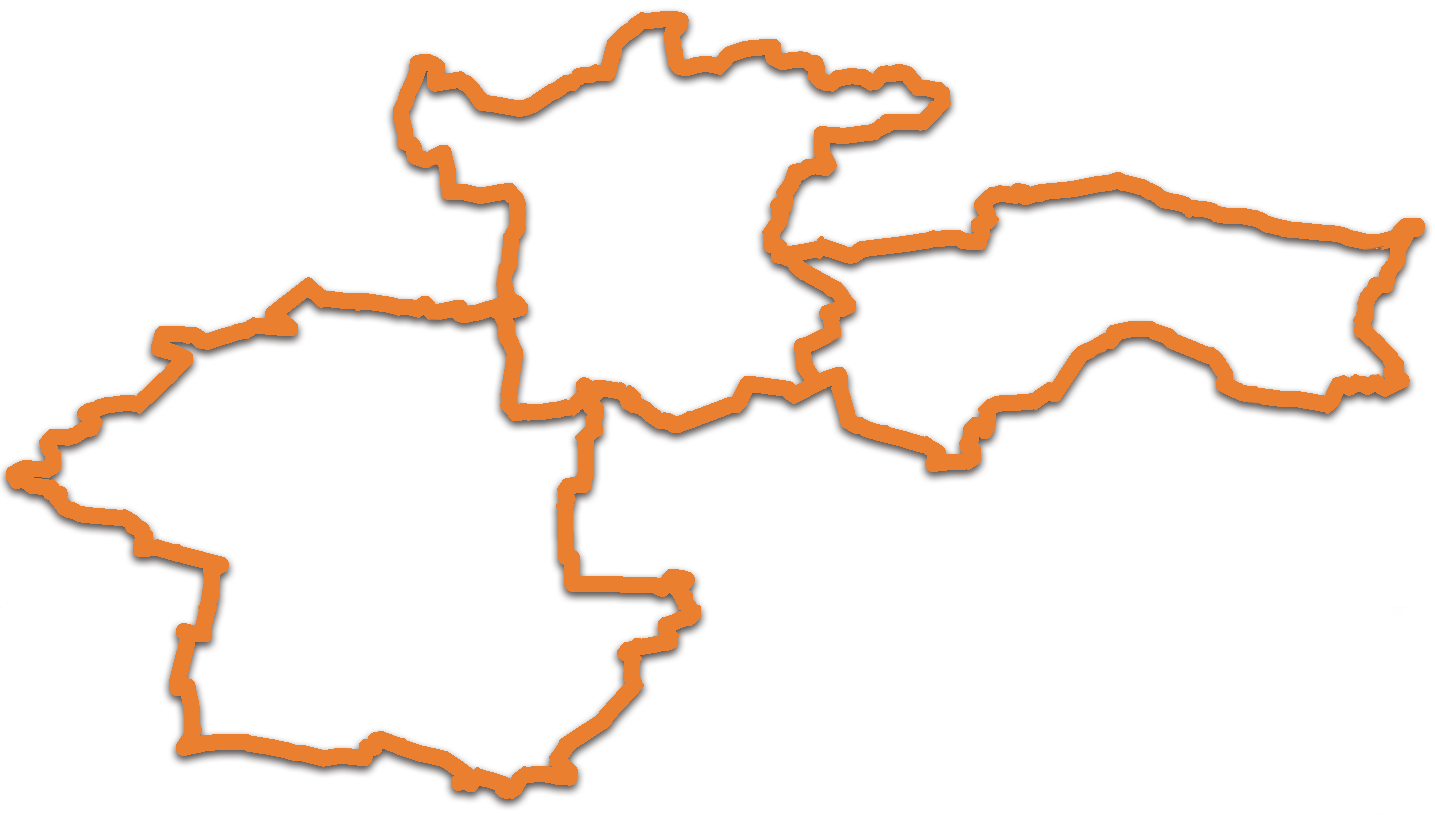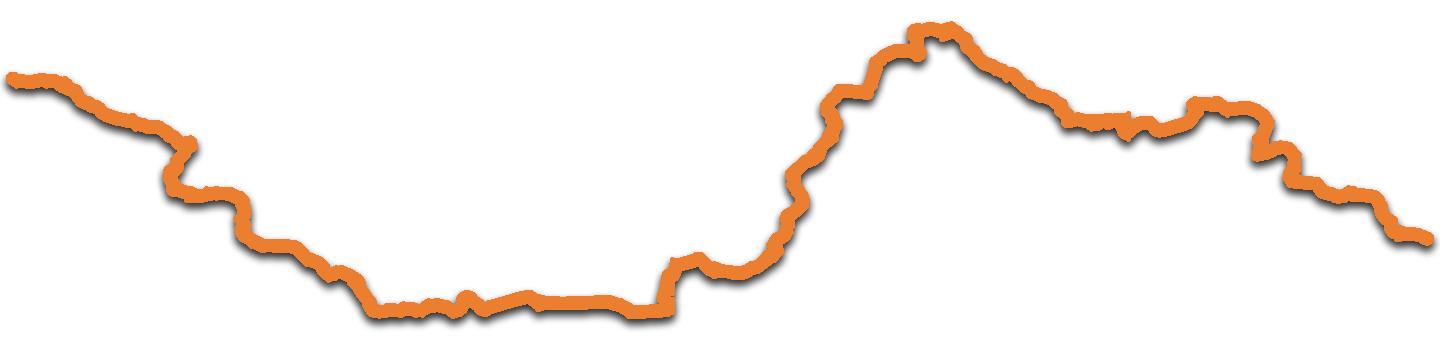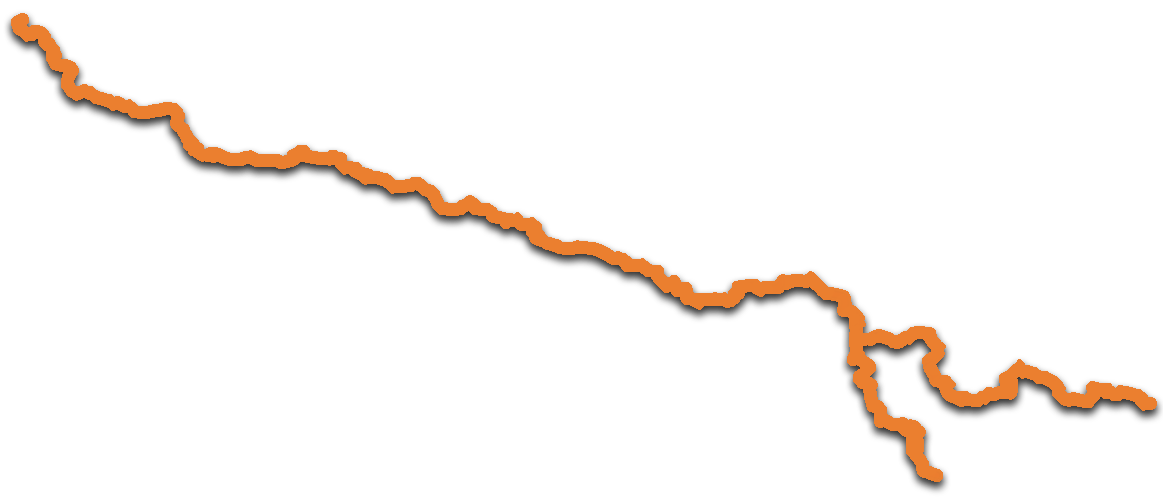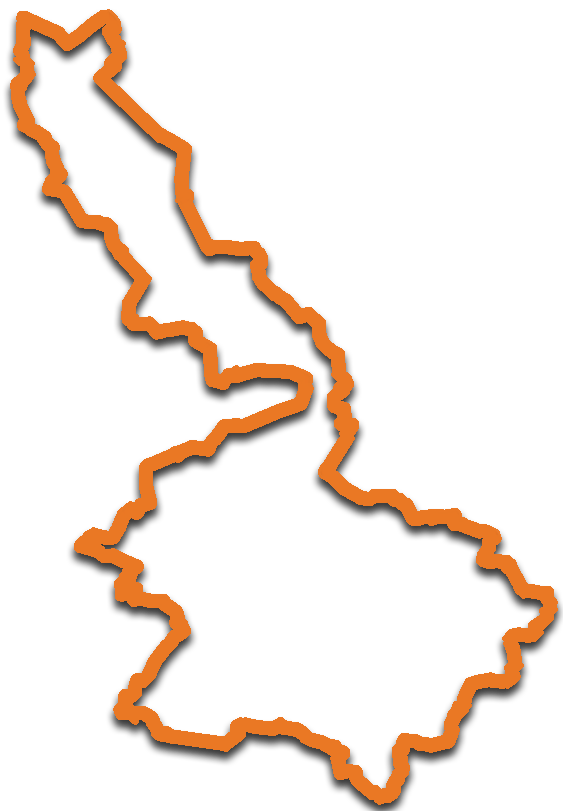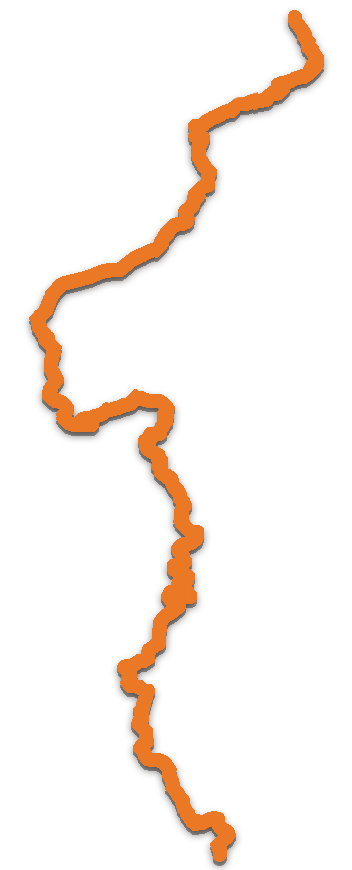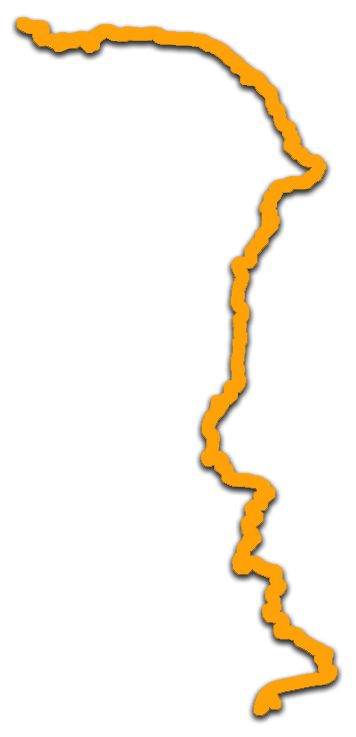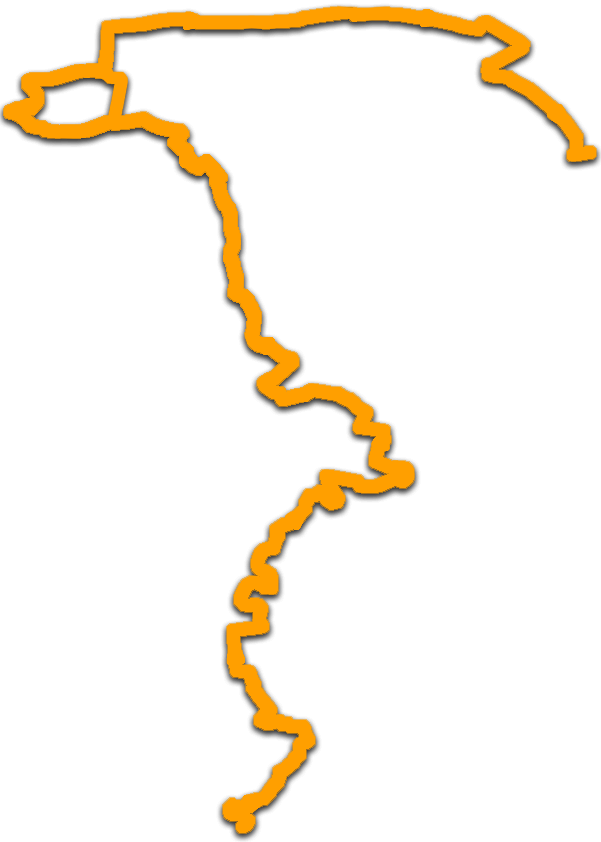Römer-Lippe Route
inst hatten die Römer an der Lippe eine Reihe von befestigten Lagern errichtet, um die Vorherrschaft in Germanien zu sichern. Lange Zeit hatte man vermutet, dass die römischen Truppen an der Lippe zum Teutoburger Wald marschierten, um dort in der Varusschlacht von den Germanen vernichtend geschlagen zu werden. So errichtete man im 19. Jahrhundert das Hermannsdenkmal, um dem germanischen Anführer und Helden Arminius ein monumentales Denkmal zu setzen und gleichzeitig das damals kaum vorhandene deutsche Nationalbewusstsein zu stärken. Nach neueren Erkenntnissen hat nun die Varusschlacht ganz woanders – nämlich im Osnabrücker Land – stattgefunden. Dennoch hatte es an der Lippe eine nachhaltige römische Vergangenheit gegeben. So entstand 1993 mit der Römerroute ein Radfernweg, der die Fundstellen früherer Römerlager und mehrere Museen miteinander verband und damit die römische Vergangenheit Germaniens in den Mittelpunkt stellte. Doch die Tour war auch eine Flussroute entlang der Lippe, die der nördlichste rechte Nebenfluss des Rheins und mit einer Länge von 220 Kilometern immerhin der längste Fluss in Nordrhein-Westfalen ist. So wurde der Radfernweg durch die Kooperationsgemeinschaft Römer-Lippe-Route, einem gemeinsamen Projekt von Ruhr.Tourismus und Lippe Verband, überarbeitet und 2013 als ‚Römer-Lippe-Route‘ mit dem Slogan ‚Geschichte im Fluss‘ neu eröffnet. Fortan widmet sich der nun 298 Kilometer lange Radfernweg als Doppel-Themenroute sowohl dem Flussverlauf der Lippe von der Quelle in Bad Lippspringe bis zur Mündung bei Wesel, als auch den römischen Spuren vom Hermannsdenkmal bei Detmold bis zum Archäologischen Park in der über 2000 Jahre alten Römerstadt Xanten.
Detmold und Xanten sind Start- bzw. Zielort der Geschichts- und Naturroute, die unterwegs auch durch die Innenstädte von Paderborn, Lippstadt, Hamm und Lünen führt. Während die Landschaft am Teutoburger Wald noch sehr bergig und ländlich geprägt ist, trennt die Lippe ab Hamm die Industriekultur des Ruhrgebiets im Süden von der münsterländischen Parklandschaft im Norden. Ab Haltern geht es entlang von imponierenden Industriekulissen bis zum Niederrhein. Dort, wo die Lippe im 19. Jahrhundert noch schiffbar war, entsteht gerade mit den renaturierten Lippeauen eines der längsten zusammenhängenden Naturschutzgebiete Deutschlands. Als Logo für den Fernradweg dient ein leicht gekipptes Emblem, das einen weißen Römerhelm auf rotem Grund über einer dunkelblau abgesetzten Wellenlinie, die die Lippe symbolisieren soll, zeigt. Elf thematische Wegeschleifen mit einer Gesamtlänge von 154 Kilometern können alternativ zur Hauptroute genutzt werden. Sie sind mit dem gleichen Symbol ausgeflaggt, besitzen jedoch eine etwas andere Farbgebung, abhängig davon, ob es sich um eine wasserbezogene (blau-weiß) oder eine geschichtliche Themenroute (rot-weiß) handelt. Bereits kurze Zeit nach der Überarbeitung hatte sich die Römer-Lippe-Route zu einer der beliebtesten Radrouten Nordrhein-Westfalens entwickelt.
Charakteristik:
Die Römer-Lippe-Route verbindet die Regionen Teutoburger Wald, die Hellweg-Region, das Münsterland, die Metropole Ruhr und den Niederrhein miteinander. Empfohlen wird der Start in Detmold, um flussabwärts der Lippe bis zur Mündung zu folgen. Die Route ist aber auch in entgegengesetzter Richtung ausgeschildert. Bergig ist es nur am Teutoburger Wald, wo mit einigen Steigungen gerechnet werden muss. Insbesondere der langgestreckte Anstieg zum Hermannsdenkmal, zu dem man ja erst einmal hochklettern muss, um die Route zu beginnen, ist sehr steil und anspruchsvoll. Der Rest der Route ist weitgehend flach und familientauglich und die Streckenführung verläuft fast ausnahmslos auf separaten Radwegen oder auf wenig befahrenen Seitenstraßen. Nur innerhalb der Städte muss mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Die Wege sind überwiegend asphaltiert oder mit wasserabweisendem Schotter belegt. Neben der Hauptroute können alternativ elf verschiedene Themenschleifen gewählt werden, die so eine individuelle Streckenwahl oder einen Rundkurs als Tagesausflug ermöglichen. Der Radfernweg verfügt über zahlreiche Rastplätze und Schutzhütten sowie über eine große Anzahl von Informationstafeln am Wegesrand.
Ortschaften entlang der Route
Detmold / Horn-Bad Meinberg / Schlangen / Bad Lippspringe / Paderborn / Delbrück / Lippstadt / Wadersloh / Lippetal / Welver / Ahlen / Hamm / Werne / Bergkamen / Lünen / Waltrop / Selm / Olfen / Datteln / Haltern am See / Marl / Dorsten / Schermbeck / Hünxe / Wesel / Xanten
Detmold
ie Hochschulstadt und größte Stadt im Kreis Lippe war einst 450 Jahre lang von 1468 an Residenz der Grafen bzw. ab 1789 der Fürsten zu Lippe und nach dem Ersten Weltkrieg immerhin noch Hauptstadt des Freistaates Lippe. 1947 wurde der Freistaat jedoch in das Bundesland Nordrhein-Westfalen eingegliedert. Schillerndste Persönlichkeit Detmolds war Graf Friedrich Adolf, der das Residenzschloss barock umgestalten ließ, das Neue Palais, den inzwischen nicht mehr existierenden Landsitz Friedrichstal und den Friedrichtaler Kanal als Lustwasserstraße errichten ließ.
Detmold war 783 zum ersten Mal als ‚Theotmalli‘ schriftlich erwähnt worden. In diesem Jahr wurde hier das Heer Karls des Großen von den Sachsen geschlagen. Überregional bedeutend und bekannt ist das Hermannsdenkmal am Teutoburger Wald, das im 19. Jahrhundert als Nationaldenkmal zu Ehren des Germanenführers Arminius erschaffen wurde und an die Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr, erinnern soll, obwohl der Schauplatz dieses Gemetzels nach neueren Erkenntnissen relativ weit entfernt liegt. Das 53 m hohe Monument ist das höchste Denkmal Deutschlands.
Detmold wurde glücklicherweise im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen verschont, so dass die sehenswerte Altstadt mit ihren über 600 denkmalgeschützten Häusern, die zum Teil noch aus dem späten Mittelalter stammen, erhalten blieb. Mittelpunkt des historischen Zentrums ist der Marktplatz mit dem Donopbrunnen. Hier steht das klassizistische Rathaus und mit der Erlöserkirche das älteste Gotteshaus der ehemaligen Residenzstadt.
Sehenswertes:
 Das riesige Monumentaldenkmal am Teutoburger Wald südwestlich von Detmold wurde zwischen 1838 und 1875 durch Ernst von Bandel erbaut. Für Bandel war es sein Lebenswerk, dem er sich fast ausschließlich gewidmet hatte. Das Denkmal besitzt eine Gesamthöhe von 53,5m. Allein die Figur des Hermanns misst stattliche 26,6 m und sein mächtiges Schwert ist 7 m lang. Damit ist das gewaltige Monument die höchste Statue Deutschlands. Zur Zeit ihrer Einweihung war sie sogar die höchste der Welt! Der Sockel besteht aus Sandstein und kann bestiegen werden. Von hier aus, 386m über Detmold, hat man eine wundervolle weite Aussicht über den Teuto und das Eggegebirge. Der Hermann (Mann des Heeres) stellt den Cheruskerführer Arminius dar, der die germanischen Stämme einigte und die römischen Legionen unter Publius Quinctilius Varus in der Varusschlacht im Jahre 9 n.Chr. vollständig vernichtete. Die kolossartige Statue entstand in einer Zeit, in der den nationalen Symboliken aufgrund einer wachsenden deutschen Identität immer größere Bedeutung zukam. Schließlich hatte das Land noch kurz zuvor aus einer unübersichtlichen Vielzahl von Kleinstaaten bestanden. Die Figur, die stolz und entschlossen das Schwert empor streckt, steht für die erste Einigung der deutschen (eigentlich germanischen) Stämme und damit auch als Symbol für eine geeinte und große Zukunft, so wie man sie sich seinerzeit erhoffte. Der Hermann richtet sich aber vor allem gegen den damaligen Erbfeind Frankreich, gegen den er geographisch ausgerichtet ist.
Das riesige Monumentaldenkmal am Teutoburger Wald südwestlich von Detmold wurde zwischen 1838 und 1875 durch Ernst von Bandel erbaut. Für Bandel war es sein Lebenswerk, dem er sich fast ausschließlich gewidmet hatte. Das Denkmal besitzt eine Gesamthöhe von 53,5m. Allein die Figur des Hermanns misst stattliche 26,6 m und sein mächtiges Schwert ist 7 m lang. Damit ist das gewaltige Monument die höchste Statue Deutschlands. Zur Zeit ihrer Einweihung war sie sogar die höchste der Welt! Der Sockel besteht aus Sandstein und kann bestiegen werden. Von hier aus, 386m über Detmold, hat man eine wundervolle weite Aussicht über den Teuto und das Eggegebirge. Der Hermann (Mann des Heeres) stellt den Cheruskerführer Arminius dar, der die germanischen Stämme einigte und die römischen Legionen unter Publius Quinctilius Varus in der Varusschlacht im Jahre 9 n.Chr. vollständig vernichtete. Die kolossartige Statue entstand in einer Zeit, in der den nationalen Symboliken aufgrund einer wachsenden deutschen Identität immer größere Bedeutung zukam. Schließlich hatte das Land noch kurz zuvor aus einer unübersichtlichen Vielzahl von Kleinstaaten bestanden. Die Figur, die stolz und entschlossen das Schwert empor streckt, steht für die erste Einigung der deutschen (eigentlich germanischen) Stämme und damit auch als Symbol für eine geeinte und große Zukunft, so wie man sie sich seinerzeit erhoffte. Der Hermann richtet sich aber vor allem gegen den damaligen Erbfeind Frankreich, gegen den er geographisch ausgerichtet ist.
 An der Stelle des heutigen Residenzschlosses im Zentrum der Stadt Detmold stand vermutlich bereits im 8. Jahrhundert ein Wirtschaftshof des Paderborner Bischoffs, der im frühen 13. Jahrhundert zur Wasserburg ausgebaut wurde. Im Jahr 1447 wurde die Anlage während der Soester Fehde vollständig zerstört, gleich darauf aber zu einer mächtigen Festung wiederaufgebaut.
An der Stelle des heutigen Residenzschlosses im Zentrum der Stadt Detmold stand vermutlich bereits im 8. Jahrhundert ein Wirtschaftshof des Paderborner Bischoffs, der im frühen 13. Jahrhundert zur Wasserburg ausgebaut wurde. Im Jahr 1447 wurde die Anlage während der Soester Fehde vollständig zerstört, gleich darauf aber zu einer mächtigen Festung wiederaufgebaut.
Der Renaissancebaumeister Jörg Unkair, der bereits das Schloss Neuhaus bei Paderborn errichtete, wurde im 16. Jahrhundert mit dem Bau eines neuen Residenzschlosses beauftragt. Ab 1549 entstand das prächtige Schloss, das 1673 schließlich in der heutigen Größe vollendet wurde. 1715 wurde die Inneneinrichtung im modernen Stil dieser Zeit barockisiert.
Die Vierflügelanlage gilt als typisches Beispiel für die Weserrenaissance. Die Hauptfassade ist asymmetrisch gegliedert und besitzt auf der linken Seite einen auffälligen Rundturm. In den Winkeln des Innenhofes wurden vier Treppentürme erbaut. Das Residenzschloss wird auch heute noch von der Fürstenfamilie zur Lippe bewohnt, kann aber dennoch im Rahmen einer Führung zum großen Teil besichtigt werden. Sehenswert sind der Rote Salon genannte Empfangsraum mit seinen Stuckornamenten und den Deckenmalereien, der Ahnensaal mit Gemälden der einst regierenden Grafen und Fürsten zur Lippe und ihren Gemahlinnen, der Elisabethsaal, die beiden Empire-Zimmer mit originalem Mobiliar aus dem frühen 19. Jahrhundert, das Jagdzimmer mit der Waffensammlung sowie die Königszimmer mit den großen Schlachtgemälden.
Der Schlossplatz vor dem Hauptgebäude entstand im 18. Jahrhundert als französischer Garten, der im frühen 19. Jahrhundert zum englischen Park umgestaltet wurde. Besonders beeindruckend ist der große, achteckige Springbrunnen mit seiner am Abend beleuchteten Fontäne.
 Nach dem Residenzschloss ist das Neue Palais das bedeutendste profane Bauwerk Detmolds. Es wurde zwischen 1706 und 1708 durch Graf Friedrich Adolph erbaut. Als Geschenk für seine Gemahlin gehörte ‚die Favorite‘ als Außengebäude zunächst zum Schlosskomplex. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstand ein zum Palais gehörender französischer Garten, der später dem Zeitgeschmack entsprechend zum englischen Landschaftsgarten umgestaltet wurde. Mit seinen Wasserspielen und den seltenen exotischen Bäumen wurde er bereits 1920 unter Naturschutz gestellt. Mitte des 19. Jahrhunderts war das inzwischen ‚Friedamadolfsburg‘ genannte Palais baufällig geworden, so dass es unter Leopold III. renoviert, umgestaltet und dreistöckig ausgebaut wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Hochschule für Musik in das stolze Bauwerk ein.
Nach dem Residenzschloss ist das Neue Palais das bedeutendste profane Bauwerk Detmolds. Es wurde zwischen 1706 und 1708 durch Graf Friedrich Adolph erbaut. Als Geschenk für seine Gemahlin gehörte ‚die Favorite‘ als Außengebäude zunächst zum Schlosskomplex. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstand ein zum Palais gehörender französischer Garten, der später dem Zeitgeschmack entsprechend zum englischen Landschaftsgarten umgestaltet wurde. Mit seinen Wasserspielen und den seltenen exotischen Bäumen wurde er bereits 1920 unter Naturschutz gestellt. Mitte des 19. Jahrhunderts war das inzwischen ‚Friedamadolfsburg‘ genannte Palais baufällig geworden, so dass es unter Leopold III. renoviert, umgestaltet und dreistöckig ausgebaut wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Hochschule für Musik in das stolze Bauwerk ein.
 Das Landestheater Detmold geht auf die Gründung des Hochfürstlich Lippischen Hoftheaters durch Fürst Leopold II. zurück. Heute besitzt das Landestheater in Detmold fünf Spielstätten, darunter das historische Lippische Landestheater gegenüber dem Schloss mit 680 Plätzen und das klassizistische Hoftheater, das immerhin noch 250 Zuschauern Platz bietet. Das Theater gilt durch seine viele Gastspiele als die größte Reisebühne Europas.
Das Landestheater Detmold geht auf die Gründung des Hochfürstlich Lippischen Hoftheaters durch Fürst Leopold II. zurück. Heute besitzt das Landestheater in Detmold fünf Spielstätten, darunter das historische Lippische Landestheater gegenüber dem Schloss mit 680 Plätzen und das klassizistische Hoftheater, das immerhin noch 250 Zuschauern Platz bietet. Das Theater gilt durch seine viele Gastspiele als die größte Reisebühne Europas.
 Die nur knapp zwei Kilometer lange Wasserstraße wurde 1701 bis 1704 durch Graf Friedrich Adolf, dem wohl schillerndsten Lippfischen Landesfürsten, angelegt. Der Kanal diente lediglich zum Zwecke von Lustfahrten mit Gondeln der adligen Gesellschaft und führte vom Detmolder Residenzschloss bis zum heute nicht mehr existierenden Landsitz Friedrichsthal. Die gesamte Anlage ist ein bedeutendes Denkmal der barocken Wasserbaukunst. Drei Schleusen regelten den Wasserstand. Nachdem bereits 1748 der herrschaftliche Bootsverkehr wieder eingestellt wurde, errichtete man zwei Mühlen, die das Wassergefälle an den ehemaligen Schleusen wirtschaftlich nutzten.
Die nur knapp zwei Kilometer lange Wasserstraße wurde 1701 bis 1704 durch Graf Friedrich Adolf, dem wohl schillerndsten Lippfischen Landesfürsten, angelegt. Der Kanal diente lediglich zum Zwecke von Lustfahrten mit Gondeln der adligen Gesellschaft und führte vom Detmolder Residenzschloss bis zum heute nicht mehr existierenden Landsitz Friedrichsthal. Die gesamte Anlage ist ein bedeutendes Denkmal der barocken Wasserbaukunst. Drei Schleusen regelten den Wasserstand. Nachdem bereits 1748 der herrschaftliche Bootsverkehr wieder eingestellt wurde, errichtete man zwei Mühlen, die das Wassergefälle an den ehemaligen Schleusen wirtschaftlich nutzten.
Hinter der Szenerie: Der verschwenderische Graf Der Lippische Graf Friedrich Adolf war nicht gerade ein bescheidener Mensch. Er prägte mit seinen Barockbauten das Bild der Stadt Detmold bis heute. Das Renaissanceschloss ließ er großzügig barock ausbauen, schuf das Neue Palais für seine Gemahlin sowie den inzwischen nicht mehr existierenden Landsitz Friedrichstal und er ließ den Friedrichstaler Kanal als gräfliche Lustfahrwasserstraße anlegen. Auch seine Gemahlin, Amalie von Solms-Hohensolms, galt als ausgesprochen verschwenderisch! Ferdinand Christian, der Bruder des Grafen, sagte einmal: ‚Mein Bruder liebte das Maßlose, aber sie noch mehr!‘ Kein Wunder also, das der Graf und Landeschef ständig in Geldnot war! Trotzdem liebte er es, mit seinen Bauwerken und mit ausschweifenden Gesellschaften und Festen zu protzen! Der von ihm angestrebte Fürstentitel blieb ihm jedoch versagt – diese Würde wurde erst 1789 dem damaligen Regenten Leopold I. verliehen. Einmal hatte Graf Friedrich Adolf auch den russischen Zaren Peter den Großen zu Gast. Im Hinblick auf den gerade 35.000 Einwohner zählenden Kleinstaat Lippe meinte der Zar zum Grafen süffisant: ‚Eure Liebden sind zu groß für Euer kleines Land!‘
Am Ende des Friedrichstaler Kanals befindet sich die Obere Mühle. Hier stand einst der barocke Landsitz Friedrichstal inmitten einer großzügigen französischen Gartenlandschaft. Zahlreiche Wasserspiele mit Fontänen und Kaskaden, Skulpturen, Laubengänge und Blumenrabatten prägten das Gelände. 1705 entstand die prächtige Löwengrotte. Bevor der Landsitz vollständig fertig gestellt wurde, wurde er im gleichen Jahrhundert bereits wieder abgebrochen. Der Park wurde im damals zeitgemäßen englischen Stil umgestaltet, die Löwengrotte im neugotischen Stil zum Mausoleum umgestaltet. Es dient heute dem Grafen Friedrich Adolf und Fürstin Pauline als letzte Ruhestätte. Geplant ist derzeit, die Struktur des historischen Barockgartens wieder zu rekonstruieren.
 Detmold wurde glücklicherweise im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen verschont, so dass die sehenswerte Altstadt mit ihren über 600 denkmalgeschützten Häusern, die zum Teil noch aus dem späten Mittelalter stammen, erhalten blieb. Mittelpunkt des historischen Zentrums ist der Marktplatz mit dem Donopbrunnen. Hier steht das klassizistische Rathaus und mit der Erlöserkirche das älteste Gotteshaus der ehemaligen Residenzstadt. Hier lohnt es sich, durch die alten Gässchen zu bummeln und in einem der zahlreichen Cafés das historische Flair zu genießen.
Detmold wurde glücklicherweise im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen verschont, so dass die sehenswerte Altstadt mit ihren über 600 denkmalgeschützten Häusern, die zum Teil noch aus dem späten Mittelalter stammen, erhalten blieb. Mittelpunkt des historischen Zentrums ist der Marktplatz mit dem Donopbrunnen. Hier steht das klassizistische Rathaus und mit der Erlöserkirche das älteste Gotteshaus der ehemaligen Residenzstadt. Hier lohnt es sich, durch die alten Gässchen zu bummeln und in einem der zahlreichen Cafés das historische Flair zu genießen.
 Die dreischiffige spätgotische Hallenkirche, die hier in Detmold auch Marktkirche genannt wird, da sie mitten im Zentrum am Marktplatz steht, ist das älteste noch unverändert erhalten gebliebene Bauwerk der Stadt. Vermutlich wurde an dieser Stelle bereits um das Jahr 800 eine erste Holzkirche errichtet. Alte Turmreste konnten auf das 10. Jahrhundert datiert werden. Wesentliche Bauteile der heutigen Teile stammen aus dem 14. Jahrhundert. Nachdem ein verheerender Stadtbrand 1547 große Teile Detmolds vernichtete und auch die Kirche stark beschädigte, wurde sie bis 1592 in der heutigen Form wiederhergestellt. Als 1605 im Zuge der Reformation der evangelisch-reformierte Glaube in der Stadt eingeführt wurde, fiel auch die ehemals dem hl. Vitus geweihte Kirche an die protestantische Gemeinde. Der Innenraum ist der calvinistischen Auffassung nach sehr schlicht gehalten. Bemerkenswert sind der pokalförmige Taufstein von 1579, zwei Epitaphe aus dem 16. Jahrhundert und das spätbarocke Orgelprosekt von 1795. Das Innenleben der Orgel war in den 1960er Jahren erneuert worden.
Die dreischiffige spätgotische Hallenkirche, die hier in Detmold auch Marktkirche genannt wird, da sie mitten im Zentrum am Marktplatz steht, ist das älteste noch unverändert erhalten gebliebene Bauwerk der Stadt. Vermutlich wurde an dieser Stelle bereits um das Jahr 800 eine erste Holzkirche errichtet. Alte Turmreste konnten auf das 10. Jahrhundert datiert werden. Wesentliche Bauteile der heutigen Teile stammen aus dem 14. Jahrhundert. Nachdem ein verheerender Stadtbrand 1547 große Teile Detmolds vernichtete und auch die Kirche stark beschädigte, wurde sie bis 1592 in der heutigen Form wiederhergestellt. Als 1605 im Zuge der Reformation der evangelisch-reformierte Glaube in der Stadt eingeführt wurde, fiel auch die ehemals dem hl. Vitus geweihte Kirche an die protestantische Gemeinde. Der Innenraum ist der calvinistischen Auffassung nach sehr schlicht gehalten. Bemerkenswert sind der pokalförmige Taufstein von 1579, zwei Epitaphe aus dem 16. Jahrhundert und das spätbarocke Orgelprosekt von 1795. Das Innenleben der Orgel war in den 1960er Jahren erneuert worden.
Das beliebte Freilichtmuseum zeigt auf einer Fläche von 90 ha rund 100 historische Gebäude und gilt damit als das größte seiner Art in Europa. Ziel der Einrichtung ist es, den Wandel des bäuerlichen Lebens anhand von historischen Bauwerken nachvollziehbar zu machen. So wurde neben einer historischen Holländerwindmühle der Westmünsterländische Hof, der die Zeit des späten 18. Jahrhunderts repräsentiert, das ‚Paderborner Dorf‘ (Zeit um 1900) oder das ‚Sauerländer Dorf‘ (1920er Jahre) wiederaufgebaut. Man fühlt sich zurückversetzt in eine lange vergangene Zeit und kann sich so gut vorstellen, wie ein Dorf damals ausgesehen und funktioniert hat. Und auch die 1960er Jahre werden im Museum durch eine alte Landtankstelle vertreten.
 Gegenüber dem Fürstlichen Residenzschloss und dem Lippischen Landestheater befindet sich das Lippische Landesmuseum. Mit Stolz verweist man darauf, das größte und älteste Museum in Ostwestfalen-Lippe zu sein. Das 1835 gegründete Museum besitzt insgesamt fünf Häuser mit bedeutenden Sammlungen in den Sparten Naturkunde, Ur- und Frühgeschichte, der Landesgeschichte des ehemaligen Freistaates Lippe, Volkskunde, Völkerkunde, Möbel und Kunst. Darüber hinaus präsentiert die sehr breit gefächerte ständige Ausstellung ein Münzkabinett sowie Spielzeug-, Trachten- und Mineraliensammlungen. Eine weitere Abteilung behandelt den Mythos um die Varusschlacht und den germanischen Helden Arminius, der die germanischen Stämme im Kampf gegen die Römer geeint hatte. Neben der ständigen Sammlung werden auch häufig Sonderausstellungen mit interessanten Themen gezeigt.
Gegenüber dem Fürstlichen Residenzschloss und dem Lippischen Landestheater befindet sich das Lippische Landesmuseum. Mit Stolz verweist man darauf, das größte und älteste Museum in Ostwestfalen-Lippe zu sein. Das 1835 gegründete Museum besitzt insgesamt fünf Häuser mit bedeutenden Sammlungen in den Sparten Naturkunde, Ur- und Frühgeschichte, der Landesgeschichte des ehemaligen Freistaates Lippe, Volkskunde, Völkerkunde, Möbel und Kunst. Darüber hinaus präsentiert die sehr breit gefächerte ständige Ausstellung ein Münzkabinett sowie Spielzeug-, Trachten- und Mineraliensammlungen. Eine weitere Abteilung behandelt den Mythos um die Varusschlacht und den germanischen Helden Arminius, der die germanischen Stämme im Kampf gegen die Römer geeint hatte. Neben der ständigen Sammlung werden auch häufig Sonderausstellungen mit interessanten Themen gezeigt.
Das außergewöhnliche Museum behandelt als einziges seiner Art die Geschichte und die Kultur der Russlanddeutschen und der Russlandmennoniten. Schwerpunkte sind das häusliche Umfeld, das religiöse Leben und die wirtschaftlichen Errungenschaften der Russlanddeutschen in ihrer langen Migrationsgeschichte. Erwähnenswert sind die von Jakob Wedel zur Verfügung gestellten Gemälde und Plastiken. Der 1931 in Kirgisien geborene Künstler erwarb sich international in vielen Ausstellungen Anerkennung und lebt seit 1988 im ostwestfälischen Schieder-Schwalenberg. Wedel gilt als der wohl bekannteste russlanddeutsche Künstler.
Die einstige Höhenburg war zwischen 1190 und 1194 durch die Edelherren zur Lippe, Bernhard II. und seinen Sohn Hermann II. erbaut worden. Während der Eversteiner Fehde im frühen 15. Jahrhundert wurde Herzog Heinrich I. von Braunschweig auf der Burg festgesetzt. Doch Mitte des gleichen Jahrhunderts brannte die Burg nieder. Danach wurde die Wehranlage nicht wieder aufgebaut. Die Anlage der Falkenburg, die einst aus einer Vor- und einer Hauptburg bestand, steht heute als Bodendenkmal unter Denkmalsschutz. Zuletzt konnte die Ruine aufgrund umfangreicher archäologischer Untersuchungen nicht betreten werden.
Im Detmolder Stadtteil Berlebeck befindet sich mit der schon 1939 gegründeten Adlerwarte ein beliebter und vielbesuchter Vogelpark. Rund 200 verschiedene Greifvögel von 46 Arten gibt es hier zu bestaunen, darunter Falken, Adler, Milane, Bussarde, Eulen und Geier. Innerhalb der Saison finden mehrfach am Tage Flugvorführungen statt.
Die Adlerwarte diente auch schon als Kulisse für mehrere Filme, darunter ‚Die Geierwally‘ und ‚Die Schlangengrube und das Pendel‘
Nicht weit entfernt vom Hermannsdenkmal am Teutoburger Wald südwestlich von Detmold befindet sich der Vogelpark Heiligenkirchen. Umgeben von farbigen Blumenwiesen werden rund 1200 einheimische und exotische Vögel aus 300 Arten gehalten, darunter Papageien, Pelikane, Flamingos, Pfauen, Störche und Kraniche. Der Vogelpark engagiert sich verstärkt um die Nachzucht von seltenen Vogelarten.
Horn – Bad Meinberg
o der Teutoburger Wald in das Eggegebirge übergeht, liegt die Stadt Horn-Bad Meinberg. Mit der ‚Lippischen Velmerstot‘ (441m) und der ‚Preußischen Velmerstot‘ (468m) befinden sich die höchsten Berge des Eggegebirges und mit den Barnacken (446m) auch der höchste Berg des Teutoburger Waldes auf dem Stadtgebiet. Dazwischen liegt das idyllische Felsental des Silberbaches. Mit den Externsteinen befindet sich auch eines der markantesten Naturdenkmäler Deutschlands in Horn-Bad Meinberg. Hier wurden vermutlich schon in vorgeschichtlicher Zeit kultische Rituale vollzogen und auch heute besitzen die 50m hohen Felsen für spiritistische Zeitgenossen eine magische Anziehungskraft. In Bad Meinberg hat sich bereits im 18. Jahrhundert ein Kurbetrieb etabliert. Im barocken Kurpark haben sich noch mehrere Einrichtungen aus dieser Zeit erhalten.
Die Stadt Horn-Bad Meinberg, die in der heutigen Form im Zuge der Gebietsreform 1970 entstand, besitzt ein ausgedehntes Radroutennetz mit 24 verschiedenen Touren. Die Radstrecken besitzen eine Länge von 15 bis 70 km und wurden vom ADFC Lippe zusammengestellt.
Sehenswertes:
Umgeben von einem kleinen Park im Teutoburger Wald befindet sich eine der markantesten Natursehenswürdigkeiten Deutschlands. Die Externsteine bestehen aus mehreren Sandsteinfelsen, die vor rund 70 Mio. Jahren als waagerechter Block entstanden und seitdem durch Erdverschiebungen senkrecht aufgestellt wurden. Durch Erosion erhielten sie dann ihre charakteristische heutige Form. Die fast 50m hohen Felsblöcke, die aus 13 freistehenden Einzelfelsen bestehen, stehen inzwischen unter Kultur- und Naturdenkmalschutz. Man kann die Externsteine über eine Felsentreppe besteigen, die wohl schon mindestens seit dem 17. Jahrhundert besteht.
Die Externsteine besaßen wahrscheinlich bereits in der frühen Steinzeit kultische Bedeutung. Hier ist auch einer der möglichen Standorte der Irminsul, dem höchsten Heiligtum der Germanen. Bis zum heutigen Tage verehren viele esoterisch veranlagte Menschen die Felsengruppe als mystischen Kraftort mit spirituellen Eigenschaften. Zur Walpurgisnacht und zur Sommersonnenwende treffen sich hier Massen an Personen, um gemeinsam zu feiern. Inzwischen ist aber der Verzehr von Alkohol an diesen Tagen verboten – offensichtlich haben es einige doch zu bunt getrieben…
Direkt an der alten Stadtmauer von Horn steht die Burg Horn. Vermutlich entstand sie um die Zeit der Stadtgründung. Die erste urkundliche Erwähnung eines herrschaftlichen Hauses stammt jedenfalls von 1310. 1659 erhielt die Wehranlage mit dem Anbau des Seitenflügels ihre heutige Charakteristik mit den beiden im rechten Winkel zueinander stehenden Gebäudeteilen. Burg Horn hatte lange als Wohnsitz der Edelherren zur Lippe gedient. Heute beherbergt das historische Gemäuer ein Heimatmuseum, das die Stadtgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart beleuchtet. Besondere Schwerpunkte der Ausstellung sind die Schleifmühle und die Kupferschmiede. Das Museum ist zwischen Ostern und Allerheiligen geöffnet.
Der über 6 ha große historische Kurpark von Bad Meinberg wurde bereits 1770 als barocke und streng geometrische Gartenanlage angelegt. Seitdem ist er allerdings mehrfach umgestaltet worden. Die Ost-West-Achse des Parks geht im Westen in die zentrale Einkaufstraße des Kurortes über. Im Südwesten besitzt der Kurpark mit dem Schneckenberg einen kleinen Aussichtshügel. Der 1842 erbaute Brunnentempel ist das Wahrzeichen von Bad Meinberg. Daneben haben sich das Bade- und Logierhaus Stern (1773) und das Kurhaus Rose (1775) als historische Gebäude erhalten.
Im Seepark, einem 1915 fertig gestellten Teil der Grünanlage, schießt eine 12m hohe Fontäne aus dem Teich. Der sogenannte Berggarten wurde 1928 als Erweiterung angelegt. Östlich des Kernortes schließt sich das Silvatikum direkt an den Kurpark an. In diesem Länderwaldpark wurden in den 1960er Jahren 36.000 Bäume und Sträucher gepflanzt, die inzwischen bereits eine stattliche Größe erreicht haben. Das Silvatikum ist der größte Park in Horn-Bad Meinberg.
Das private Traktorenmuseum im Ortsteil Kempenfeldrom zeigt landschaftliche Geräte vom Mittelalter bis in die 1960er Jahre, darunter rund 60 motorisierte Landmaschinen. Die Sammlung wird von Johannes Glitz seit Jahrzehnten liebevoll gepflegt.
Die Kirche, die vor der Reformation Johannes dem Täufer geweiht war, ist eine dreischiffige Hallenkirche aus dem späten 15. Jahrhundert. Der Turm stammt noch von der Vorgängerkirche und wurde vermutlich im 12. Jahrhundert erbaut. Nach einem Blitzschlag im Jahr 1819 mussten das gesamte Dach und die welsche Haube des Turmes erneuert werden. Zum Inventar gehören das gotische Chorgestühl aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert, der Taufstein von 1589, das Orgelprospekt aus dem 17. Jahrhundert sowie fünf Kronleuchter aus dem Jahre 1708.
Eine erste Kirche wurde in Bad Meinberg bereits im 9. Jahrhundert durch Mönche erbaut. Vermutlich handelte es sich dabei um ein Gebäude aus Holz. Das heutige Gotteshaus wurde im 12. Jahrhundert im romanischen Stil erbaut. Seit der Reformation im Jahre 1541 dient sie der evangelisch-reformierten Kirche als Gotteshaus. Nachdem im späten 18. Jahrhundert der Kurbetrieb begann, stieg die Einwohnerzahl von Bad Meinberg sprunghaft an und das Kirchengebäude wurde für die stetig wachsende Gemeinde zu klein. Mehrfach wurde das Gotteshaus ausgebaut. Heute beschreibt die Kirche im Grundriss eine Kreuzform und fasst bis zu 700 Gläubige. Sehenswert ist das Sakramentshäuschen aus der Zeit um 1500. Einst beherbergte die Kirche ein übergroßes Taufbecken, in dem der Sachsenherzog Widukind getauft worden sein soll. Hinter der Szenerie: Die Taufe Widukinds und der Taufstein von Meinberg Über den Sachsenführer Widukind gibt es eine Vielzahl von Sagen und Mythen. Der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten lässt sich allerdings nur selten belegen. Tatsache ist, dass er der große Wiedersacher Karls des Großen war. Der Kaiser fühlte sich damals genötigt, mit seinem Heer gegen die Sachsen zu ziehen, um das gleichwohl renitente als auch unchristliche Volk zu unterwerfen – was ihm schließlich auch gelang. Als Zeichen seiner Niederlage ließ sich der Sachsenherzog taufen – angeblich in der Kirche von Meinberg, so erzählt es die Sage. Dort hatte es einst einen riesigen Taufstein gegeben, über dessen Verbleib allerdings auch keine wirklich verlässlichen Informationen vorliegen. 1736 soll dieser während der Renovierung des Gotteshauses auf dem Kirchhof als Blumenkübel zweckentfremdet worden sein. Eine andere Quelle behauptet, der Taufstein wurde zerschmettert und die Steine für den Turmbau genutzt. Wie auch immer: nach 1793 verliert sich die Spur der Taufe, und so weiß man heute nichts mehr so genau! Nur das der Sachsenherzog an diesem Orte getauft wurde, das ist vielleicht und möglicherweise ganz, ganz sicher…
Die Naturbühne wird unter den Einheimischen liebevoll die ‚schönste Sackgasse von Lippe‘ genannt. Sie liegt direkt am Waldrand und wird in den Sommermonaten bereits seit den 1960er Jahren von einer Laienschauspielgruppe bespielt. Gegeben werden überwiegend Komödien, Volksstücke und Märchen für Kinder.
Die Zweiflügelanlage am Marktplatz von Horn wurde um das Jahr 1616 im Stil der Weserrenaissance errichtet. Das markante barocke Portal entstand 1680. Lange beherbergte das zweistöckige Gebäude eine Bierbrauerei und eine Brandweinbrennerei, später diente der Hof als Hotel.
Schlangen
m Rande der Senne liegt die ostwestfälische Gemeinde Schlangen. Teile des Gemeindegebietes liegen im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge, größere Areale werden aber auch vom Truppenübungsplatz Senne eingenommen. Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Oesterholz-Haustenbeck, Kohlstädt und Schlangen. Gleich zwei Heimatmuseen dokumentieren die Geschichte der Region.
Von den ehemals hochherrschaftlichen Gebäuden sind nur noch Fragmente erhalten. Das einstige Jagdschloss Oesterholz wurde bis auf die Meierei abgetragen. Das verbleibende Gebäude beherbergt heute ein Altersheim. Die einstige fränkische Wehrburg in Kohlstädt verfällt seit dem 14. Jahrhundert zur Ruine. Und auch die mittelalterliche Kirche, die womöglich auf das 9. Jahrhundert zurückgeht, wurde im späten 19. Jahrhundert neu erbaut – nur der Westturm aus dem 13. Jahrhundert blieb stehen.
Übrigens: die Einwohner von Schlangen heißen ‚Schlänger‘.
Sehenswertes:
Während die neuromanische evangelische Kirche erst 1878 erbaut wurde, stammt der mittelalterliche Westturm noch von der Vorgängerkirche aus dem frühen 13. Jahrhundert. Die Ursprünge der Kirche gehen aber wohl sogar ins 9. oder 10. Jahrhundert zurück.
Die Faktenlage um die Burgruine, die auch ‚Kleine Herrenburg‘ genannt wird, ist recht dürftig. Wahrscheinlich als fränkische Wehrburg zwischen 1000 und 1200 auf einem Erdhügel erbaut, übernahmen 1365 die Edelherren von der Lippe das Anwesen, nutzten es aber nur für wenige Jahre. Danach verfiel die Burg allmählich, so dass heute nur eine einsturzgefährdete Ruine erhalten blieb. Erkennbar sind noch der quadratische 12 Meter hohe Wehrturm, dessen Mauern eine Tiefe von knapp 2,4 m besitzen sowie die Fundamente mehrerer Nebengebäude.
An der Stelle eines alten Meierhofes errichtete Graf Simon zwischen 1597 bis 1599 ein repräsentatives Fachwerkschloss, das von einem Wassergraben umgeben war. Nach Beschädigungen im 30jährigen Krieg wurde das Anwesen Mitte des 17. Jahrhunderts zu einem massiven Herrenhaus mit drei Türmen ausgebaut, das als Jagdschloss genutzt wurde. Doch während des 18. Jahrhunderts verfiel die Anlage, so dass man sie 1775 abtrug. Erhalten blieb nur die Meierei, die zunächst als Verwaltungssitz des Forstamtes Horn diente und seit 1929 zu einem Altersheim umfunktioniert wurde.
In einem alten Bürgerhaus aus dem späten 19. Jahrhundert befindet sich heute das Dorfmuseum. Die heimatkundliche Ausstellung beschäftigt sich mit der Geschichte der Großgemeinde Schlangen und zeigt über 5.000 Exponate, die die einstigen Lebensbedingungen und die mühevollen Arbeitsumstände im Handwerk und in der Landwirtschaft beschreiben. Zum Dorfmuseum gehört auch die 1814 erbaute Alte Schmiede, die noch bis 1975 in Betrieb war. Der Name bezieht sich auf den letzten Schmied Richard Mötz. Die originale Ausstattung ist noch immer erhalten.
Im Zentrum des Schlänger Ortsteiles Oesterholz-Haustenbeck steht eine über 200 Jahre alte Hofanlage, in der heute ein Heimatmuseum eingerichtet ist. Themenschwerpunkt ist die 1150jährige Dorfgeschichte der 1939 aufgelösten Gemeinde Haustenbeck, die mit Dokumenten, Bildern und zahlreichen Exponaten umschrieben wird.
Bad Lippspringe
ie Kurstadt liegt südlich des Teutoburger Waldes und an den Ausläufern des Eggegebirges an der Heidelandschaft der Senne. Hier herrscht ein ausgesprochen reizarmes Heilklima mit ausgeglichenen Feuchtigkeitswerten – so nennt sich Bad Lippspringe auch die ‚grüne Lunge Ostwestfalens‘. Bad Lippspringe ist seit 1982 ‚Staatlich anerkanntes Heilbad‘ und ‚Heilklimatischer Kurort‘. zusätzlich erhielt die Stadt 2005 das Prädikat “Premium Class“ zuerkannt. Gleich drei Kurgärten und der 240 ha große Kurwald laden zum Flanieren, Wandern und Verweilen ein. Berühmt geworden ist Bad Lippspringe durch seine verschiedenen Heilquellen, die die über 175-jährige Bad-Tradition begründeten. Zu ihnen zählen die Arminiusquelle, die Liboriusquelle und die 27,9°C warme Martinusquelle. Papst Pius X. war einst der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle. Die größte Quelle aber ist die der Lippe. Sie gehört zu den wasserreichsten Quellen Deutschlands. Der rechte Nebenfluss des Rheines beginnt hier seine 220 km lange Reise nach Westen. An der Lippequelle hielt Karl der Große im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen ab. In diesem Zusammenhang wurde der Ort erstmals urkundlich als ‚Lippiogyspringiae‘ erwähnt. Die Burg, von der heute nur noch eine Ruine im Kurpark erhalten blieb, entstammt vermutlich dem frühen 13. Jahrhundert. Um 1380 wurde die Stadtmauer um die Altstadt erbaut. Von ihr sind aber nur noch wenige Reste erhalten.
Im Jahr 2017 wird in Bad Lippspringe die Landesgartenschau stattfinden.
Sehenswertes:
 Die Ruine der Lippspringer Burg ist eines der Wahrzeichen der Kurstadt und steht heute im Kurpark gleich neben der Lippequelle. Von der einst stolzen Wasserburg, die ursprünglich aus einer Kernburg und einer Vorburg bestand, ist bis auf die Reste des Amtshauses, eine Umfassungsmauer und den historischen Burgkeller nicht mehr viel erhalten. Dort, wo früher das Hauptgebäude stand, befindet sich heute das Kongresshaus. Die Burg Lippspringe wurde 1312 erstmals erwähnt. Damals befand sich das Gemäuer im Besitz des Paderborner Domkapitels und diente als Wohnsitz für Burgmannen, die als Ritter und adlige Ministeriale Verteidigungsaufgaben für die Burggrafen erfüllten. Die Burg wurde bei verschiedenen Fehden immer wieder belagert und beschädigt. Besonders stark wurde sie im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Burg schließlich endgültig aufgegeben. Die Mauern wurden weitgehend abgetragen und die Wassergräben zugeschüttet.
Die Ruine der Lippspringer Burg ist eines der Wahrzeichen der Kurstadt und steht heute im Kurpark gleich neben der Lippequelle. Von der einst stolzen Wasserburg, die ursprünglich aus einer Kernburg und einer Vorburg bestand, ist bis auf die Reste des Amtshauses, eine Umfassungsmauer und den historischen Burgkeller nicht mehr viel erhalten. Dort, wo früher das Hauptgebäude stand, befindet sich heute das Kongresshaus. Die Burg Lippspringe wurde 1312 erstmals erwähnt. Damals befand sich das Gemäuer im Besitz des Paderborner Domkapitels und diente als Wohnsitz für Burgmannen, die als Ritter und adlige Ministeriale Verteidigungsaufgaben für die Burggrafen erfüllten. Die Burg wurde bei verschiedenen Fehden immer wieder belagert und beschädigt. Besonders stark wurde sie im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Burg schließlich endgültig aufgegeben. Die Mauern wurden weitgehend abgetragen und die Wassergräben zugeschüttet.
 Gleich neben der Burgruine im Kurpark von Bad Lippspringe befindet sich der Quellteich der Lippe, im Volksmund auch ‚Odins Auge‘ genannt. Denn glaubt man der Sage, so warf hier einst der germanische Gott Odin sein Auge in die trockene Einöde, um diese durch Wasser in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Belegt dagegen ist, dass Karl der Große hier im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen abhielt. Mit einer Schüttung von 740 Litern in der Sekunde gehört die Lippequelle zu den größten Quellen Deutschlands. Von hier aus beginnt der 220 Kilometer lange Weg des Wasserlaufes, der schließlich bei Wesel mit der Mündung in den Rhein endet.
Gleich neben der Burgruine im Kurpark von Bad Lippspringe befindet sich der Quellteich der Lippe, im Volksmund auch ‚Odins Auge‘ genannt. Denn glaubt man der Sage, so warf hier einst der germanische Gott Odin sein Auge in die trockene Einöde, um diese durch Wasser in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Belegt dagegen ist, dass Karl der Große hier im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen abhielt. Mit einer Schüttung von 740 Litern in der Sekunde gehört die Lippequelle zu den größten Quellen Deutschlands. Von hier aus beginnt der 220 Kilometer lange Weg des Wasserlaufes, der schließlich bei Wesel mit der Mündung in den Rhein endet.
Gerade einmal 25 Meter neben dem Lippequellteich befindet sich die Arminiusquelle. Die warme, rötliche Calcium-Sulfat-Hydrogen-Carbonat-Therme mit einer Temperatur von 20,5°C galt lange als Nebenquelle der Lippe, besitzt aber einen eigenständigen Wasserursprung.
 Am Rande des Kurparks befindet sich das zweistöckige, denkmalgeschützte Prinzenpalais. Es war 1855 als Kurhaus erbaut worden, diente aber zunächst als Herberge dem Herzog von Nassau, der regelmäßig in die Senne zum Jagen kam. Im Zuge der Weltausstellung ‚Expo 2000‘ richtete man im Prinzenpalais das Informations- und Dokumentationszentrum ‚Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne‘ ein.
Am Rande des Kurparks befindet sich das zweistöckige, denkmalgeschützte Prinzenpalais. Es war 1855 als Kurhaus erbaut worden, diente aber zunächst als Herberge dem Herzog von Nassau, der regelmäßig in die Senne zum Jagen kam. Im Zuge der Weltausstellung ‚Expo 2000‘ richtete man im Prinzenpalais das Informations- und Dokumentationszentrum ‚Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne‘ ein.
Gleich neben der Kirche St. Martin befindet sich das Haus Hartmann. Es beherbergt neben einem Jugendtreff auch eine heimatkundliche Ausstellung. Das vom Heimatverein betriebene Museum beleuchtet die wechselvolle Geschichte der Stadt Bad Lippspringe. Die Schwerpunkte der Ausstellung gliedern sich in fünf Abschnitte: die Erdgeschichte, Siedlungen in der Steinzeit, das Leben im Mittelalter, die jüngere Geschichte sowie die Geschichte des Bades. Ein Modell zeigt das Rathaus von 1802 und eines die Stadt, so wie sie im Jahre 1600 ausgesehen hat.
 In Bad Lippspringe gibt es gleich drei Kurparks. Der 6,2 ha große Arminuspark besitzt einen sehr alten Baumbestand und wurde 1840 in Anlehnung an Pläne des berühmten Landschaftsplaner Peter Josef Lenné angelegt. Im Zuge der ‚Expo 2000‘ wurde das Areal zu einem so genannten ‘Allergologischen Kommunikationspark‘ umgestaltet. Die Lippepromenade führt entlang des Lippequellteiches zur Burgruine. Gegenüber befindet sich die Arminiusquelle.
In Bad Lippspringe gibt es gleich drei Kurparks. Der 6,2 ha große Arminuspark besitzt einen sehr alten Baumbestand und wurde 1840 in Anlehnung an Pläne des berühmten Landschaftsplaner Peter Josef Lenné angelegt. Im Zuge der ‚Expo 2000‘ wurde das Areal zu einem so genannten ‘Allergologischen Kommunikationspark‘ umgestaltet. Die Lippepromenade führt entlang des Lippequellteiches zur Burgruine. Gegenüber befindet sich die Arminiusquelle.
Im Nordosten schließt sich direkt der 2,5 ha große Jordanpark an. In dem um 1900 angelegten waldartigen Park entspringt das kleine Flüsschen Jordan.
Im Gegensatz zum Arminiuspark und Jordanpark ist der nach Karl dem Großen benannte Kaiser-Karls-Park nicht frei zugänglich. Er wurde 1951 als Ersatzpark im Nordwesten der Stadt angelegt, da der Arminiuspark durch die britische Besatzungsmacht beschlagnahmt worden war. Ein besonderer Blickfang ist die große Wasserfontäne, die am Abend bunt angestrahlt wird. Der Park ist gärtnerisch sehr aufwändig mit farbigen Blumenrabatten, blühenden Büschen und Brunnenanlagen gestaltet. Besonders im Mai und Juni imponiert der Park, der als der Schönste der drei Kurparks gilt, mit seiner überbordenden Blütenpracht. Fahrräder sind im Kaiser-Karls-Park nicht gestattet.
Teile des Kurparkes und des angrenzenden Kurwaldes gehören zum Kernbereich der 2017 hier stattfindenden Landesgartenschau.
 Die Liborius-Heilquelle wird durch ein neugotisches Brunnenhaus eingefasst. Die schmucke Trinkhalle entstand zwischen 1905 und 1910 und fällt durch die reich gegliederte Fensterfront auf. Durch das Glasdach wirkt der innere Saal mit seinen Säulen sehr hell. Über dem Wasserauswurf der Heilquelle steht eine Statue des hl. Liborius. Der Bischof von Le Mans lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Seine Reliquien werden in Paderborn bewahrt, was zu der alten Städtefreundschaft zwischen Paderborn und Le Mans führte. Von Paderborn ging die weltweite Heiligenverehrung Liborius aus. Der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle war Papst Pius X. (1835 – 1914). Das Wappen prangt noch heute an der Front des Brunnenhauses.
Die Liborius-Heilquelle wird durch ein neugotisches Brunnenhaus eingefasst. Die schmucke Trinkhalle entstand zwischen 1905 und 1910 und fällt durch die reich gegliederte Fensterfront auf. Durch das Glasdach wirkt der innere Saal mit seinen Säulen sehr hell. Über dem Wasserauswurf der Heilquelle steht eine Statue des hl. Liborius. Der Bischof von Le Mans lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Seine Reliquien werden in Paderborn bewahrt, was zu der alten Städtefreundschaft zwischen Paderborn und Le Mans führte. Von Paderborn ging die weltweite Heiligenverehrung Liborius aus. Der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle war Papst Pius X. (1835 – 1914). Das Wappen prangt noch heute an der Front des Brunnenhauses.
Der uralte Gutshof ist schon rund 1000 Jahre alt. Bereits im Jahre 1036 taucht er in einem alten Dokument auf. Das heutige Herrenhaus wurde um 1600 erbaut. Die Wirtschaftsgebäude entstanden vom frühen 17. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert. Das landwirtschaftliche Anwesen befindet sich auch heute im privaten Besitz und kann daher nicht besichtigt werden.
Radrouten die durch Bad Lippspringe führen:
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Paderborner Land Route
Paderborn
ie Universitätsstadt Paderborn ist das wirtschaftliche, kulturelle und geografische Zentrum des Paderborner Landes. In der ostwestfälischen, katholisch geprägten Großstadt prallen Geschichte und Gegenwart, Mittelalter und Hightech unmittelbar aufeinander. Paderborn entstand vor über 1200 Jahren. Nach der Unterwerfung der Sachsen ließ Karl der Große im Jahre 777 an den Quellen der Pader eine Pfalz und gleich daneben einen Dom erbauen. Hier traf er sich zwanzig Jahre später mit Papst Leo III., um seine Kaiserkrönung zu besprechen. Reste der alten Kaiserpfalz sind bis heute erhalten. Der mächtige romanisch-gotische Dom, der in seiner heutigen Form aus dem 13. Jahrhundert stammt, bestimmt die weitläufige und dennoch gemütliche Innenstadt. Das Schloss Neuhaus gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Weserrenaissance und diente einst als Residenz für die Fürstbischöfe von Paderborn. Die Innenstadt hat unter den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges stark gelitten. Es gelang dennoch, einige historische Gebäude wieder aufzubauen. So zählen das Alte Rathaus, das Gymnasium Theorianum und die Bartholomäuskapelle zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Paderborns. Und natürlich gehört auch ein Abstecher zum Paderquellsees zum Pflichtprogramm eines jeden Besuchers. Die Stadt bietet ein breites Spektrum an interessanten Museen, darunter mehrere bedeutende Kunstausstellungen. Ein besonderes musealisches Highlight ist das Heinz Nixdorf MuseumsForum, das momentan größte Computermuseum der Welt.
Sehenswertes:
Stolz, mächtig und stadtprägend steht im Zentrum Paderborns der Hohe Dom St. Maria, St. Liborius und St. Kilian. Er ist die Bischofs- und Kathedralkirche des Erzbistums Paderborn.
Ein erstes Gotteshaus wurde bereits 776 durch Karl des Großen gleich neben dessen damaliger Königpfalz erbaut. Als Karl im Jahre 799 mit Papst Leo III. hier zusammentraf, wurde dabei nicht nur Karls Ernennung zum Kaiser beschlossen, sondern auch das Erzbistum Paderborn gegründet.
Der heutige Dom entstand im Wesentlichen im 13. Jahrhundert, wobei auch Teile des Vorgängerbaus aus dem 11. und 12. Jahrhundert integriert wurden. Die dreischiffige Halle ist über 100 Meter lang und besitzt zwei Querhäuser. Das Langhaus gilt in seiner Ausführung als prägend für die gesamte Region. In der Krypta werden die Gebeine des hl. Liborius aufbewahrt. Mit einer Länge von 32 Metern gehört sie zu den größten Krypten Deutschlands. Daneben befindet sich die 1935 neu errichtete Bischofsgruft. Auffällig ist der 93 Meter hohe, wuchtige Westturm, der von zwei kleineren Rundtürmen flankiert wird. Er überragt die gesamte Innenstadt Paderborns.
Der Sakralbau beherbergt eine Vielzahl wertvoller Einrichtungsgegenstände, darunter das Paradiesportal (vor 1240), die Kanzel (1736) und das Grabmahl des Fürstbischofs Dietrich IV. von Fürstenberg (1618). Zu den sehenswerten sakralen Kunstwerken gehört der gotische Hochaltar (15. Jhd.), die Doppelmadonna (um 1480), eine mittelalterliche Piéta (um 1380) sowie zwei Relieffriese.
Das im 16. Jahrhundert entstandene berühmte Drei-Hasen-Fenster befindet sich im Kreuzgang.
Als man 1964 bei Grabungen auf die Grundmauern der Kaiserpfalz Karls des Großen stieß, handelte sich dabei um eine archäologische Sensation. Die Grundmauern der Pfalzanlage stammten sowohl aus karolingischer als auch aus ottonischer Zeit. Von hier aus wurde einst Weltpolitik betrieben. Die Mauerreste waren so gut erhalten, dass man die historischen Bausubstanz für den rekonstruierten Wiederaufbau nutzte. So kann man heute sehr gut nachvollziehen, wie die originale Kaiserpfalz damals ausgesehen hat. Die Gebäude beherbergen heute ein Museum, in dem Funde aus dem frühen Mittelalter ausgestellt werden.
Die kleine Bartholomäuskapelle an der Kaiserpfalz gilt als bedeutende kunst- und baugeschichtliche Kostbarkeit. Sie wurde 1017 durch Bischof Meinwerk im byzantinischen angelehnten Stil erbaut und gilt als die älteste Hallenkirche Deutschlands. Das Gotteshaus mit dem von Säulen getragene Gewölbe ist bis heute nahezu unverändert erhalten.
Am Zusammenfluss von Lippe, Pader und Alme steht mit dem Schloss Neuhaus eines der bedeutendsten Bauwerke der Weserrenaissance. Die prachtvolle Vierflügelanlage wird von dreigeschossigen Rundtürmen flankiert. Eine Wassergräfte umgibt das Prunkhaus.
Bereits im 11. Jahrhundert hatten die Bischöfe von Paderborn an dieser Stelle ein ‚festes Haus‘ erbauen lassen. 1370 wurde Schloss Neuhaus zur bischöflichen Residenz und blieb dieses bis zum Reichsdeputationshauptabschluss im Jahre 1803. In der Folgezeit wurde das Schloss überwiegend militärisch genutzt, bis die damalige Gemeinde Schloss Neuhaus im Jahre 1957 die gesamte Schlossanlage übernahm, die darin eine Schule unterbrachte. Als Paderborn 1994 die Landesgartenschau ausrichtete, wurde um das Schloss der so genannte ‚Schloss- und Auenpark‘ angelegt, der auch heute noch im Sommer für Open-Air-Veranstaltungen genutzt wird. Das Renaissanceschloss wird heute häufig für Hochzeiten genutzt.
Fürstbischof Clemens August ließ im 18. Jahrhundert die Wirtschaftsgebäude im barocken Stil erneuern. So entstand zwischen 1729 und 1732 der große Marstall, in dem mehr als 100 Pferde Platz fanden.
Bis 1990 wurde das Gebäude noch durch eine britische Garnison genutzt. Nach einer umfassenden Sanierung ist im Marstall heute das Historische Museum untergebracht. Neben archäologischen Fundstücken, Dokumenten und Alltagsgegenständen aus der Geschichte des Stadtteils Schloß Neuhaus geht das Museum auch besonders auf die Fürstbischöfliche Residenz sowie auf die Garnisonsgeschichte des Ortes ein. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die umfangreiche Glas- und Keramiksammlung Nachtmann. Daneben finden auch häufig Sonderausstellungen statt.
Neben dem Kirchturm des Paderborner Domes befindet sich das Erzbischöfliche Diözesanmuseum. Es ist das älteste Museum dieser Art im deutschsprachigen Raum. Bereits 1853 wurde die umfangreiche Sammlung, die aus rund 8000 Werken sakraler Kunst besteht, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Ausstellung beschränkt sich allerdings auf rund 1000 Kunstwerke, die ständig ausgestellt werden. Als wertvollste Skulptur gilt eine Madonna aus der Mitte des 11. Jahrhunderts, die eine der ältesten Madonnendarstellungen in der abendländischen Kunst darstellt. Neben der ständigen Ausstellung werden im Museum auch regelmäßig Wechselausstellungen präsentiert.
Das alte Rathaus von Paderborn wurde zwischen 1613 und 1620 im Stil der Weser-Renaissance erbaut, wobei man die Bausubstanz des Vorgängergebäudes aus dem 15. Jahrhundert mit einbezog. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Rathaus zweimal umgebaut und vergrößert. Dabei entstanden der große Saal im Obergeschoss und das repräsentative Treppenhaus. Das große Ratsgebäude bot zwischenzeitlich auch Platz für das Zollamt, die Stadtwaage, die Polizei, die Feuerwehr, die Sparkasse und für ein Museum. Nachdem das historische Gebäude im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden war, richtete man es bis 1958 wieder vollständig her. Neben dem Dom gilt das Rathaus als Wahrzeichen der Stadt Paderborn.
Das Abdinghofkloster St. Peter und Paul wurde als Benediktinerabtei im Jahre 1015 gegründet. Mehrfach fiel es während des Mittelalters bei großen Stadtbränden dem Feuer zum Opfer. Letztmalig baute man es im 12. Jahrhundert wieder auf. Nach der Auflösung des Klosters im Zuge der Säkularisierung wurden die Gebäude zunächst als Kaserne genutzt. Später übernahm die evangelisch-lutherische Gemeinde das Gotteshaus als erste protestantische Kirche im ansonsten erzkatholischen Paderborn. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Kirche und die Konventgebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Bis 1952 erfolgte der Wiederaufbau der Abdinghofkirche, die auch heute noch als Hauptkirche der evangelischen Gemeinde Paderborn dient.
Das ehemalige Abdinghofkloster wurde im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört. Auf den historischen Fundamenten wurde dann die Städtische Galerie errichtet, die im Jahre 2001 durch einen modernen Anbau erweitert wurde. Die Galerie beherbergt eine umfangreiche Sammlung von graphischen und fotographischen Arbeiten aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die in regelmäßig wechselnden Ausstellungen dem Publikum präsentiert werden.
Das Museum für sakrale Kunst zeigt die private Kollektion des Künstlers Bernd Cassau in seinem eigenen Haus. In jahrzehntelanger Sammelleidenschaft trug Cassau zahlreiche historische Kelche, Kreuze und Monstranzen zusammen, die durch eigene Werke ergänzt werden. Die würdevolle Ausstellung zeigt die bestechende Schönheit und die beeindruckende Vielfalt in der sakralen Kunst und bietet darüber hinaus einen Ort der Besinnung, der Stille und der Andacht.
Das ‚Theo‘, wie das Gymnasium in Paderborn umgangssprachlich heißt, wurde bereits 799 als Domschule gegründet und gehört damit zu den ältesten noch bestehenden Schulen Deutschlands. Es steht in unmittelbarer Nähe des Rathauses mitten in der Innenstadt. Das heutige Studiengebäude entstand zwischen 1612 und 1614 und diente bis zu 1.000 Schülern gleichzeitig als Lernort. Bedeutende Schulleiter waren der Mathematiker Reinherr von Paderborn (um 1140 – um1190) sowie der spätere Paderborner Bischof und Kardinal Thomas Oliver (um 1170 – 1227).
Paderborn bedeutet ‚Paderbrunnen‘, denn mitten in der Stadt entspringt das Flüsschen Pader. Die Quelle gehört zu den wasserreichsten in Deutschland, doch schon nach vier Kilometern mündet der Fluss bei Schloß Neuhaus in die Lippe. Obwohl diese an diesem Ort viel weniger Wasser führt, verliert die Pader bei dem Zusammenfluss ihren Namen. Damit gilt die Pader als der kürzeste Fluss Deutschlands.
Der Quellbereich der Pader besteht eigentlich aus 200 verschiedenen Einzelquellen, die rund 5000 Liter Wasser in der Sekunde ausschütten. Die Geländekante, aus der das Wasser austritt, lag anfänglich knapp außerhalb der befestigten Stadt Paderborn. Erst nach einer Erweiterung der Stadtmauer im 13. Jahrhundert wurde der Quellteich Teil der Innenstadt. Nachdem im Zweiten Weltkrieg weite Teile der Innenstadt zerstört wurden, legte man das Quellgebiet der Pader als Erholungsbereich neu an.
Das weltgrößte Computermuseum befindet sich in Paderborn und ist dem großen Sohn der Stadt, Heinz Nixdorf (1925 – 1986), gewidmet. Nixdorf war Computerpionier und Unternehmer. Er gilt als Wegbereiter der dezentralen Datenverarbeitung. Seine 1952 gegründete Computerfirma ging in der Nixdorf AG auf, die sich zum weltweit erfolgreich operierenden Elektronikkonzern entwickelte.
Das Heinz Nixdorf MuseumsForum versteht sich als lebendiger musealer Veranstaltungsort. Hier wird die 5000jährige Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnik beschrieben. Diese fand ihren Anfang in der ersten Schrift in Mesopotanien. Ausgehend von dieser Keilschrift folgt die Ausstellung der Entwicklung über den klassischen Buchdruck bis zu den Schreib- und Rechenmaschinen sowie den Registrierkassen der jüngeren Vergangenheit.
Aber hauptsächlich beschäftigt sich das Museum mit der Entwicklung des Computers. Themenschwerpunkte sind die Erfindung und der frühe Gebrauch durch Spezialisten, der Computer in Wirtschaft und Beruf und der Computer für Alle. Man wagt einen Ausblick in die globale digitale Zukunft, präsentiert eine Galerie der Computerpioniere und geht natürlich ausführlich auf das Leben und das Werk von Heinz Nixdorf ein.
Die erste Domschule wurde in Paderborn bereits 799 gegründet. Das Museum beschreibt als die über 1.200jährige Geschichte des Paderborner Schulwesens. Neben einem rekonstruiertem Klassenzimmer, das einen Eindruck vom Unterricht im Jahre 1900 vermittelt, beschäftigt sich das Museum mit der Entstehung des Schulbuches und beschreibt die Strafenvielfalt, dokumentiert alte Schulgebäude und stellt bekannte und bedeutende Lehrerpersönlichkeiten sowie berühmt gewordene Paderborner Schüler vor.
Das Adam-und-Eva-Haus stammt noch aus dem 16. Jahrhundert und gehört zu den schönsten erhaltenen Fachwerkshäusern Paderborns. Es beherbergt heute das Museum für Stadtgeschichte, das in seiner Sammlung sowohl frühgeschichtliche Funde als auch typische Gebrauchsgegenstände, Möbel und Dokumente aus der jüngeren Vergangenheit präsentiert. Die Sammlung wird komplettiert mit Gemälden und Graphiken regionaler Künstler.
Im Schlosspark von Schloss Neuhaus wurde 1825 eine Reithalle für die hier stationierte preußische Garnison erbaut. Es versprüht den reizvollen Charme eines historischen Biedermeiergebäudes und beherbergt heute eine Abteilung der Städtischen Galerie Paderborn. Hier werden regelmäßig wechselnde Ausstellungen mit Gemälden und Graphiken vornehmlich des 16. bis 20. Jahrhunderts gezeigt. Hinter der Szenerie: Der Dachdeckermord Im 17. Jahrhundert, als das prachtvolle Schloss Neuhaus als fürstliche Residenz für die Paderborner Bischöfe diente, wurden zum adligen Amüsement häufig Jagdgesellschaften gegeben. Als Bischof Ferdinand von Fürstenberg einmal zur Jagd einlud, nahm auch ein junger, offensichtlich unreifer Verwandter daran teil. Der junge Mann hatte an diesem Tage einfach kein Glück gehabt – er erlegte kein einziges Tier. Entsprechend frustriert und ungehalten traf er nach dem Halali wieder auf dem Wasserschloss ein. Da sah er einen Dachdecker, der seine Arbeit in luftiger Höhe kurz unterbrochen hatte, um den Einmarsch der zurückkehrenden Jagdgesellschaft zu beobachten. Aus seiner verärgerten Unzufriedenheit heraus zielte er kurzerhand auf den armen Handwerker, um allen Beteiligten zu beweisen, welch außergewöhnlich brillanter Schütze er doch eigentlich sei – er traf ihn tatsächlich tödlich! Als man den übermütigen Schützen verhaften wollte, entzog sich dieser auf seinem Pferd und floh im rasanten Galopp! Erst Jahre später, als er naiv glaubte, dass Gras über die Sache gewachsen war, kehrte er auf das Schloss zurück. Er nahm an, dass die Tötung eines niederen Burschen schon keine gravierende Bestrafung nach sich ziehen würde. Eine solche Kleinigkeit würde man ihm, der er ja schließlich ein höher geborener Verwandter des Bischofs war, schon nicht nachtragen – und schon gar nicht nach der nun vergangenen Zeit. Doch da irrte er sich gewaltig! Der Bischof ließ ihn festnehmen und er wurde zum Tode verurteilt. Nur wenig später wurde das Urteil auf der Wewelsburg vollstreckt. Noch heute erinnert eine liegende Steinfigur am Dachfirst des Westgiebels an den ermordeten Dachdecker.
Mehr als 120 Traktoren, davon gleich mehrere der legendäre Lanz-Bulldogs, sind im Deutschen Traktoren- und Modellauto-Museum zu bewundern. Die Ausstellung zeigt die motorisierte Entwicklung in der Landtechnik vom Dampfmaschinengerät der 1920er Jahre bis zu den Treckern der Nachkriegszeit. Daneben werden eine alte Tankstelle aus den 1920er Jahren sowie eine historische Schmiede präsentiert. Besonders beeindruckend ist die umfangreiche Sammlung von rund 10.000 Modellfahrzeugen, die PKW’s, LKW’s und – natürlich – Traktoren umfasst.
Ursprünglich diente die Grabeskirche in Jerusalem als Vorbild für die 1036 geweihte Busdorfkirche. Die beiden Rundtürme und der Westflügel blieben von diesem ersten Kirchenbau noch erhalten. Die dreischiffige Halle wurde erst Ende des 13. Jahrhunderts fertig gestellt. Kirchturm und Vorhalle stammen aus dem 17. Jahrhundert. Besondere Einrichtungsgegenstände sind ein hölzernes Kruzifix (um 1280), das Sakramentshäuschen und der Taufstein (beides Spätgotik) sowie eine Reihe von Epitaphien.
Die barocke Marktkirche wurde zwischen 1682 und 1692 als Jesuitenkirche St. Franz Xaver errichtet. Der Jesuitenorden war im späten 16. Jahrhundert nach Paderborn gekommen und hatte zunächst die Bartholomäuskirche und die später abgebrochene Johanniskirche genutzt. Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg stiftete dem Orden schließlich das neue Gotteshaus. Im Jahre 1773 jedoch wurde der Konvent aufgehoben und aus der Jesuitenkirche wurde eine katholische Pfarrkirche. Von der reichen barocken Innenausstattung sind leider nur die Kanzel und die hängende Madonna erhalten geblieben. Sie waren während des Zweiten Weltkrieges ausgelagert worden. Der Rest des Inventars ging verloren, als die Kirche bis auf die Außenmauern zerstört wurde. Bis 1958 dauerte der Wiederaufbau. Seit 2003 schmückt der rekonstruierte barocke Hochaltar wieder den Innenraum der Marktkirche.
Der Ursprung der alten Gaukirche St. Ulrich ist heute nicht mehr bekannt. Möglicherweise wurde sie im 9. Jahrhundert für Bischof Badurad erbaut, um einen von vom Volk getrennten Gottesdienst feiern zu können. Belege gibt es hierfür jedoch nicht. Im 12. Jahrhundert jedenfalls diente das Gotteshaus als Pfarrkirche für den Padergau – daher ihr Name. Vom Stil her wird eine Bauzeit um 1275 vermutet. Wahrscheinlich gab es auch bereits einen Vorgängerbau. Im Laufe der Geschichte gab es mehrere Umbauten an der Gaukirche. Die wesentlichsten Veränderungen wurden Mitte des 18. Jahrhunderts durchgeführt, als die hübsche barocke Fassade am Hauptportal entstand. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gotteshaus erheblich beschädigt. Beim Wiederaufbau erhielt der achteckige Kirchturm sein heutiges Zeltdach.
Radrouten die durch Paderborn führen:
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Kaiser-Route Aachen – Paderborn
Paderborner Land Route
Delbrück
n der flachen Landschaft zwischen Lippe und Ems liegt Delbrück. Sie ist die zweitgrößte Stadt im Kreis Paderborn. Neben der Kernstadt besitzt Delbrück neun Stadtteile und wirbt daher mit dem Slogan ‚Zehn Orte – eine Stadt‘. Erste Siedlungsspuren lassen bereits auf eine Besiedlung vor 3000 Jahren schließen. In Anreppen befand sich einst ein römisches Versorgungslager, in dem kurzzeitig bis zu 6000 Soldaten stationiert waren. Delbrück selber wurde im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt und besaß bereits im 15. Jahrhundert weitreichende politische und wirtschaftliche Freiheiten. Das Wahrzeichen ist der schiefe Turm der romanischen Kirche St. Johannes Baptist. Auffällig ist die erhaltene historische Ringbebauung um die zentrale Pfarrkirche. Die Stadt ist Namengeberin für das Delbrücker Land, einem Paradies für Radfahrer. Die platte Landschaft besitzt eine maximale Höhendifferenz von insgesamt nur 37 Metern und bietet zehn kleinere und mit der 33 km langen Spargelroute und dem 45 km langen Kapellenweg zwei längere Radtouren an.
Sehenswertes:
Der schiefe Kirchturm der katholischen Pfarrkirche Johannes Baptist ist das Wahrzeichen der Stadt Delbrück. Die hölzerne Turmspritze hat sich witterungsbedingt im Laufe der Jahrhunderte beträchtlich geneigt.
Das Gotteshaus entstand als massive Wehrkirche um 1180. Möglicherweise stand hier bereits ein Vorgängerbau an gleicher Stelle. 1340 erhielt der romanische Bau ein gotisches Schiff und einen gotischen Chor. Der Turmhelm entstand gegen 1400.
Die bedeutendsten Kirchenschätze stammen zumeist aus der Zeit des Barock, wie der Hochaltar, die Doppelmadonna und die Figur der hl. Agatha. Dagegen wurde die wertvolle Pietà bereits gegen 1400 erschaffen.
Auffällig ist die erhaltene historische Kirchenringbebauung um die zentrale Pfarrkirche. Die Fachwerkgebäude stammen alle aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Das Pfarrhaus wurde 1716 nach Pläne des berühmten Barockbaumeisters Johann Conrad Schlaun (1695 – 1773) erbaut. Das Fachwerkgebäude mit dem Mansardendach befindet sich knapp außerhalb der Kirchringbebauung.
Am Kirchplatz, mitten im Städtchen Delbrück, steht das Heimathaus. Der hiesige Heimatverein zeigt in zwei Räumen Gegenstände und Dokumente aus der Geschichte Delbrücks, darunter historische Trachten und alte Fahnen. Außerdem unterhält der Karnevalsverein ‚Eintracht‘ hier im Gebäude ein eigenes Museumsstübchen und auch die ‚Johannes-Schützenbruderschaft‘ zeigt in seinem Schützenzimmer eine kleine Ausstellung.
Im oberen Stockwerk des Feuerwehr-Gerätehauses im Stadtteil Ostenland hat der Heimatverein ein kleines Museum eingerichtet. Neben geologischen Fundstücken werden in der Ausstellung heimatkundliche Gegenstände, Trachten und Dokumente aus der Geschichte der ehemals selbstständigen Gemeinde Ostenlands präsentiert. Das Museum kann nur auf vorherige Anfrage besichtigt werden.
Die romanische Gewölbebasilika in Boke stammt vermutlich aus dem 12. Jahrhundert. Sie beherbergt die Reliquien des hl. Landelin von Crespin, dem auch die Kirche geweiht ist. Landelin von Crespin lebte im 7. Jahrhundert und war Klostergründer und Abt im Hennegau. Wahrscheinlich stand zuvor an der Position der heutigen Kirche bereits zuvor ein Vorgängerbau. Im Inneren der Bruchsteinkirche wurden in den 1960er Jahren Fresken freigelegt, die noch aus romanischer Zeit stammen. Zu der Ausstattung gehört ein Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, eine Pietà (um 1430), ein Sandsteinrelief (um 1560), eine Doppelmadonna (um 1700) und die barocke Orgel. Die älteste Glocke wurde im Jahre 1669 gegossen.
Der auch kurz ‚Boker Kanal‘ genannte Wasserlauf ist ein 1853 fertig gestellter künstlicher Bewässerungskanal. Er gilt als wichtiges Kulturdenkmal Ostwestfalen und führt über 32 Kilometer von Schloß Neuhaus durch die Boker Heide bis auf die Höhe von Lippstadt. Dabei verläuft er parallel zur Lippe, die den Kanal auch mit Wasser versorgt. 16 immer noch funktionsfähige Wehre regulieren den Wasserstand des Kanals. Drei Überführungen leiten den Wasserweg über natürliche Flussläufe. Ziel beim Bau des Kanals war, die sandig-karge und trockene Heidelandschaft für die Landwirtschaft zu kultivieren. Die historischen Wasser-Entnahmerechte besitzen auch heute noch ihre Gültigkeit, obwohl der Boker-Heide-Kanal inzwischen fast nur noch der Grundwasserregulierung dient.
Direkt am südlichen Ufer der heutigen Lippe bei Anreppen befand sich einst ein 23 ha großes Römerlager. Es beschrieb die Form eines unregelmäßigen Längsovals und wurde 1968 wiederentdeckt. Eine Holz-Erde-Mauer diente der Befestigung. Zusätzlich wurde das Lager von Gräben gesichert. Man nimmt an, dass es sich bei dem Lager um eine Versorgungsbasis handelte, denn neben dem Kommandohaus, einigen repräsentativen Wohngebäuden, einer Therme und den Mannschaftsunterkünften konnten ungewöhnlich viele Vorratsspeicher nachgewiesen werden.
Vermutlich war das Lager Anreppen nicht sehr lange in Betrieb. Es wurde römischen Quellen zufolge im Jahre 4 n. Chr. erbaut, wobei wohl bereits zuvor an gleicher Stelle eine militärische Anlage bestand. Wahrscheinlich wurde das Lager bereits im Jahre 9 n. Chr. nach der vernichtenden Niederlage der Römer gegen die Germanen in der Varusschlacht wieder aufgegeben. Zwischenzeitlich waren hier rund 6000 Soldaten stationiert.
Ein archäologischer Lehrpfad führt von der Informationshütte aus zu den ehemaligen Bauten des Römerlagers.
Die vermutlich aus fränkisch-sächsischer Zeit stammende mittelalterliche Wallanlage wurde 1867 bei Grabungen wiederentdeckt. Die Fliehburg besaß einen rechteckigen Grundriss von 65 x 90 m und hatte im Westen einen durch einen Graben geschützten Zugang.
Auf einer Fläche von 8 ha werden im privat geführten Tierpark Nadermann in modernen Tiergehegen rund 650 Tiere aus allen Erdteilen präsentiert, darunter verschiedene Raubtierarten, wie Löwen, Jaguare, Geparde und Ozelote, und Kamelarten, wie Dromedare und Trampeltiere. Innerhalb des Zoos stellt ein Kamel-Museum das Leben und die Lebensräume dieser gemütlichen Tiergattung näher vor. Sehr beliebt bei den Kindern ist der Streichelzoo und die verschiedenen Fahrgeschäfte, die den aufregenden Zoobesuch abrunden.
Das Gastliche Dorf besteht aus mehreren Bauernhöfen aus dem 16. und 18. Jahrhundert. Sie wurden an ihren ursprünglichen Standorten abgebaut und hier wieder originalgetreu wiederhergestellt, wo sie gemeinsam mit einem Backhaus und einer Hirtenkapelle ein bemerkenswertes Ensemble darstellen. Das Gelände besitzt einen hübschen Bauerngarten und lädt sowohl zu einem kleinen Rundgang als auch zum Verweilen in einer Kaffeestube oder im Biergarten ein.
Die romanische Gewölbebasilika wurde vermutlich im 12. Jahrhundert als Nachfolgekirche eines älteren Gotteshauses erbaut. Im späten 19. Jahrhundert wurde die Bruchsteinkirche um ein Querhaus und einen Chor mit Apsis erweitert. Bei Renovierungen in den 1960er Jahren entdeckte man im Bereich des Südportals Wand- und Gewölbemalereien, von denen sich allerdings nur Fragmente erhalten hatten. Zu der Ausstattung gehört ein romanischer Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, eine Pietà (um 1430), ein Sandsteinrelief, das Jesu im Grab darstellt (um 1560), eine Doppelmadonna mit Strahlenkranz (um 1700) sowie eine barocke Orgel.
Im südlichen Querhaus werden in einem goldenen Schrein die Reliquien des hl. Landelinius bewahrt.
Radrouten die durch Delbrück führen:
EmsRadweg
Römer-Lippe-Route
LandesGartenSchauRoute
Paderborner Land Route
Lippstadt
as ‚Venedig Westfalens‘ wird von mehreren Lippearmen durchzogen. Kanäle prägen das Bild der Stadt, die 1185 durch Bernhard II., Edelherr zur Lippe, als erste Planstadt Westfalens gegründet wurde. Bereits im selben Jahr bekam Lippstadt durch Kaiser Friedrich Barbarossa die Stadtrechte verliehen. Früh schloss sich die Gründungsstadt der Hanse an und wurde so zu einem bedeutenden und wohlhabenden Fernhandelszentrum. Der Grundriss Lippstadts besteht aus einem gitternetzartigen Aufbau, der sich um einen zentralen rechteckigen Platz im Zentrum erstreckt, der vom 1774 neu errichteten klassizistischen Rathaus dominiert wird. Um den Rathausplatz gruppieren sich unter anderem die mächtige Große Marienkirche aus dem frühen 13. Jahrhundert und das Stadtpalais von 1788, vor dem sich der symbolreiche Bürgerbrunnen befindet. Die Bronzefiguren des Brunnens stehen alle in Verbindung mit der Stadtgeschichte. Am Rathausplatz beginnt die ‚Lange Straße‘. Sie ist die pulsierende Haupteinkaufsstraße Lippstadts und verläuft nach Süden in Richtung des Bahnhofes. Im Stadtkern sind noch zahlreiche Bürger- und Fachwerkhäuser erhalten, obwohl Lippstadt durch mehrere Stadtbrände stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Besonders auffällig sind der ‚Goldene Hahn‘ von 1532 und das Metzgeramtshaus von 1661. Bemerkenswert sind auch die Jakobikirche und die Nicolaikirche, die beide romanischen Ursprungs sind und durch ihre mächtigen weißen Türme beeindrucken. Nicht weit entfernt stehen die Überreste der Kleinen Marienkirche. Die ehemalige Stiftskirche gilt als eine der schönsten Kirchenruinen Deutschlands und als eines der bedeutendsten frühgotischen Baudenkmäler Westfalens.
Mit dem Schloss Overhagen, dem Schloss Herringhausen, und dem Schloss Schwarzenraben stehen drei hübsche barocke Wasserschlossanlagen in den Stadtteilen Lippstadts. Von der Wasserburg Lipperode blieb dagegen nur eine Ruine erhalten. Bad Waldliesborn, ein weiterer Stadtteil, ist heute ein staatlich anerkanntes Mineralheilbad mit Thermalsole und weitläufigem Kurpark.
Sehenswertes:
In einem altehrwürdigen, 1656 erbauten Patrizierhausbaus befindet sich heute das Stadtmuseum. Nach einem größeren Umbau 1770 erhielt das historische Gebäude sein heutiges Aussehen. Besonders sehenswert sind die kunstvollen Stuckarbeiten im Inneren des Anwesens. Die vielfältige Ausstellung des Museums zeigt Funde aus der Vor- und Frühgeschichte, zahlreiche Exponate zur Stadtgeschichte, Beispiele aus der Wohnkultur der letzten Jahrhunderte, Sakrale Kunst und Kunsthandwerk, wissenschaftliche Instrumente, Spielzeuge und eine umfangreiche Fächersammlung.
Lippstadt wurde als Planstadt im späten 12. Jahrhundert gegründet. Inmitten des gitterartigen Straßennetzes wurde ein rechteckiger Platz geschaffen, an dem neben der großen Marienkirche und dem Stadtpalais auch das Rathaus errichtet wurde. Nachdem jedoch das mittelalterliche Ratsgebäude wegen Baufälligkeit abgetragen werden musste, wurde es 1773 durch einen klassizistischen Neubau ersetzt. Das zweistöckige Rathaus besitzt einen übergiebelten Mittelrisalit sowie eine große Freitreppe. Der denkmalgeschützte Bau dominiert auch heute noch den Rathausplatz.
Die Städtische Galerie im Rathaus widmet sich sowohl der zeitgenössischen Kunst als auch der lokalhistorischen Kunst. Jährlich werden dort zwei bis drei wechselnde Ausstellungen präsentiert.
An der nordöstlichen Ecke des Rathausplatzes steht das Stadtpalais. Es entstand 1788 im Stil des Klassizismus und diente zunächst repräsentativen Zwecken des Stadtmagistrats. Heute beherbergt es das Standesamt. Sehenswert sind die aufwendigen Stuckarbeiten im Salon, der heute als Trauzimmer dient.
Vor dem Stadtpalais steht der 1988 von Bonifatius Stirnberg geschaffene Bürgerbrunnen, der mithilfe von Symbolen, Wappen und Figuren mit der Geschichte der Stadt Lippstadt spielt. Zu den dargestellten beweglichen Bronzefiguren gehören Bernhard II., dem Gründer Lippstadts, Friedrich der Große, der die Stadt als Landesherr mehrfach besuchte, Johannes Westermann, der die Reformation nach Lippstadt brachte und Simplizius Simplizissimus, die berühmte Romanfigur aus Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens ‚Der abenteuerliche Simplizius Simplizissimus‘, die gerade auch in Lippstadt ihr berüchtigtes Unwesen trieb.
Nachdem Lippstadt gegen Ende des 12. Jahrhunderts als Planstadt entstanden war, begann man um 1205 am zentralen Platz mit dem Bau der Marienkirche. Das imposante Gotteshaus wurde um 1250 vollendet, wobei der Westturm und der spätgotische Hallenchor erst später ergänzt wurden. Nach der Reformation wurde die Kirche evangelisch. Zu der Innenausstattung gehört ein spätgotisches Sakramentshäuschen von 1256, zwei Wächterfiguren aus der Zeit um 1250 sowie der barocke Hochaltar aus dem 17. Jahrhundert. Im Zwischenchor haben sich einige Wandmalereien erhalten, die ebenfalls noch aus der Zeit der Erbauung stammen.
Die ehemals zu einem Augustinerkloster gehörende Kirche entstand Mitte des 13. Jahrhunderts und gehört zu den bedeutendsten frühgotischen Baudenkmälern Westfalens. Nachdem die Hallenkirche 1831 wegen Baufälligkeit geschlossen wurde, verfügte der damalige König Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1855 die Erhaltung der inzwischen verfallenen Sandstein-Ruine. Der Altar und einige Grabsteine sind auch heute noch zu erkennen.
Die katholische Nicolaikirche ist das älteste Gotteshaus Lippstadts. Sie entstand als romanische Kreuzbasilika im späten 12. Jahrhundert kurz nach der Stadtgründung. 1872 wurde die Kirche abgebrochen, um von einem größeren Kirchenneubau ersetzt zu werden. Der mächtige romanische Westturm mit seiner charakteristischen Rundfensteranordnung blieb dabei erhalten.
Zwischenzeitlich war die Nicolaikirche über mehrere Jahrhunderte evangelisch, da sämtliche Kirchen der Stadt im Zuge der Reformation der protestantischen Gemeinde zufielen. Erst 1802 wurde das Kirchengebäude wieder der katholischen Gemeinschaft überlassen.
Die Jakobikirche entstand um 1300 als frühgotische Hallenkirche. Auffällig sind ihr mächtiger Westturm mit den vielen rundbogigen Fenstern sowie der verhältnismäßig kurze Grundriss. Wie alle anderen Kirchen auch, fiel die Jakobikirche im Zuge der Reformation an die Evangelische Kirche. Seit 2007 dient das Gotteshaus als multifunktionales Veranstaltungszentrum.
Die Wasserburg Lipperode besitzt eine lange und abwechslungsreiche Geschichte. Sie entstand bereits im 13. Jahrhundert als befestigter Wohnturm für die Edelherren zur Lippe, die die Burg aber wohl nie für längere Zeit bewohnt haben. Um das Jahr 1400 herum wurde das gräfliche Anwesen ausgebaut. Dabei entstand unter anderem ein neuer Bergfried. Unter Graf Simon VI. wurde die Burg zwischen 1604 und 1609 zur stolzen Festung nach niederländischem Vorbild ausgebaut – eine Provokation gegen die benachbarten Fürstenhäuser! So wurde bereits 1616 wieder mit der Schleifung der Niederungsburg begonnen. Doch der Abriss zog sich sehr lange hin. Zwischenzeitlich diente die Burg bis 1790 als Verwaltungssitz für die Amtmänner von Lipperode und Cappel. Heute sind von der alten Wehrburg nur noch Reste des Wohnturmes erhalten.
Das hübsche Wasserschloss entstand ab 1619 im Stil der Lipperenaissance, nachdem kurz zuvor die Vorgängerburg aus dem frühen 13. Jahrhundert abgetragen worden war. Der zweigeschossige Schlossbau mit seinen zwei wuchtigen Ecktürmen wurde im 18. Jahrhundert noch einmal barock erweitert. Um das Jahr 1720 entstand auch die Vorburg im barocken Stil. Die Anlage besteht aus einer Haupt- und einer Vorburg, die sich auf zwei verschiedenen Inseln befinden und von einer Wassergräfte umgeben sind. Zuletzt hatte das Anwesen lange ein privates Gymnasium beherbergt.
Südwestlich von Lippstadt liegt der Stadtteil Herringhausen. Das gleichnamige barocke Wasserschloss geht auf ein Rittergut zurück, das an gleicher Stelle bereits im 16. Jahrhundert existierte. Bereits zu dieser Zeit war das Anwesen im Besitz der Herren von Schorlemer und noch immer befindet sich das Schloss im Familienbesitz.
Das heutige zweigeschossige Herrenhaus entstand zwischen 1720 und 1730 und ist streng symmetrisch um eine Mittelachse ausgerichtet. Zu der Anlage gehören ein Torhaus und zwei vorgelagerte Pavillons. Die Wassergräfte, die einst das gesamte Schloss umgab, wurde inzwischen teilweise zugeschüttet.
Das schmucke Wasserschloss bei Bökenförde geht auf das mittelalterliche Gut Wambeke zurück, dass bereits im 11. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wurde. Um 1705 wurde Schloss Schwarzenraben als Neubau im barocken Stil errichtet. Die zweigeschossige Dreiflügelanlage ist auch heute noch im privaten Besitz und wird von einem hübschen Park mit Orangerie umgeben. Die reizvolle Schlosskapelle wurde im Rokokostil ausgestaltet.
Das Kloster Benninghausen wurde 1240 durch den Ritter Johann von Erwitte gestiftet. Der Zisterzienserorden wandelte sich im 17. Jahrhundert zum adligen Damenstift und wurde im Zuge des Reichdeputationsabschlusses im Jahre 1804 aufgehoben. Die ehemalige Klosterkirche entstand 1514 und wurde 1892 noch einmal um ein Querschiff erweitert. Heute dient das Gotteshaus als katholische Pfarrkirche und als Anstaltskirche der Westfälischen Klinik für Psychiatrie. Auch die früheren Abteigebäude werden durch die Klinik genutzt. Zu der wertvollen Ausstattung der Kirche zählen ein Kruzifix aus dem 11. Jahrhundert, das Sakramentshäuschen, der Taufstein und die Kreuzigungsgruppe aus Baumberger Sandstein (alles aus dem 16. Jahrhundert).
Im Mittelalter tagte an der heutigen Grenze von Lipperode, Westenholz und Mastholte ein Freigericht, der so genannte ‚Freystuhl‘. Das Gericht war verantwortlich für Beurkundungen und für Entscheidungen über Ansprüche, die aus einem Hofbesitz resultierten. Ein letztes Zeugnis des ‚freyen Stuhls‘ findet sich im Jahre 1771.
Auf einem Sandhügel markiert heute ein dreieckiger Stein in der Mitte eines steinernen Ringes die Stelle, an der das Gericht einst getagt hatte.
Radrouten die durch Lippstadt führen:
Wadersloh
m Südosten der Beckumer Berge liegt das ländlich geprägte Wadersloh. Die heutige Gemeinde entstand 1975 durch den Zusammenschluss der Dörfer Wadersloh, Liesborn und Diestedde. Die Gründung der Abtei in Liesborn geht bereits auf die Zeit um 800 zurück. Das ehemalige Benediktinerkloster beherbergt heute ein umfangreiches Museum mit einer großen Gemäldesammlung und Europas größter Kreuz- und Kruzifixsammlung, darunter auch künstlerische Arbeiten von Dalí, Chagall und Beuys. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das Wasserschloß Crassenstein im Ortsteil Diestedde. Der privat bewohnte Renaissancebau stammt in seiner jetzigen Form noch aus dem 16. Jahrhundert.
Sehenswertes:
Das ehemals rot und heute dottergelb getünchte Schloss Crassenstein befindet sich im Dorf Diestedde, einem Ortsteil der Gemeinde Wadersloh. Die zweistöckige Dreiflügelanlage mit dem Mansardendach gehört zu den typischen Anlagen des Zwei-Insel-Typs. Eine kleine Allee führt als Achse die Front des Herrenhauses zu. Auf dem Weg zum Hauptportal überquert man zwei Brücken. Jenseits der ersten Brücke befinden sich auf der Vorburg symmetrisch zu beiden Seiten die Wirtschaftsgebäude, jenseits der zweiten erhebt sich das imposante Hauptschloss, flankiert von zwei Pavillons. Das klassizistische Gebäude wurde im 16. Jahrhundert zunächst im Renaissancestil errichtet und erst im 19. Jahrhundert dem damaligen vorherrschenden Architekturgeschmack angepasst. Später kamen im Zuge des Historismus neobarocke Stilelemente hinzu. Spatzierwege führen um das stolze Anwesen herum und bieten so von außen gute Besichtigungsmöglichkeiten.
Geschichtlicher Ablauf
|
1177 |
Erstmalige urkundliche Erwähnung von Crassenstein. Unklar sind bis heute aber der genaue Ort sowie Bauform und Aussehen des Anwesens. |
|
1372 |
Die Bischöfe von Münster und Osnabrück ziehen gegen den auf Crassenstein lebende Burggrafen Johann II. von Stromberg und erobern die Burg. |
|
1378 |
Johann II. von Stromberg wird begnadigt und erhält Crassenstein zurück. Das Anwesen ist Lehensburg des Grafens von Rietberg. |
|
1411 |
Verpfändung der Burg mit der Freigrafschaft an Lubbert I. von Wendt. |
|
1419 |
Endgültiger Verkauf an die Familie derer von Wendt |
|
1570 |
Das Schloss wird im Renaissancestil neu errichtet durch den Baumeister Laurenz von Brachum. Es entstand ein Haupttrakt mit zwei kleinen Seitenflügeln. |
|
1840 |
Umbau und Ausrichtung des Schlosses im klassizistischen Stil durch Konrad Niemann. |
|
1855 |
Die Familie von Ansembourg erwirbt das Wasserschloss und behält es bis zum heutigen Tage. |
|
1922 |
Bei weiteren Umbauarbeiten werden der Schlossanlage neobarocke Elemente hinzugefügt. Dabei entstand wurde dem Gebäude auch das Mansardendach aufgesetzt. |
Das Kloster Lisborn wurde ursprünglich um 815 als Benediktinerinnenkloster gegründet. Im Jahre 1131 verließen die Nonnen den Stift und die Anlage wurde zum Benediktinerkloster umgewandelt. 1270 und 1353 wurden die Klostergebäude durch verheerende Feuer jeweils fast vollständig zerstört und danach wieder neu aufgebaut. Die Abteikirche wurde im 15. Jahrhundert in Form einer gotischen Hallenkirche errichtet. Der vierstöckige romanische Turm mit der patinabesetzten Kupferhaube stammt wohl noch aus der Zeit um 1100. Im 18. Jahrhundert wurden die Klostergebäude noch einmal neu errichtet, doch im Zuge der Säkularisierung hob man das Kloster 1803 auf. Im Jahre 1966 richtete der Kreis Warendorf in den Klosterräumen ein Museum für Kunst und Kulturgeschichte ein. Auf 3000 m² tritt traditionelle Kunst mit moderner Kunst in einen verbindenden Dialog. Die Sammlung umfasst Kunst des Mittelalters, der Renaissance und des Barock genauso wie Gemälde, Graphiken und Plastiken aus dem 19. und 20. Jahrhundert, antike Möbel sowie eine Textilsammlung mit Tüchern aus dem 19. Jahrhundert. Bemerkenswert ist die Sammlung von Kreuzen, Kruzifixen und Kreuzigungsdarstellungen. Sie umfasst ungefähr 500 Exemplare und gilt als die größte ihrer Art in Europa. Die ältesten Exponate entstammen der Romanik, aber es werden auch moderne Objekte gezeigt, darunter Arbeiten von berühmten Künstlern, wie Salvador Dalí, Marc Chagall und Joseph Beuys. Ein Bereich des Museums widmet sich dem bekannten Heimatdichter Augustin Wibbelt (1862 – 1947). Dieser erlangte im Münsterland Beliebtheit durch seine Gedichte in niederdeutscher Sprache. Das Museum zeigt Möbel und Einrichtungsgegenstände des dichtenden Pastors.
Die Margarethenkirche im Zentrum von Wadersloh ist durch ihren 84 m hohen Turm das überragende Bauwerk des Ortes. Sie wurde zwischen 1890 und 1894 durch den Baumeister Rincklake im neugotischen Stil errichtet. Bei der Innenausstattung ist der Taufstein aus dem 15. Jahrhundert besonders sehenswert.
Radrouten die durch Wadersloh führen:
100 Schlösser Route – Ostkurs
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Lippetal
ie Gemeinde Lippetal existiert erst seit der kommunalen Neugliederung 1969. Da wurden elf zuvor selbstständige Dörfer zwischen Hamm und Lippstadt zu einer Gemeinde zusammengefasst. Als die älteste Siedlung gilt Herzfeld. Schon 786 wurde der Wallfahrtsort erstmals urkundlich erwähnt, um 800 wurde hier die erste Steinkirche östlich des Rheins erbaut. Die heutige St.-Ida-Kirche wurde zwar erst 1903 fertig gestellt, aber die neugotische Basilika erhielt den Beinamen ‚Weißer Dom an der Lippe’ und wird jährlich von ungefahr 40.000 Pilgern aufgesucht. Unbedingt sehenswert sind auch das Schloss Hovestadt, ein Wasserschloss aus dem 18. Jahrhundert mit französischem Park sowie Schloss Assen, einem Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert und die St.-Stephanus-Kirche in Oestringhausen mit ihrem kennzeichnenden Zwiebelturm. Im Ortsteil Lippborg gibt es noch einen Bahnhof, an dem allerdings kein regelmäßiger Personenverkehr mehr stattfindet. Aber hier hält noch die Museumsbahn Hamm mit ihrer alten Dampflokomotive.
Sehenswertes:
Das reizvolle Schloss Hovestadt blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Direkt an einer Furt der Lippe gelegen, wurde es im Mittelalter wegen seiner strategisch wichtigen Lage mehrfach in bewaffnete Konflikte verwickelt, zerstört und jeweils wieder aufgebaut. So wurde der alte Rittersitz im Laufe der Zeit immer weiter zur wehrhaften Wasserburg ausgebaut, ehe es im 16. Jahrhundert aus repräsentativen Gründen zum Schloss im Stile der Lipperenaissance umgebaut wurde. Die Vorburg der Zwei-Insel-Anlage wurde schließlich im 18. Jahrhundert vom berühmten westfälischen Baumeister Johann Conrad Schlaun im barocken Stil umgestaltet. Das Wasserschloss war ursprünglich als geschlossene Vierflügelanlage konzipiert worden, aber nur Nord- und Ostflügel sowie der mächtige dreistöckige Pavillonturm wurden verwirklicht. Die Fassade des Hauptschlosses besitzt an der Wasserseite eine umfangreiche Verzierung aus Rauten, Kreisen, Bändern und anderen aus Ziegeln und Sandstein geformten Mustern. Kleine Löwenköpfe schauen aus dem dekorierten Mauerwerk. Der französische Garten entstand Mitte des 18. Jahrhunderts nach Plänen von Clemens August von Vagedes und ist dem Besucher frei zugänglich. Bemerkenswert ist ein kleines Heckentheater, welches direkt an die Innengräfte anschließt.
Geschichtlicher Ablauf
|
1292 |
Erstmalige urkundliche Erwähnung als Rittersitz des Dietrich von Hovestadt. |
|
1303, 1346 |
Wegen der strategischen Lage in der Lippeniederung an einer Furt an der Grenze zu Kur-Köln wurde Burg Hovestadt mehrfach zerstört, jeweils aber wieder aufgebaut. |
|
1483 |
Godert Ketteler übernimmt die Wasserburg und das Amt Hovestadt zunächst als Pfand. Die Burg blieb aber im Familienbesitz. |
|
1563-72 |
Neubau als Renaissanceschloss durch Laurenz von Brachum. Bauherr war Goswin von Ketteler. Vom ursprünglich geplanten Vier-Flügel-Bau wurden aber nur zwei Flügel sowie ein Pavillonturm, verwirklicht. |
|
1649 |
Nachdem die Linie derer von Ketteler augestorben war, übernahmen die Freiherren von Haiden zu Schönrade und Boke das Schloss Hovestadt. |
|
1710 |
Der Freiherr und spätere Graf Friedrich Bernhard Wilhelm von Plettenberg-Lenhausen erwirbt die Anlage. |
|
1733 |
Johann Conrad Schlaun gestaltet auf der Vorburg Torhäuser und Wirtschaftsgebäude im barocken Stil. |
|
1735 |
Um- und Ausbau der Schlossanlage zu der heute noch erhaltenen Form. |
|
18. Jhd. |
Der Barockgarten wird nach französischem Vorbild angelegt. Die Pläne stammen zum Teil von Clemens August von Vagedes. |
Im Ortsteil Lippborg liegt etwas abseits gelegen das Wasserschloss Assen. Die Anlage wurde im Mittelalter zwar zunächst als typische Wasserburg des Zwei-Insel-Typs konzipiert, änderte seine Charakteristik im 15. Jahrhundert zu einer Doppelschlossanlage mit zwei Herrenhäusern, Alt- und Neu-Asseln. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden beide Häuser durch Heirat wiedervereinigt.
Der älteste Teil des Schlosses ist der wuchtige Rundturm auf der Vorburg, dessen Unterbau wohl noch aus dem 14. Jahrhundert stammt. Das Herrenhaus Neu-Asseln stammt von dem bekannten Renaissance-Baumeister Laurenz von Brachum, der das Gebäude im Stil der Lipperenaissance direkt an den Rundturm angliederte.
Das Schloss, das seit dem Ende des 20. Jahrhunderts als katholisches Knaben-Internat dient, wird von hohen Bäumen umgeben und ist daher nur schlecht aus der Ferne einsehbar.
Geschichtlicher Ablauf
|
1023 |
Erstmalige urkundliche Erwähnung, als Kaiser Heinrich II. den Amtshof Honsel dem Kloster Abdinghof in Paderborn schenkte. Zu diesem Amtshof gehörte auch die ‚borch tor Assen’. |
|
1350 |
Urkundliche Erwähnung der Burg, dessen Besitzer zu dieser Zeit Wennemar von Oldendorpe war. |
|
1384 |
Verkauf der Burg als Lehen an Röttger von Ketteler. In den folgenden Jahren wurde das Gut Assen umgebaut. Aus dieser Zeit stammt auch das älteste noch vorhandene Teil des Schlosses, der Unterbau des Rundturmes. |
|
1455 |
Die Wasserburg wird aufgeteilt zwischen den Nachfahren Röttger von Kettelers. Es entstanden Alt-Assen und auf der Vorburg Neu-Assen. In der Folgezeit wird Alt-Assen weitgehend um- und ausgebaut. |
|
1564 |
Neubau von Neu-Asseln. Bauherr war Goswin von Ketteler, Baumeister der bekannte Architekt Laurenz von Brachum. An den mächtigen Rundturm wird ein Schloss im Stil der Lipperenaissance angefügt. |
|
1590 |
Durch Heirat werden beide Häuser wiedervereinigt. |
|
1653 |
Verkauf des Renaissanceschlosses an Heinrich von Galen. |
|
1855-58 |
Bau der Schlosskapelle im neugotischen Stil durch Wilhelm Buchholtz. Die Pläne hierzu lieferte Hilger Hertel, der sich zuvor durch Arbeiten am Kölner Dom einen Namen gemacht hatte. |
|
1910 |
Erneuerung des Rundturmes. |
|
1997 |
Christoph Bernhard Graf von Galen schenkt Haus Assen der Ordensgemeinschaft Diener Jesu und Mariens (SJM). Diese betreibt heute das ‚Kolleg Kardinal von Galen’, ein Internat für Jungen in dem Wasserschloss. |
Im Ortsteil Herzfeld steht die zwischen 1900 und 1903 erbaute neugotische St-Ida-Kirche. Die Basilika mit ihrem spitzen Turm von 88 m ist das höchste Gebäude in Lippetal und bekam den Beinamen ‚Weißer Dom an der Lippe’. Herzfeld gilt als die älteste Siedlung der Gemeinde und ist auch der älteste Wallfahrtsort in der Diösis Münster. 40.000 Pilger ziehen jährlich zum Gotteshaus, um den Schrein der hl. Ida zu besuchen und dort zu beten. Ida war 825 gestorben und in einem Vorgängerbau beigesetzt worden. Die Reliquien mit dem Schrein der Heiligen befinden sich heute in der Grabkrypta. Die Inneneinrichtung weist noch einige weitere Sehenswürdigkeiten auf: den Hochaltar, den Taufbrunnen (1520), der Passionsaltar im südlichen Seitenschiff sowie die Ida-Kapelle.
Die Basilika besaß bereits zwei Vorgängerbauten aus dem 8. und 13. Jahrhundert und wahrscheinlich hat sich hier zuvor bereits auch eine heidnische Kultstätte befunden. Hinter der Szenerie: Die heilige Ida Ida war eine fränkische Grafentochter, verwandt mit Karl dem Großen und vermählt mit Egbert, einem Sachsenherzog. Zusammen mit Herzog Egbert zog Ida durch Westfalen und bekam in einer Vision den Auftrag, am Ufer der Lippe im heutigen Herzfeld eine Kirche zu errichten. Als ihr Gemahl im Jahre 811 starb, wurde er in dieser Kirche begraben. Fortan wohnte Ida in einem über das Grab gebauten Portikus und weihte ihr ganzes Leben anderen Menschen in der Not. Am 4. September 825 wurde auch sie zum Herrn abberufen und in der Kirche beigesetzt. Sofort setzte ein Strom von Menschen ein, der am Grab der Ida betete und diese Wallfahrt hat bis heute nicht aufgehört. Am 26. November 980 wurde Ida heilig gesprochen. Ihre Gebeine ruhen in einem wertvollen Schrein in der Grabkrypta der St. Ida-Kirche.
Die St.-Stephanus-Kirche im Ortsteil Oestringhausen gehört zu den markantesten Gebäuden der Gemeinde Lippetal. Der Sandsteinbau wurde bereits um 1000 im romanischen Stil errichtet und im 13. Jahrhundert zur Kreuzanlage erweitert. Ihre charakteristische Welsche Haube, ein Markenzeichen des Barock, erhielt sie aber erst 1715. Bemerkenswert ist der barocke Hauptaltar aus dem 17. Jahrhundert.
Die weiß verputzte ‚Sändkers Windmühle’, benannt nach den letzten Müllern und Besitzern der Anlage, steht im Ortsteil Heintrop. Erbaut wurde sie 1858 durch den Müller Horstmann als Ersatz für einen Vorgängerbau an anderer Stelle. 1867 wurde die Mühle durch die Familie Sändkers übernommen, die sie bis 1976 betrieb. Zwischenzeitlich erhielt das Mahlwerk einen 20-P.S.-Elektromotor zur Unterstützung an windschwachen Tagen und das Mühlengebäude wurde durch einen dreistöckigen Anbau ergänzt.
Nach einer grundlegenden Renovierung wurde die Windmühle in den 1990er Jahren zum ‚Industriellen Kulturdenkmal’ erklärt und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. 2009 ist auch das Mahlwerk zu Demonstrationszwecken wieder instand gesetzt worden.
Der Förderverein Sändkers Mühle hat sich zum Ziel gesetzt, die Windmühle zu erhalten und auszubauen. Hier finden jetzt regelmäßig Mühlenfeste statt, man kann sich in den Räumlichkeiten trauen lassen und auch Führungen können organisiert werden.
Im Ortsteil Oestinghausen steht das Chur-Köllnische Amtshaus. Das Gebäude ist ein reizendes Fachwerkhäuschen mit verzierter Fassade aus dem 16. Jahrhundert. Das ehemalige Amtshaus gilt als der hübscheste Fachwerkbau in der Gemeinde Lippetal.
Radrouten die durch Lippetal führen:
100 Schlösser Route – Ostkurs
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe Route
Welver
ie Gemeinde Welver liegt in der Soester Börde und bezeichnet sich selber als den ‚schönen Mittelpunkt Westfalens‘. Obwohl bereits 1179 zum ersten Male urkundlich erwähnt, ist der heutige Zentralort ein neugeschichtliches Produkt der 1950er Jahre. Zuvor hatte es mit Meyerich und Welver (Kirchwelver) zwei unabhängige Gemeinden und 19 kleinerer Dörfer gegeben, die lediglich durch einen gemeinsamen Bahnhof miteinander verbunden waren. Die Eisenbahn, die genau zwischen Meyerich und Kirchwelver hindurchführte, bewirkte ein rasches Zusammenwachsen beider Ortschaften zu einer neuen Großgemeinde – der ‚Börde-Metropole‘, wie man hier sagt. Mit dem Bau eines neuen Rathauses und eines Rathausplatzes war ein vollkommen neues Zentrum entstanden. Das Gesicht des Ortes hatte sich in kurzer Zeit vollkommen gewandelt. Trotzdem ist man stolz auf die 800jährige Geschichte! Die Bezeichnung ‚Kirchwelver‘ entstand übrigens erst im 19. Jahrhundert und bezieht sich auf die beiden unmittelbar nebeneinanderstehenden Kirchen. Die ältere Kirche St. Albanus und Cyriakus war gemeinsam von den Nonnen des hier ansässigen Zisterzienserinnenklosters sowie der örtlichen Gemeinde genutzt worden. Doch im Zuge der Reformation wurde Welver protestantisch, das Kloster aber blieb katholisch. Nach einer Zeit der weiteren gemeinsamen Kirchennutzung bauten sich die Nonnen um das Jahr 1700 ihre eigene St. Bernhard-Kirche, die nach der Klosterauflösung zur katholischen Pfarrkirche erhoben wurde. So kam es zu diesem außergewöhnlichen Kirchenensemble. Das ehemaligen Back- und Brauhaus des Klosters beherbergt heute ein Museum mit der größten heimatgeschichtlichen Sammlung der Niederbörde. Auch die umliegenden Dörfer besitzen zum Teil noch sehr alte und sehenswerte Gotteshäuser. Erfahren kann man diese besonders gut mit dem Fahrrad: vier verschiedene Themenrouten mit einer Länge von 10 bis 42 Kilometern führen durch die verschiedenen Ortsteile und damit an allen geschichtsträchtigen Baudenkmälern vorbei.
Sehenswertes:
Es wird vermutet, dass die heute denkmalgeschützte evangelische Pfarrkirche im 12. Jahrhundert durch die Herren von Welver als Eigenkirche erbaut wurde. An gleicher Stelle hatte bereits zuvor eine Kirche gestanden. Als um 1240 in Welver ein Zisterzienserinnenkloster gegründet wurde, diente das romanische Gotteshaus zeitgleich auch als Klosterkirche. Während der Reformationszeit blieb das Kloster katholisch, während sich Welver dem Protestantismus zuwandte. So wurde die Kirche lange Zeit von beiden Konfessionen genutzt, ehe im Jahre 1700 direkt neben der alten Kirche eine neue Klosterkirche entstand. Seitdem ist die Kirche St. Albanus und Cyriakus rein evangelisch.
Der rechteckige Turm wirkt recht gedrungen und wurde Ende des 17. Jahrhunderts erneuert. Das Langhaus wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhundert neu aufgebaut, während das Querhaus bereits um 1200 errichtet worden war.
Zu der Ausstattung gehören ein gemaltes Flügelretabel von 1615, ein Taufstein (um 1200), eine geschnitzte achteckige Taufe von 1636 sowie eine geschnitzte Kanzel aus dem Jahre 1785, die ursprünglich für die Georgskirche in Soest geschaffen worden war.
Nach der Gründung des Zisterzienserinnenklosters um 1240 nutzten die Nonnen die Kirche St. Albanus und Cyriakus gemeinsam mit der Dorfgemeinde auch als Klosterkirche. Im Zuge der Reformation wandte sich die Gemeinde allerdings dem Protestantismus zu, während die Nonnen dem katholischen Glauben treu blieben. So entstand zwischen 1697 und 1707 unmittelbar neben der alten Kirche eine neue Klosterkirche im barocken Stil. Auffällig ist die hohe, geschwungene Haube, die den Westturm bekrönt.
Im Zuge der Säkularisierung wurde das Kloster schließlich im Jahre 1809 aufgelöst und die Kirche gleichzeitig zur Pfarrkirche erhoben. Auch die Inneneinrichtung ist barock geprägt. Der Haupt- und der Nebenaltar stammen genauso wie die Kanzel aus dem Jahre 1714, die Orgel wurde um 1758 aufgebaut. Auch die pokalförmige, achteckige Taufe, das Gemälde mit der Kreuzigung Christi und die Figur des Hl. Bernhard stammen aus dieser Zeit. Die ‚Flämische Madonna‘ stammt dagegen bereits aus dem 16. Jahrhundert, die Glocke gar aus dem 14. Jahrhundert.
Das Back- und Brauhaus wurde 1711 durch die Nonnen des Zisterzienserinnenklosters errichtet. Bis zur Auflösung des Konvents im Jahre 1809 wurde es durch die Klosterfrauen genutzt. 1806 war in den oberen Räumen eine Schule eingerichtet worden, in der noch bis 1965 unterrichtet wurde. Danach dienten die Räume als Jugendheim, während die unteren Stockwerke als Wohnungen vermietet wurden. Seit 1986 beherbergt das historische Gebäude auf 400 m² ein Heimatmuseum, das sich der Geschichte Welvers und der umliegenden Ortschaften widmet. Die Ausstellung gilt als die größte heimatgeschichtliche Sammlung der Niederbörde. Ein Raum wurde als alte Schulklasse wiederhergerichtet, andere Räume widmen sich der Wohnkultur in den letzten Jahrhunderten sowie dem Handwerk und der Landwirtschaft. Bemerkenswert sind die Spinn- und Webstube sowie ein beeindruckendes Diorama, das mit rund 2.500 Zinnsoldaten die Schlacht von Vellinghausen nachstellt.
Die barocke Hallenkirche geht auf einen Vorgängerbau aus dem 12. Jahrhundert zurück. Der gedrungen wirkende Turm entstand als ältester Teil der Kirche sogar schon um 1080 und gilt damit als das älteste sakrale Bauwerk der Soester Börde. Das Gotteshaus wurde in seiner heutigen Form zwischen 1700 und 1712 umgebaut. Dabei haben sich noch im Bereich des westlichen Mittelschiffes spätromanische Fresken erhalten, deren Entstehung auf das Jahr 1220 geschätzt werden. Die Wandmalereien zeigen Lebensbäume, Fabeltiere und ornamentalen Friese. Bemerkenswert ist auch die reich geschnitzte Barockkanzel aus dem Jahre 1733.
Die evangelische Pfarrkirche entstand um 1150 im romanischen Stil. Sie war einst Bestandteil einer wehrhaften Kirchenburg. Reste der alten Burggräfte blieben als Fischteiche im Pfarrgarten noch erhalten. Im 15. Jahrhundert wurde die Urbanuskapelle angebaut. 150 Jahre lang diente die Saalkirche auch als Stiftskirche eines in Schwefe ansässigen Damenstiftes. Bemerkenswert ist das Schnitzretabel aus der Zeit um 1525. Daneben gehören zu der Ausstattung eine kelchförmige Taufe von 1682, die reich verzierte hölzerne Kanzel von 1709, das eichene Kirchengestühl von 1696 sowie das hölzerne Orgelprospekt von 1716.
Die evangelische Pfarrkirche existierte nachweislich bereits im Jahre 1221. Im Laufe ihrer Geschichte wurde das ursprünglich romanische Gotteshaus aber immer wieder in größeren Teilen neu errichtet, so dass ein genaues Baujahr kaum zu bestimmen ist. So stammt das heutige Kirchenschiff von 1742, der Chor von 1699 und der Backsteinturm von 1901. Dennoch wirkt das weiß verputzte Kirchengebäude äußerlich recht homogen.
Auch die Inneneinrichtung ist aus Gegenständen verschiedenster Epochen zusammengestellt. Während das Sakramentshäuschen und die Othmar-Nische noch aus der Zeit der Gotik sind, wurden Kanzel, Altaraufbau, Taufbecken und Orgelprospekt erst Mitte des 18. Jahrhunderts gefertigt. Beachtenswert sind die verschiedenen Epitaphe aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert. Die zwei gusseisernen Altarleuchter wurden von König Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1828 gestiftet.
Die hübsche kleine Fachwerkkirche entstand im Jahre 1722 und misst gerade eben eine Länge von 13 Metern und eine Breite von 6 Metern. Vermutlich stand an gleicher Stelle schon zuvor eine Vorgängerkirche. Nachweisen konnte man das allerdings bislang noch nicht. Die hölzerne sechseckige Kanzel wurde 1695 gefertigt, das Altarretabel mit der Darstellung des Letzten Abendmahls entstand im 17. Jahrhundert, die Kapellenglocke sogar schon im 16. Jahrhundert.
Der Adelssitz geht auf eine Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert zurück. Das heute noch immer im Privatbesitz befindliche zweistöckige Herrenhaus entstand wohl Ende des 16. Jahrhunderts und wirkt mit seinem Walmdach relativ schlicht. Auch die Gräfte wurde inzwischen fast vollständig zugeschüttet. Die Wirtschaftsgebäude und das Torhaus wurden in den 1990er Jahren im Fachwerkstil restauriert.
Ahlen
ie ehemalige Hansestadt Ahlen ist die größte und wirtschaftlich bedeutendste Stadt im Kreis Warendorf. Erstmals um 850 erwähnt, erhielt sie im 13. Jahrhundert zum Schutz eine Stadtmauer mit fünf Stadttoren. Die letzten Spuren der Stadtbefestigung wurden allerdings im letzten Jahrhundert entfernt. Die Stadt an der Werse besitzt einen historisch gewachsenen Stadtkern, welcher von den beiden katholischen Pfarrkirchen St. Bartholomäus und St. Marien überragt wird. Mit der Stadt-Galerie. Dem Kunstmuseum und dem Fritz-Winter-Haus gibt es für Kunstinteressierte gleich drei Anlaufpunkte, weitere Sehenswürd igkeiten sind die verschiedenen Mühlen der Stadt, das Museum im Goldschmiedehaus und die Wasserburg Haus Vorhelm, wo ein Besuch zur Baumblüte besonders empfehlenswert ist. Die Nähe zum Ruhrgebiet wird durch die ehemalige Zeche Westfahlen spürbar. Wo früher Kohle gefördert wurde, entstehen heute in denkmalsgeschützten Anlagen neue Nutzungsräume für verschiedene Projekte und Firmen.
Sehenswertes:
 Haus Vorhelm, nördlich von Ahlen im gleichnamigen Ortsteil gelegen, ist eine typische Zwei-Insel-Anlage mit Vor- und Hauptburg. Vor der der Vorburg befindet sich eine ehemalige Wassermühle, die auch privat bewohnt wird. Der Hellbach, aus dessen Wasser die Gräften von Haus Vorhelm gespeist werden, wird an dieser Stelle zwar noch gestaut, aber ein Mühlenrad existiert nicht mehr. Das ausgeprägte Gräftensystem besitzt hinter der Hauptburg noch mehrere lang gestreckte Inseln. An der Gräfte ermöglicht ein kleiner angelegter Weg einen guten Blickkontakt zum Schloss, die Anlage selber darf nicht betreten werden, da sie privat bewohnt wird. So kann man den barocken Garten auf der Vorburg mit den dafür typischen Steinskulpturen nur von außerhalb des Grabens betrachten. Besonders reizvoll wirkt Haus Vorhelm im Frühjahr, wenn die rosafarbenen Baumblüten ein prächtiges Farbenspiel liefern.
Haus Vorhelm, nördlich von Ahlen im gleichnamigen Ortsteil gelegen, ist eine typische Zwei-Insel-Anlage mit Vor- und Hauptburg. Vor der der Vorburg befindet sich eine ehemalige Wassermühle, die auch privat bewohnt wird. Der Hellbach, aus dessen Wasser die Gräften von Haus Vorhelm gespeist werden, wird an dieser Stelle zwar noch gestaut, aber ein Mühlenrad existiert nicht mehr. Das ausgeprägte Gräftensystem besitzt hinter der Hauptburg noch mehrere lang gestreckte Inseln. An der Gräfte ermöglicht ein kleiner angelegter Weg einen guten Blickkontakt zum Schloss, die Anlage selber darf nicht betreten werden, da sie privat bewohnt wird. So kann man den barocken Garten auf der Vorburg mit den dafür typischen Steinskulpturen nur von außerhalb des Grabens betrachten. Besonders reizvoll wirkt Haus Vorhelm im Frühjahr, wenn die rosafarbenen Baumblüten ein prächtiges Farbenspiel liefern.
17. Jhd. Bau des Hauptflügels mit dem Herrenhauses. 1874
Geschichtlicher Ablauf
um 1600
Entstehung des Seitenflügels mit dem Dreistaffelgiebel.
Neubau der Mühle
Das Haus Vorhelm ist heute im Besitz des Grafen Droste zu Vischering.
Nachdem Karl der Große die Sachsen besiegt hatte, entstand um 800 in Ahlen die St.-Bartholomäus-Kirche als eine der ersten Urpfarren in Westfalen. Zwischen 1139 und 1803 gehörte St. Bartholomäus zum Prämonstratenserkloster Cappenberg. Die heutige Kirche wurde wahrscheinlich im 15. und 16. Jahrhundert in mehreren Bauabschnitten im gotischen Stil errichtet. Der Westturm entstand erst später und musste zweimal, nach 1744 und von 1815 bis 1819, wieder aufgebaut werden, da er zuvor in Folge eines Blitzschlages bzw. wegen Baufälligkeit eingestürzt war. Die Inneneinrichtung zeichnet sich durch das spätgotische Chorgestühl aus dem 15. Jahrhundert sowie durch das Sakramentshaus aus Baumberger Sandstein (1512) aus.
Die katholische Pfarrkirche St. Marien wurde zwar bereits um 1285 gegründet, der heutige stolze Bau wurde allerdings erst als Nachfolgebau zwischen 1902 und 1904 errichtet. Bei dem neugotischen Hallenbau wurde an der Südseite ein frühgotisches Portal des Vorgängerbaus wieder verwendet. Aus dieser wurden auch der Taufstein und die Strahlenmadonna aus dem 16. Jahrhundert übernommen.
In der Stadt-Galerie finden wechselnde Ausstellungen des KunstVereins statt. Sie behandeln überwiegend zeitgenössische Themen. Der KunstVerein betreibt hier auch sein Büro.
Das durch private Initiative des 2005 verstorbenen Ahlener Unternehmers Theodor F. Leifeld entstandene Kunstmuseum befindet sich am Ort des ehemaligen Westtores in einer gründerzeitlichen Villa. Das denkmalgeschützte Kleinod wurde gründlich renoviert und restauriert und im Jahre 1993 als Museum eröffnet. Jährlich werden fünf Wechselausstellungen gezeigt, die sich Themen der Klassischen Moderne sowie der zeitgenössischen Kunst widmen.
 Fritz Winter gehört zu den bedeutendsten deutschen Malern der Nachkriegszeit. Er wurde 1905 in Altenbögge bei Unna geboren und wuchs in Ahlen auf. Zunächst arbeitete Fritz Winter, wie schon sein Vater auch, im Bergbau, doch 1924 wandte er sich der Malerei zu. Winter war von 1927 bis 1930 Schüler am Bauhaus in Dessau, seine Lehrer waren dort unter anderem Josef Albers, Wassily Kandinsky und Paul Klee. Seine abstrakten, linearen Bildkompositionen trafen bei den Nationalsozialisten auf wenig Gegenliebe. Sie beschlagnahmten seine Werke und belegten ihn 1937 mit Malverbot. Nach dem Krieg war er Mitbegründer der Künstlergruppe ‚ZEN 49’ in München. Sein Haus wird zu einem Treffpunkt der aktuellen Kunstszene. Fritz Winter ließ in seinen Werken die Flächen, Linien und Farben so miteinander in den Dialog treten, dass seine Kompositionen und Gestaltungsformen beim Betrachter erstaunlich tiefe Räume erzeugen. In seinem Elternhaus wurde 1975 das ‚Fritz-Winter-Haus’ als Museum und Galerie für moderne Kunst eröffnet. Winter, der 1976 in Herrsching am Ammersee starb, hatte selbst noch diese Einrichtung ins Leben gerufen. Das Haus widmet sich seit dem der ungegenständlichen Kunst, dem Informel und der gestischen Malerei. Neben den Werken Fritz Winters werden in Wechselausstellungen auch Arbeiten anderer Künstler gezeigt, die die abstrakte Malweise in diesem Sinne verfolgten.
Fritz Winter gehört zu den bedeutendsten deutschen Malern der Nachkriegszeit. Er wurde 1905 in Altenbögge bei Unna geboren und wuchs in Ahlen auf. Zunächst arbeitete Fritz Winter, wie schon sein Vater auch, im Bergbau, doch 1924 wandte er sich der Malerei zu. Winter war von 1927 bis 1930 Schüler am Bauhaus in Dessau, seine Lehrer waren dort unter anderem Josef Albers, Wassily Kandinsky und Paul Klee. Seine abstrakten, linearen Bildkompositionen trafen bei den Nationalsozialisten auf wenig Gegenliebe. Sie beschlagnahmten seine Werke und belegten ihn 1937 mit Malverbot. Nach dem Krieg war er Mitbegründer der Künstlergruppe ‚ZEN 49’ in München. Sein Haus wird zu einem Treffpunkt der aktuellen Kunstszene. Fritz Winter ließ in seinen Werken die Flächen, Linien und Farben so miteinander in den Dialog treten, dass seine Kompositionen und Gestaltungsformen beim Betrachter erstaunlich tiefe Räume erzeugen. In seinem Elternhaus wurde 1975 das ‚Fritz-Winter-Haus’ als Museum und Galerie für moderne Kunst eröffnet. Winter, der 1976 in Herrsching am Ammersee starb, hatte selbst noch diese Einrichtung ins Leben gerufen. Das Haus widmet sich seit dem der ungegenständlichen Kunst, dem Informel und der gestischen Malerei. Neben den Werken Fritz Winters werden in Wechselausstellungen auch Arbeiten anderer Künstler gezeigt, die die abstrakte Malweise in diesem Sinne verfolgten.
Das Ahlener Heimatmuseum befindet sich im Peter’schen Hof, einem typischen münsterländischen Ackerbürgerhaus aus dem 17. Jahrhundert. Der Besucher erfährt nicht nur viel über den Alltag und die Arbeit der Bürger in der damaligen Zeit, er kann mittels Spinnrad auch einen eigenen Faden aus Flachs herstellen. Die Stadtentwicklung Ahlens von der Frühgeschichte bis zur modernen Mittelstadt ist ein weiterer Themenschwerpunkt des Museums, wobei insbesondere auf den Bergbau eingegangen wird, der die Stadt lange Zeit als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor geprägt hat.
 Die ehemals zum Rittergut Haus Seppenhagen gehörende Verings Mühle wurde im späten 17. Jahrhundert errichtet. Die Korn- und Ölmühle nutzte das Wasser der Werse als Antrieb. Der urige Fachwerkbau wurde Anfang des 20. Jahrhunderts noch einmal vergrößert und mit einer Turbine effizienter gestaltet, aber in den 60er Jahren wurde der Betrieb der Wassermühle dann doch eingestellt, Wasserrad und Turbine sind nicht mehr vorhanden.
Die ehemals zum Rittergut Haus Seppenhagen gehörende Verings Mühle wurde im späten 17. Jahrhundert errichtet. Die Korn- und Ölmühle nutzte das Wasser der Werse als Antrieb. Der urige Fachwerkbau wurde Anfang des 20. Jahrhunderts noch einmal vergrößert und mit einer Turbine effizienter gestaltet, aber in den 60er Jahren wurde der Betrieb der Wassermühle dann doch eingestellt, Wasserrad und Turbine sind nicht mehr vorhanden.
Von der ehemaligen Windmühle Münstermann ist nur noch der ungefähr 20 m hohe Rumpf erhalten. Die Mühle vom Typ Galerieholländer wurde 1848 errichtet. Im Jahre 1910 erhielt die Anlage einen Sauggasmotor, um auch bei schwachwindigen Wetterlagen produzieren zu können. Während die Windflügel inzwischen lange abmontiert wurden, erhielt das Gebäude mehrfach neue Anbauten und dient auch heute noch dem Mahlen von Getreide.
Im Ortsteil Vorhelm, nordöstlich der Stadt Ahlen gelegen, befindet sich noch ein Windmühlenturm vom Typ eines Holländers. Der wuchtige Stumpf wurde 1830 erbaut, brannte aber im Jahre 1907 aus. Danach erhielt die Mühle einen Sauggasmotor für die Erzeugung von Strom, die Windmühlenflügel wurden nicht mehr erneuert. Der Betrieb wurde 1935 eingestellt. Heute dient der Windmühlenturm als Sitz des Heimatvereins Vorhelm und ist nach Voranmeldung auch zu besichtigen.
Das Museum im Goldschmiedehaus geht auf eine Sammlung des Goldschmiedemeisters Werner Fischer zurück. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen betreibt seit 1984 das Museum und präsentiert hier in vier Bereichen eine Sammlung sakraler Goldschmiedekunst aus dem Mittelalter bis zur Neuzeit, die Geschichte der Zeitmesstechnik von 1585 bis heute, die Ausstellung ‚Jüdisches Kultgerät – Jüdisches Leben’ mit diversen Leihgaben Jüdischer Museen sowie ‚Schätze des Buddhismus’ mit Skulpturen, Andachts- und Ritualgegenständen aus dem fernöstlichen Leben.
 Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Ahlen auf der Zeche Westfalen Steinkohle gefördert, in den Jahren 1918 bis 1924 entstand die angrenzende Zechensiedlung. Bis zu 5.500 Arbeiter fanden hier eine Anstellung, damit war die Zeche Westfalen der größte Arbeitgeber der Stadt. Nach fast 100 Jahren jedoch wurde der Betrieb im Jahre 2000 endgültig eingestellt. Seit 2006 wurde in den ehemaligen Zechengebäuden das Gewerbegebiet Zeche Westfalen in Betrieb genommen. Seitdem hat sich auf dem Zechengelände ein buntes Sammelsurium von Nutzungsträgern zusammengefunden. Heute befinden sich hier zwischen alten Förderbändern und Hallen Fachschulen, Softwarefirmenbüros, eine Indoor-Kletterwand und ein Auto-Tuner. Es werden Konzerte und Messen veranstaltet und so bekommt das alte Zechengelände ein ganz neues Flair, zumal es heute frei betreten bzw. befahren werden kann. Die alten Fördertürme Schacht I und Schacht II sind die Wahrzeichen des neuen Gewerbegebietes. Während einige Hallen der Zeche zurückgebaut wurden, kümmert sich der ‚Förderverein Fördertürme’ um den Erhalt der Türme als Denkmal.
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Ahlen auf der Zeche Westfalen Steinkohle gefördert, in den Jahren 1918 bis 1924 entstand die angrenzende Zechensiedlung. Bis zu 5.500 Arbeiter fanden hier eine Anstellung, damit war die Zeche Westfalen der größte Arbeitgeber der Stadt. Nach fast 100 Jahren jedoch wurde der Betrieb im Jahre 2000 endgültig eingestellt. Seit 2006 wurde in den ehemaligen Zechengebäuden das Gewerbegebiet Zeche Westfalen in Betrieb genommen. Seitdem hat sich auf dem Zechengelände ein buntes Sammelsurium von Nutzungsträgern zusammengefunden. Heute befinden sich hier zwischen alten Förderbändern und Hallen Fachschulen, Softwarefirmenbüros, eine Indoor-Kletterwand und ein Auto-Tuner. Es werden Konzerte und Messen veranstaltet und so bekommt das alte Zechengelände ein ganz neues Flair, zumal es heute frei betreten bzw. befahren werden kann. Die alten Fördertürme Schacht I und Schacht II sind die Wahrzeichen des neuen Gewerbegebietes. Während einige Hallen der Zeche zurückgebaut wurden, kümmert sich der ‚Förderverein Fördertürme’ um den Erhalt der Türme als Denkmal.
Radrouten die durch Ahlen führen:
Werse Radweg
100 Schlösser Route – Ostkurs
Römer-Lippe Route
Hamm
ie heutige Großstadt Hamm am nordöstlichen Rand des Ruhrgebietes wurde 1226 als Planstadt vom Grafen von der Mark gegründet und mit Stadtrechten versehen. Die Pauluskirche im Zentrum der Stadt ist Hamms ältestes Wahrzeichen. Von 1882 bis 1955 war Hamm Badekurort und durfte sich bis 1955 ‚Bad Hamm’ nennen. Der Kurpark mit seinem historischen Kurhaus zeugt noch von dieser Zeit. Der Park mit seinem alten Baumbestand und seinen bezaubernden Seen wird als Naherholungsgebiet von den Hammer Bürgern viel genutzt und erhielt im Jahre 2009 ein neues Gradierwerk. Hamm liegt an der Lippe und dem parallel dazu verlaufenden Datteln-Hamm-Kanal, der vom Dortmund-Ems-Kanal abzweigt und im Stadtteil Uentrop endet. Der am Kanal liegende Stadthafen ist der zweitgrößte öffentliche Kanalhafen Deutschlands. Am ehemaligen Grenzfluss Lippe befinden sich noch eine Reihe alter und sehenswerter Wasserschlösser. Der Kern des neugotisch umgebauten Schloss Heesen stammt aus noch dem 16. Jahrhundert, das im 17. Jahrhundert von Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg erbaute Schloss Oberwerries dient heute der Stadt Hamm für repräsentative Empfänge. Der aufgeschüttete Erdhügel der nur noch als Bodendenkmal erhaltenen Wasserburg Mark ist die größte und besterhaltende Motte Westfalens. Geprägt wurde die Wirtschaft Hamms lange Zeit durch den Bergbau. Das ehemalige Bergwerk Heinrich Robert, zuletzt Teil des Bergwerk Ost, schloss als letzte Zeche am 30. September 2010 und beendete damit eine Ära. Von seiner Abräumhalde, der Kissinger Höhe, hat man bei klarem Wetter einen wunderbaren Blick über die Stadt und die weitere Umgebung. Bereits vorher hatten die Zechen Radbod mit seinen drei charakteristischen Fördertürmen, Sachsen und Maximilian geschlossen. Im Jahre 1984 fand im Hamm auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Maximilian die Landesgartenschau statt. Der Mittelpunkt des Landschaftsparks ist der begehbare 40 Meter hohe ‘Gläserner Elefant’ von Horst Röllecke. Die ‚Maxi’ genannte Skulptur wurde zum Maskottchen der Stadt Hamm. Überall im Stadtgebiet finden sich heute Elefanten in verschiedenen Formen, Farben und Größen. Sehenswert sind darüber hinaus der hinduistische Sri Kamadchi Ampal Tempel in Uentrop sowie der neugotische Hauptbahnhof, der als einer der Schönsten in Deutschland gilt.
Sehenswertes:
 Die evangelische Pauluskirche ist das bedeutendste Gotteshaus und Wahrzeichen der Stadt Hamm. Wann genau der gotische Bau errichtet wurde, ist nicht bekannt. Ihre Ursprünge liegen vermutlich im 12. Jahrhundert. Wesentliche Anbauten, wie das Querhaus und der Chor, entstammen dem 13. Jahrhundert, der Turm und das Langhaus dem 14. Jahrhundert. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Kirche schwer beschädigt. Beim Wiederaufbau erhielt der knapp 80 m hohe Turm seine pyramidenförmige Haube. Die Pauluskirche war zunächst eine katholische Pfarrkirche und ursprünglich den Heiligen Georg und Laurentius geweiht. Im 16. Jahrhundert fiel das Gotteshaus an die Protestanten, die den Kircheninnenraum von jeglichem Schmuck befreiten. Den Namen des Apostels Paulus erhielt die Kirche erst 1912.
Die evangelische Pauluskirche ist das bedeutendste Gotteshaus und Wahrzeichen der Stadt Hamm. Wann genau der gotische Bau errichtet wurde, ist nicht bekannt. Ihre Ursprünge liegen vermutlich im 12. Jahrhundert. Wesentliche Anbauten, wie das Querhaus und der Chor, entstammen dem 13. Jahrhundert, der Turm und das Langhaus dem 14. Jahrhundert. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Kirche schwer beschädigt. Beim Wiederaufbau erhielt der knapp 80 m hohe Turm seine pyramidenförmige Haube. Die Pauluskirche war zunächst eine katholische Pfarrkirche und ursprünglich den Heiligen Georg und Laurentius geweiht. Im 16. Jahrhundert fiel das Gotteshaus an die Protestanten, die den Kircheninnenraum von jeglichem Schmuck befreiten. Den Namen des Apostels Paulus erhielt die Kirche erst 1912.
 Die barocke Martin-Luther-Kirche wurde zwischen 1734 und 1739 erbaut. Man nannte die ehemalige preußische Garnisonskirche lange Zeit auch ‘Kleine Evangelische Kirche’, bis im Jahre 1912 der jetzige Name eingeführt wurde. Ein ganzer Stadtteil in der Innenstadt wurde nach der Kirche benannt.
Die barocke Martin-Luther-Kirche wurde zwischen 1734 und 1739 erbaut. Man nannte die ehemalige preußische Garnisonskirche lange Zeit auch ‘Kleine Evangelische Kirche’, bis im Jahre 1912 der jetzige Name eingeführt wurde. Ein ganzer Stadtteil in der Innenstadt wurde nach der Kirche benannt.
Die Kirche St. Agnes ist das einzige katholische Gotteshaus in der Hammer Innenstadt. Ursprünglich wurde sie als Klosterkirche des Franiskaner-Observaten-Ordens in den Jahren 1507 bis 1515 als Nachfolgebau für deine Vorgängerkirche aus dem 15. Jahrhundert errichtet.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die St.-Agnes-Kirche schwer in Mitleidenschaft gezogen, so dass nur die östlichen Außenmauern vom ursprünglichen Zustand erhalten sind.
In der Dorfschaft Mark steht die älteste Kirche Hamms. Sie wurde im 11. Jahrhundert wohl im romanischen Stil errichtet und war lange Zeit die Hauptkirche der Stadt. Der Sandsteinbau ist heute weiß verputzt. Das niedrige Langhaus wird vom Querschiff und dem Chor überragt. Der zweistöckige Turm wurde 1735 um ein Glockengeschoss erhöht. Vielen gilt die evangelische Kirche als das schönste Gotteshaus der Stadt.
Anfang des letzten Jahrhunderts fand man im Bereich des Chores Fresken, die aus dem 14. Jahrhundert stammen und in dieser Form einzigartig in ganz Westfalen sind. Beachtenswert ist der im 13. Jahrhundert entstanden Taufstein aus Baumberger Sandstein.
 Das Eisenbahnmuseum ist als Freilichtmuseum ein Teil des Maximilianparks. Die hier aufgebaute Gleisanlage entspricht der Darstellung eines Personen- und Güterverkehrsbahnhof der 50er Jahre. Im Lokschuppen sind die verschiedenen Lokomotiven, Güterwaggons und Personenwagen zu bestaunen. Zum Eisenbahnmuseum gehört auch eine funktionsfähige Eisenbahnstrecke. Auf der Route von Welver-Ramesohl nach Lippborg-Heintrop kann man die Museumseisenbahn für Ausflugsfahrten mieten. Zwei Dampf- und drei Dieselloks, allesamt über fünfzig Jahre alt, ziehen die historischen Waggons.
Das Eisenbahnmuseum ist als Freilichtmuseum ein Teil des Maximilianparks. Die hier aufgebaute Gleisanlage entspricht der Darstellung eines Personen- und Güterverkehrsbahnhof der 50er Jahre. Im Lokschuppen sind die verschiedenen Lokomotiven, Güterwaggons und Personenwagen zu bestaunen. Zum Eisenbahnmuseum gehört auch eine funktionsfähige Eisenbahnstrecke. Auf der Route von Welver-Ramesohl nach Lippborg-Heintrop kann man die Museumseisenbahn für Ausflugsfahrten mieten. Zwei Dampf- und drei Dieselloks, allesamt über fünfzig Jahre alt, ziehen die historischen Waggons.
Im Jahre 1984 fand im Hamm auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Maximilian die Landesgartenschau statt. Auf dem weiträumigen 14.000m² großen Haldengelände entstand eine reizvolle Parklandschaft mit Blumenrabatten und -beeten. Origineller Mittelpunkt ist der 40m hoch ‘Gläserner Elefant’. Ihr Schöpfer Horst Röllecke hat seine Skulptur als begehbaren Erlebnisraum gestaltet. Besonders beeindruckend ist die bunte Vielfalt von Schmetterlingen und Faltern, die der Besucher im größten tropischen Schmetterlingshaus Nordrhein-Westfalens entdecken kann. Von einer 35m hohen Aussichtsplattform kann sich der Gast einen weiten Überblick über die vielfältig gestaltete Anlage verschaffen. Auf der Freilichtbühne finden in den Sommermonaten die unterschiedlichsten kulturellen Darbietungen statt, von Konzerten über Theateraufführungen bis hin zu Kleinkunstveranstaltungen.
 Nördlich von Hamm nahm im Jahre 1905 die Zeche Radbod ihren Betrieb auf. Die Schächte reichen in eine Teufe von ungefähr 850m. 1989 wurde mit über 1,3 Mio Tonnen Steinkohle die höchste Jahresmenge gefördert. Ein Jahr später war Schicht im Schacht und die Zeche wurde geschlossen. Zu einem folgenschweren Zwischenfall kam es gleich zu Beginn im Jahre 1908, als bei einer Schlagwetterexplosion 348 Kumpel ums Leben kamen. Heute erinnern nur noch drei hintereinander hoch aufragende Fördertürme an die alte Zechenzeit. Sie sind zu Wahrzeichen des Stadtteils Bockum-Hövel geworden.
Nördlich von Hamm nahm im Jahre 1905 die Zeche Radbod ihren Betrieb auf. Die Schächte reichen in eine Teufe von ungefähr 850m. 1989 wurde mit über 1,3 Mio Tonnen Steinkohle die höchste Jahresmenge gefördert. Ein Jahr später war Schicht im Schacht und die Zeche wurde geschlossen. Zu einem folgenschweren Zwischenfall kam es gleich zu Beginn im Jahre 1908, als bei einer Schlagwetterexplosion 348 Kumpel ums Leben kamen. Heute erinnern nur noch drei hintereinander hoch aufragende Fördertürme an die alte Zechenzeit. Sie sind zu Wahrzeichen des Stadtteils Bockum-Hövel geworden.
 1912 eröffnet, hatte die Zeche Sachsen eine wechselvolle Geschichte, in deren Verlauf viele Bergleute ihr Leben unter Tage verloren. Der Name ‘Sachsen’ geht auf die Bergbaugewerkschaft zurück, die damals ihre Zentrale im sächsischen Eisleben hatte. Die Schächte, in denen die begehrte ‚Fettkohle’ gefördert wurde, reichten über 1000m tief. Noch im Jahre 1962 wurden über 1,2 Mio Tonnen Steinkohle zu Tage gefördert. Zu diesem Zeitpunkt waren über 3200 Kumpel beschäftigt. Die Zeche gab 1976 ihren Betrieb auf, heute erinnert noch das klassizistische Maschinenhaus von 1912 an die Förderzeit. Der opulente Bau erhielt den Namen ‘Alfred-Fischer-Halle’ und dient heute als Veranstaltungszentrum. Nordwestlich der ehemaligen Zeche liegt die Kolonie Vogelsang. Sie gilt als eine typische geschlossene Bergarbeitersiedlung der 20er Jahre.
1912 eröffnet, hatte die Zeche Sachsen eine wechselvolle Geschichte, in deren Verlauf viele Bergleute ihr Leben unter Tage verloren. Der Name ‘Sachsen’ geht auf die Bergbaugewerkschaft zurück, die damals ihre Zentrale im sächsischen Eisleben hatte. Die Schächte, in denen die begehrte ‚Fettkohle’ gefördert wurde, reichten über 1000m tief. Noch im Jahre 1962 wurden über 1,2 Mio Tonnen Steinkohle zu Tage gefördert. Zu diesem Zeitpunkt waren über 3200 Kumpel beschäftigt. Die Zeche gab 1976 ihren Betrieb auf, heute erinnert noch das klassizistische Maschinenhaus von 1912 an die Förderzeit. Der opulente Bau erhielt den Namen ‘Alfred-Fischer-Halle’ und dient heute als Veranstaltungszentrum. Nordwestlich der ehemaligen Zeche liegt die Kolonie Vogelsang. Sie gilt als eine typische geschlossene Bergarbeitersiedlung der 20er Jahre.
Ursprünglich wurde das Gustav-Lübcke-Museum als Heimatmuseum bereits im 19. Jahrhundert eröffnet. 1917 stiftete Gustav Lübcke seine kunsthandwerkliche Sammlung der Stadt Hamm. Sie umfasste Gegenstände vom Mittelalter bis zur damaligen Gegenwart. Heute zeigt das Museum eine umfangreiche eigene Sammlung der Klassischen Moderne und der zeitgenössischer Kunst. Darüber hinaus betreibt das Museum eine der größten ägyptischen Sammlungen Deutschlands. Zu bestaunen gibt es eine Vielzahl von Mumien und archäologischen Ausgrabungsfunden. 1993 zog das Gustav-Lübcke-Museum in seine neues Domizil, einem modernen Museumsbau in der Neuen Bahnhofstraße um.
Das Kulturbüro organisiert in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Hamm e.V. im Stadthaus Wechselausstellungen mit Werken einheimischer Künstler sowie Arbeiten von darstellenden Künstlern der Partnerstädte.
Im Jahre 1933 entstand auf dem Gelände des ehemaligen Südenstadtparks der Tierpark Hamm. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Zoo leider zerstört, 1950 aber wieder neu aufgebaut. Heute leben in den Tiergehegen Löwen, Tiger und Leoparden, Kamele, Kängurus und Nasenbären, Papageien und Uhus. Im Reptilienhaus kann man Schlangen wie eine Python und eine Boa Constrictor bewundern, aber auch Wasserschildkröten beim Schwimmen beobachten. Der Tierpark besitzt einen Streichelzoo und vielfältige Spielmöglichkeiten für Kinder, wie Karussells, eine Eisenbahn und einen Autoscooter. Im angegliederten Naturkundemuseum zeigt eine Dauerausstellung Präparate der heimischen Tierwelt, die eine umfangreiche Käfer- und Schmetterlingssammlung beinhaltet. Ziel ist es, in der Zukunft einmal ein komplettes Bild der Heimattierwelt präsentieren zu können.
1198 1595 Nach einer Beschreibung bestand die Anlage zu diesem Zeitpunkt aus einer zweistöckigen Ringmantelburg auf einer Motte mit Vorburg. Beide Burgteile waren durch eine Wassergräfte umschlossen. 18. Jhd. 1990 In einem Parkgelände unweit der Ahse befindet sich die größte und besterhaltende Motte Westfalens. Eine Motte ist ein zur Verteidigung aufgeschütteter Erdhügel, auf dem eine Burganlage errichtet wurde. Die Oberburg von Burg Mark wurde auf einer sieben Meter hohen Motte errichtet. Eine Gräfte umfloss sowohl die Oberburg als auch die Vorburg, auf der sich die Wirtschaftsgebäude befanden. Die Gesamtlänge der Anlage betrug 200 Meter und war damit für die damalige Zeit ungewöhnlich groß. Burg Mark war eine so genannte Ringmantelburg mit zwei Türmen. Die Außenmauer umschloss kreisförmig den Innenhof und bot so zusammen mit dem Hügel und den Wassergräben einen wirkungsvollen Schutz gegen Angreifer. Von der ehemaligen, gegen Ende des 12. Jahrhunderts errichteten Burganlage Mark ist heute noch der Erdhügel erhalten, auf dem sie einst gestanden hat. Das Mauerwerk ist längst abgebrochen worden. Der Bereich der Vorburg ist heute mit hohen Bäumen bewachsen. Ein Brunnen aus Bruchstein hat sich hier als Relikt noch erhalten. Dieser wurde im 19. Jahrhundert erstmals erwähnt, das genaue Jahr seiner Erbauung ist jedoch nicht bekannt.
In einem Parkgelände unweit der Ahse befindet sich die größte und besterhaltende Motte Westfalens. Eine Motte ist ein zur Verteidigung aufgeschütteter Erdhügel, auf dem eine Burganlage errichtet wurde. Die Oberburg von Burg Mark wurde auf einer sieben Meter hohen Motte errichtet. Eine Gräfte umfloss sowohl die Oberburg als auch die Vorburg, auf der sich die Wirtschaftsgebäude befanden. Die Gesamtlänge der Anlage betrug 200 Meter und war damit für die damalige Zeit ungewöhnlich groß. Burg Mark war eine so genannte Ringmantelburg mit zwei Türmen. Die Außenmauer umschloss kreisförmig den Innenhof und bot so zusammen mit dem Hügel und den Wassergräben einen wirkungsvollen Schutz gegen Angreifer. Von der ehemaligen, gegen Ende des 12. Jahrhunderts errichteten Burganlage Mark ist heute noch der Erdhügel erhalten, auf dem sie einst gestanden hat. Das Mauerwerk ist längst abgebrochen worden. Der Bereich der Vorburg ist heute mit hohen Bäumen bewachsen. Ein Brunnen aus Bruchstein hat sich hier als Relikt noch erhalten. Dieser wurde im 19. Jahrhundert erstmals erwähnt, das genaue Jahr seiner Erbauung ist jedoch nicht bekannt.
Geschichtlicher Ablauf
Burg Mark ist im Besitz des Grafen Friedrich von Berg-Altena. Er gilt als der wahrscheinliche Erbauer der Burg.
Nach Abbrucharbeiten blieb nur noch ein Rest der Ringmauer und ein Turm erhalten.
Burg Mark wird in die Liste der Bodendenkmäler aufgenommen.
 Nahe der Lippe gelegen, befindet sich das Schloss Heesen, ein ehemaliges Rittergut und heutiges Internat. Von den an der Lippe aufgereihten Hammer Herrenhäusern ist Schloss Heesen das bedeutendste und prächtigste. Die Ursprünge des Oberhofes gehen bis in das 10. Jahrhundert zurück. Die Schlossanlage besteht aus insgesamt vier Häusern. Das Hauptgebäude ist ein dreiflügliger Backsteinbau und besitzt einen 30 m hohen Turm. Im Kern stammt das Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, ihr heutiges Erscheinungsbild bekam es jedoch erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Wasserschloss im neugotischen Stil umfangreich umgebaut wurde. Dabei erhielt es auch die gotischen Zinnen auf den Treppengiebeln, die das Schloss prägen. Im Jahre 2008 diente Schloss Heesen als Kulisse für den erfolgreichen Kinofilm ‚Die wilden Hühner’.
Nahe der Lippe gelegen, befindet sich das Schloss Heesen, ein ehemaliges Rittergut und heutiges Internat. Von den an der Lippe aufgereihten Hammer Herrenhäusern ist Schloss Heesen das bedeutendste und prächtigste. Die Ursprünge des Oberhofes gehen bis in das 10. Jahrhundert zurück. Die Schlossanlage besteht aus insgesamt vier Häusern. Das Hauptgebäude ist ein dreiflügliger Backsteinbau und besitzt einen 30 m hohen Turm. Im Kern stammt das Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, ihr heutiges Erscheinungsbild bekam es jedoch erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Wasserschloss im neugotischen Stil umfangreich umgebaut wurde. Dabei erhielt es auch die gotischen Zinnen auf den Treppengiebeln, die das Schloss prägen. Im Jahre 2008 diente Schloss Heesen als Kulisse für den erfolgreichen Kinofilm ‚Die wilden Hühner’.
975 Um 1200 Durch Heirat gelangt das Anwesen an die Grafen von Altena-Isenberg. 1243 Nach 1350 15. Jhd. 1590-1600 1775 1803 1806 1808 1813 1905-08 1957
Geschichtlicher Ablauf
Erstmalige urkundliche Erwähnung des Erbgutes ‚Hesnon’
Nach dem Ende der ‚Isenberger Wirren’ wurde der Rittersitz dem Haus Limburg zugesprochen.
Neubau einer Wasserburg an etwas versetzter Position.
Dietrich von der Recke lässt ein neues Herrenhaus errichten.
Neubau der Wirtschaftsgebäude auf der Vorburg.
Die Burganlage wird Bentheim-Tecklenburger Lehen und wird dem Freiherren Friedrich Joseph von Boeselager zu Nehlen und Höllinghofen vererbt. Dieses führte jedoch zu einem jahrzehntelangen Rechtsstreit innerhalb der Familie.
Rückgabe von Schloss Heesen an die Familie von der Recke.
Einnahme des Schlosses durch Napoléon und den verbündeten Holländern.
Die Familie derer von Boeselager erhält Schloss Heesen zurück und nutzt es als Wohnsitz.
Plünderungen während der Befreiungskriege.
Die verschiedenen Umbauten der letzten Jahrhunderte wurden rückgängig gemacht, so dass das Schloss seiner Grundform aus dem 18. Jahrhundert wieder glich. Darüber hinaus wurde die Fassade neugotisch überarbeitet und erhielt so die charakteristischen Zinnen an den Treppengiebeln.
Die Schlossgebäude werden als Landschulheim und als Internat genutzt.
Im Stadtteil Bockum-Hövel, im Norden von Hamm, befindet sich das ehemalige Rittergut Haus Ermelinghof. Vier Gebäude aus verschiedenen Epochen bilden zusammen die Wasserschlossanlage, die ursprünglich auf drei separaten Inseln lag. Diese bildeten die Hauptburg, die Vorburg mit den Wirtschaftsgebäuden und das Vorwerk mit der St.-Bartholomäus-Kapelle. Heute umfließt nur noch eine Gräfte das Schloss. Ältester Bestandteil des Gutes ist das Ziegelbrauhaus (1627) neben dem Herrenhaus mit seinem im Münsterland typischen Dreistaffelgiebel. Das dreistöckige Hauptschloss wurde nach einem verheerenden Feuer im Jahre 1875 wiedererrichtet. Die Fachwerkgebäude der Vorburg entstanden um 1800, das klassizistische Torhaus mit seinen griechisch anmutenden Säulen wurde 1831 fertig gestellt. Der Besitzer betreibt heute auf Haus Ermelinghof einen Reitstall. 1350 1410 Durch Heirat kommt der Hof in Besitz derer von Galen. 1627 1654 1787 Um 1800 1831 1840 1875
Geschichtlicher Ablauf
Erstmalige urkundliche Erwähnung des Rittergutes. Besitzer des Ermelinghofes war zu dieser Zeit die Familie Scheidingen.
Ein Großfeuer beschädigt die Hofanlage schwer. Danach entsteht neben dem Herrenhaus das bis heute nahezu unverändert gebliebene Ziegelbrauhaus mit seinem Dreistaffelgiebel.
Die dem heiligen Bartholomäus geweihte Schlosskapelle auf dem Vorwerk entsteht.
Durch eine Zwangsversteigerung kommt Haus Ermelinghof in den Besitz des Freiherrn Anton von Wintgen.
Bau der Wirtschaftsgebäude auf der Vorburg.
Bau des lang gestreckten klassizistischen Torhauses.
Durch Heirat kommt das Anwesen in den Besitz derer von Twickel.
Nachdem ein Feuer das Herrenhaus vollständig zerstört hatte, wird das Haupthaus im neugotischen Stil wieder errichtet.
 Mächtig ragt das zweistöckige Herrenhaus von Schloss Oberwerries direkt aus dem Wasser seiner Gräfte. Ambrosius von Oelde baute ab 1684 das zweiflüglige Herrenhaus für Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg. Das Schloss wird geprägt von seinem mächtigen, vorstehenden Pavillonturm. Der Marstall und der kleine Hundestall auf der Vorburg wurden von dem berühmten westfälischen Baumeister Johann Conrad Schlaun gestaltet. Der älteste Gebäudeteil ist das im Jahre 1667 er- oder umgebaute Torhaus. Möglicherweise ist das Bauwerk bedeutend älter, aber verlässliche Daten gibt es hierfür nicht mehr. Heute nutzt die Stadt Hamm das Schloss als Gästehaus, als Veranstaltungsort sowie für repräsentative Empfänge.
Mächtig ragt das zweistöckige Herrenhaus von Schloss Oberwerries direkt aus dem Wasser seiner Gräfte. Ambrosius von Oelde baute ab 1684 das zweiflüglige Herrenhaus für Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg. Das Schloss wird geprägt von seinem mächtigen, vorstehenden Pavillonturm. Der Marstall und der kleine Hundestall auf der Vorburg wurden von dem berühmten westfälischen Baumeister Johann Conrad Schlaun gestaltet. Der älteste Gebäudeteil ist das im Jahre 1667 er- oder umgebaute Torhaus. Möglicherweise ist das Bauwerk bedeutend älter, aber verlässliche Daten gibt es hierfür nicht mehr. Heute nutzt die Stadt Hamm das Schloss als Gästehaus, als Veranstaltungsort sowie für repräsentative Empfänge.
1284 1464 Verkauf der Burg Oberwerries an Gerd von Beverförde. 1667 1684-92 1730-35 1768 1781 1942 1952-75
Geschichtlicher Ablauf
Erstmalige urkundliche Erwähnung einer Burg zu Werries. Engelbert von Herbern wurde durch Dietrich von Limburg mit dem Besitz belehnt.
Das Torhaus ist der älteste erhaltene Teil der Schlossanlage. Auf Grund der gotischen Fenster wird vermutet, dass sich die im Maueranker eingemeißelte Jahreszahl 1667 nur auf einen Umbau bezieht, das Gebäude aber im Kern wesentlich älter ist.
Bau des Herrenhauses durch den Kapuzinermönch Ambrosius von Oelde für Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg, der es für seine Schwester Ida errichten ließ.
Der berühmte westfälische Baumeister Johann Conrad Schlaun errichtete auf der Vorburg das Marstallgebäude.
Durch Erbschaft kommt das Schloss in den Besitz der Familie von Elverfeldt.
Abermals durch Erbschaft gelangt das Anwesen in den Besitz derer von Beverförde-Werries auf Loburg bei Ostbevern. Das Schloss blieb jedoch lange Zeit unbewohnt und verfiel dadurch bedingt.
Zunächst erwirbt die Zeche Sachsen das baufällige Haus, verkauft es aber im gleichen Jahr weiter an die Stadt Hamm.
Restauration und Umbau der Schlossanlage. Zunächst wurde in den Räumen des Herrenhauses ein Berufslandschulheim untergebracht, heute dient es repräsentativen Empfängen der Stadt, als Veranstaltungsort und als Bildungs- und Begegnungsstätte.
Seit über 600 Jahren befindet sich das Wasserschloss Haus Uentrop im Besitz der Familie von der Recke. Das heutige Herrenhaus ist ein schlichtes, zweistöckiges Gebäude mit Walmdach. Es wurde im 18. Jahrhundert errichtet, nachdem die Vorgängerburg bei einem Feuer vernichtet worden war. Ursprünglich diente das Haus Uentrop der Grenzsicherung an der Lippe. Heute steht das Hauptschloss leer, die Wirtschaftsgebäude werden landwirtschaftlich genutzt. 1198 1328 Dietrich von Grimberg wird als Besitzer der Burg urkundlich erwähnt. 1393 1679 1713-20 1849 1860 1976
Geschichtlicher Ablauf
Haus Uentrop wird urkundlich erwähnt als grenzsichernde Ritterburg für den Grafen von Berg-Altena.
Hermann von der Recke erhält Haus Uentrop als Lehen.
Ein Großfeuer zerstört die Burg und die Wirtschaftsgebäude
Neubau des Schlosses durch die Familie von der Recke-Baer
Bau des Gesindeshauses
Die Scheune mit dem Staffelgiebel entsteht.
Bis 1976 wurde das Herrenhaus durch Mitglieder der Familie von der Recke bewohnt, seit dem steht das Gebäude leer.
Unmittelbar an der Autobahn A1 liegt im Stadtteil Lerche an der Grenze zu Bergkamen das Haus Reck. Vormals Haus zur Heide genannt, erhielt es seinen Namen ‚Reck’ erst Mitte des 16. Jahrhunderts. Haus Reck gehörte einst zu den zehn Burgmannshöfen von Kamen und diente somit dem Schutz des damaligen Grenzortes. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts erhielt der Hof mehr Eigenständigkeit. Das heutige Erscheinungsbild des gelb getünchten Herrenhauses mit seinem dreistöckigen Wehrturm entstammt aber erst dem 19. Jahrhundert. 12 Jhd. 14 Jhd. Der Burgmannshof ist im Besitz von Dietrich von der Recke. 1465 16 Jhd. 1649 1709 1715 1775 1821
Geschichtlicher Ablauf
Bau einer befestigten Residenz in Kamen durch die Grafen von Altena. In der Folgezeit entstanden zehn Burgmannshöfe an der damaligen Ortsgrenze, zu denen auch das damals noch Haus zur Heide genannte Anwesen gehörte.
Das Haus zur Heide wird zur festen Burg ausgebaut.
Mitte des Jahrhunderts entstanden als Wirtschaftsgebäude das Bauhaus und das Hallenhaus. Der Hof wird jetzt Haus Reck genannt.
Stiftung der Kapelle auf der Vorburg.
Die Herrlichkeit Reck entsteht mit eigenem Verwaltungs- und Gerichtsbezirk.
Bau der Backsteinscheune.
Der Schafstall entsteht im Fachwerkbauweise.
Verkauf des Gutes an den Freiherrn von Syberg zu Busch. In der Folgezeit werden das Herrenhaus und der Wehrturm erheblich umgebaut.
Das im späten Mittelalter errichtete Brauhaus Henin gilt nach der Schlossmühle Heesen als das älteste Gebäude der Stadt Hamm. Der Bau des Fachwerkhauses wird auf das Jahr 1516 datiert und erhielt seinen Namen von der Familie Henin, die das Gebäude im 18. Jahrhundert bewohnte. Heute dient das alte Brauhaus wieder als Gaststätte.
 Im Jahre 1876 stieß man bei Probebohrungen, bei denen man hoffte, Kohle zu finden, auf eine Sohlequelle. So wurde die Stadt 1882 Badekurort und durfte sich bis 1955 ‚Bad Hamm’ nennen. Im Jahre 1882 entstand dann auch der 34 ha große Kurpark. Er liegt südlich vom Datteln-Hamm-Kanal und schließt sich östlich an die Innenstadt an. Heute ist der Kurpark ein viel genutztes Naherholungsgebiet mit mehreren Seen, weiträumigen Rasenflächen und einem alten Baumbestand, der noch aus den Anfängen des Parks stammt. Skulpturen säumen die Spatzierwege durch das Gelände. Im Zentrum befindet sich das repräsentative denkmalgeschützte Kurhaus. Im Jahre 2009 wurde im westlichen Teil des Kurparks eine 41 m lange und über 9,5 m hohe Saline errichtet. Obwohl noch weitere Sohlevorkommen im Erdreich vermutet werden, wird das Gradierwerk von einem großen Tank gespeist. Alljährlich findet mit dem Kurparkfest ein großes Volksfest statt, bei dem viele namhafte Künstler auftreten und dessen Höhepunkt ein abendliches Großfeuerwerk ist.
Im Jahre 1876 stieß man bei Probebohrungen, bei denen man hoffte, Kohle zu finden, auf eine Sohlequelle. So wurde die Stadt 1882 Badekurort und durfte sich bis 1955 ‚Bad Hamm’ nennen. Im Jahre 1882 entstand dann auch der 34 ha große Kurpark. Er liegt südlich vom Datteln-Hamm-Kanal und schließt sich östlich an die Innenstadt an. Heute ist der Kurpark ein viel genutztes Naherholungsgebiet mit mehreren Seen, weiträumigen Rasenflächen und einem alten Baumbestand, der noch aus den Anfängen des Parks stammt. Skulpturen säumen die Spatzierwege durch das Gelände. Im Zentrum befindet sich das repräsentative denkmalgeschützte Kurhaus. Im Jahre 2009 wurde im westlichen Teil des Kurparks eine 41 m lange und über 9,5 m hohe Saline errichtet. Obwohl noch weitere Sohlevorkommen im Erdreich vermutet werden, wird das Gradierwerk von einem großen Tank gespeist. Alljährlich findet mit dem Kurparkfest ein großes Volksfest statt, bei dem viele namhafte Künstler auftreten und dessen Höhepunkt ein abendliches Großfeuerwerk ist.
Auf einem alten Bauerngehöft aus dem 17. Jahrhundert befindet sich heute die 1996 ins Leben gerufene Ottmar-Alt-Stiftung. Auf dem 10.000m² große Anwesen sind Ateliers für Stipendiaten und mehrere Ausstellungsräume untergebracht, in denen Wechselausstellungen bildender Künstler, aber auch Kleinkunst- und Theaterveranstaltungen stattfinden. Auf dem Freigelände wurde ein umfangreicher Skulpturengarten eingerichtet.
 Der hinduistische Sri Kamadchi Ampal Tempel in Hamm-Uentrop ist der größte erbaute tamilische Tempel Europas. Er misst 27 x 27 Meter und besitzt einen Innenraum von 700 m². Streng nach den traditionellen rituellen Vorgaben konzipiert, wurde der Tempel im Jahre 2002 eröffnet. Das Tempelportal, der so genannte Gopuram wurde im südindischen Stil errichtet und misst eine stattliche Höhe von 17 Metern.
Der hinduistische Sri Kamadchi Ampal Tempel in Hamm-Uentrop ist der größte erbaute tamilische Tempel Europas. Er misst 27 x 27 Meter und besitzt einen Innenraum von 700 m². Streng nach den traditionellen rituellen Vorgaben konzipiert, wurde der Tempel im Jahre 2002 eröffnet. Das Tempelportal, der so genannte Gopuram wurde im südindischen Stil errichtet und misst eine stattliche Höhe von 17 Metern.
 Das im Stil des Historismus errichtete Bahnhofsgebäude gilt als eines der Schönsten Deutschlands. Nachdem sich Hamm schon früh im 19. Jahrhundert als bedeutender Eisenbahnknotenpunkt entwickelt hatte, wurde 1861 das Gebäude als Inselbahnhof zwischen den Gleisen fertig gestellt. Der denkmalgeschützte Hauptbahnhof wurde in den letzten Jahren umfangreich restauriert. 2001 wurde die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, der jetzige Willy-Brandt-Platz, abgeschlossen.
Das im Stil des Historismus errichtete Bahnhofsgebäude gilt als eines der Schönsten Deutschlands. Nachdem sich Hamm schon früh im 19. Jahrhundert als bedeutender Eisenbahnknotenpunkt entwickelt hatte, wurde 1861 das Gebäude als Inselbahnhof zwischen den Gleisen fertig gestellt. Der denkmalgeschützte Hauptbahnhof wurde in den letzten Jahren umfangreich restauriert. 2001 wurde die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, der jetzige Willy-Brandt-Platz, abgeschlossen.
 Die ehemalige Zeche Heinrich-Robert liegt im Hammer Stadtteil Herringen und war zuletzt Teil des zusammengelegten ‚Bergwerk Ost’. 1901 wurden die ersten Schächte abgeteuft, seit 1904 wurde schließlich Steinkohle gefördert. Die Endteufe betrug über 1.200 m und zeitweilig arbeiteten über 5.500 Kumpel auf der Zeche. Aber am 30. September 2010 wurde die letzte Schicht gefahren und damit wurde auch die letzte Zeche in Hamm geschlossen. Die Kissinger Höhe ist die Abräumhalde des Bergwerk Ost. In den Jahren 1974 bis 1998 wuchs sie auf eine Höhe von 55 Metern. Von oben hat man bei klarem Wetter eine wunderbare Sicht auf die Stadt Hamm und das weitere umland. Insgesamt 17 km Wanderwege mit verschiedenen Steigungsgraden erwarten den Besucher. Die Halde wurde als Nordic Walking Park ausgewiesen. Informationstafeln mit Routenbeschreibungen befinden sich am Fuße der Anhöhe. Auf dem Weg nach oben wurde ein Bergwerkslehrpfad einrichtet. Er zeigt Geräte aus dem Bergbau und beschreibt auf Tafeln die Techniken, die unter Tage angewendet werden.
Die ehemalige Zeche Heinrich-Robert liegt im Hammer Stadtteil Herringen und war zuletzt Teil des zusammengelegten ‚Bergwerk Ost’. 1901 wurden die ersten Schächte abgeteuft, seit 1904 wurde schließlich Steinkohle gefördert. Die Endteufe betrug über 1.200 m und zeitweilig arbeiteten über 5.500 Kumpel auf der Zeche. Aber am 30. September 2010 wurde die letzte Schicht gefahren und damit wurde auch die letzte Zeche in Hamm geschlossen. Die Kissinger Höhe ist die Abräumhalde des Bergwerk Ost. In den Jahren 1974 bis 1998 wuchs sie auf eine Höhe von 55 Metern. Von oben hat man bei klarem Wetter eine wunderbare Sicht auf die Stadt Hamm und das weitere umland. Insgesamt 17 km Wanderwege mit verschiedenen Steigungsgraden erwarten den Besucher. Die Halde wurde als Nordic Walking Park ausgewiesen. Informationstafeln mit Routenbeschreibungen befinden sich am Fuße der Anhöhe. Auf dem Weg nach oben wurde ein Bergwerkslehrpfad einrichtet. Er zeigt Geräte aus dem Bergbau und beschreibt auf Tafeln die Techniken, die unter Tage angewendet werden.
 Der Stadthafen Hamm ist der zweitgrößte öffentliche Kanalhafen Deutschlands. Er liegt am Datteln-Hamm-Kanal und wird jährlich von über 1700 Schiffen angelaufen. Hauptumschlaggüter sind Getreide und andere Nahrungsmittel, Futtermittel, Kohle, Öl und Stahl. Der Hafen wurde zusammen mit dem Kanal im Jahre 1914 eröffnet. Bereits 100 Jahre zuvor hatte es einen Hafen an der Lippe gegeben. Doch der Fluss eignete sich nur bedingt für die Schifffahrt, da sich Wassertiefe und Strömungsverlauf der Lippe ständig veränderte. So wurde der Schiffsverkehr 1870 endgültig eingestellt.
Der Stadthafen Hamm ist der zweitgrößte öffentliche Kanalhafen Deutschlands. Er liegt am Datteln-Hamm-Kanal und wird jährlich von über 1700 Schiffen angelaufen. Hauptumschlaggüter sind Getreide und andere Nahrungsmittel, Futtermittel, Kohle, Öl und Stahl. Der Hafen wurde zusammen mit dem Kanal im Jahre 1914 eröffnet. Bereits 100 Jahre zuvor hatte es einen Hafen an der Lippe gegeben. Doch der Fluss eignete sich nur bedingt für die Schifffahrt, da sich Wassertiefe und Strömungsverlauf der Lippe ständig veränderte. So wurde der Schiffsverkehr 1870 endgültig eingestellt.
 Das direkt an der Lippe liegende Gerstein-Kraftwerk ist eine der markantesten Industrieanlagen im Ruhrgebiet. Seine drei monumentalen Kühltürme sind weithin sichtbar. Bereits 1914 wurde das Kraftwerk errichtet und in den folgenden Jahrzehnten stetig ausgebaut. Zeitweilig war es das grö0te Steinkohlekraftwerk Deutschlands. Noch heute wird täglich aus ungefähr 400t Kohle Strom produziert.
Das direkt an der Lippe liegende Gerstein-Kraftwerk ist eine der markantesten Industrieanlagen im Ruhrgebiet. Seine drei monumentalen Kühltürme sind weithin sichtbar. Bereits 1914 wurde das Kraftwerk errichtet und in den folgenden Jahrzehnten stetig ausgebaut. Zeitweilig war es das grö0te Steinkohlekraftwerk Deutschlands. Noch heute wird täglich aus ungefähr 400t Kohle Strom produziert.
 Die ‚Lupia‘ gehört zu den drei Lippefähren, mit denen Fußgänger und Radfahrer kostenfrei den Fluss überqueren können. Allerdings ist die eigene Muskelkraft erforderlich, um die Gierseilfähre am Schloss Oberwerries in Bewegung zu setzen. Mit einer Kette wird das Boot zum anderen Ufer gezogen. Die Betriebszeit der Fähre ‚Lupia‘ ist zwischen April und Anfang November. ‚Lupia‘ ist der lateinische Name für ‚Lippe‘, da die Fährverbindung in die im Jahr 2013 neu gestalteten Römer-Lippe-Route eingebunden ist.
Die ‚Lupia‘ gehört zu den drei Lippefähren, mit denen Fußgänger und Radfahrer kostenfrei den Fluss überqueren können. Allerdings ist die eigene Muskelkraft erforderlich, um die Gierseilfähre am Schloss Oberwerries in Bewegung zu setzen. Mit einer Kette wird das Boot zum anderen Ufer gezogen. Die Betriebszeit der Fähre ‚Lupia‘ ist zwischen April und Anfang November. ‚Lupia‘ ist der lateinische Name für ‚Lippe‘, da die Fährverbindung in die im Jahr 2013 neu gestalteten Römer-Lippe-Route eingebunden ist.
 Eines der berühmtesten Industriekomplexe im Ruhrgebiet sind die Krafwerke in Hamm-Uentrop. Das ehemalige Kernkraftwerk besaß die exakten Bezeichnung ‚THTR-300‘. Es wurde 1983 in Betrieb genommen und galt als weitaus unfallsicherer als vergleichbare ältere Kernkraftanlagen. Doch 1986 kam es zu einem Zwischenfall, bei dem auch geringe Mengen an Radioaktivität austraten. Der Betreiber geriet wenig später an den Rand der Insolvenz. 1989 wurde der Reaktor nach einer Laufzeit von nur 7 Jahren wieder vom Netz genommen. Während der große Trockenkühlturm bereits 1991 gesprengt wurde, kann mit dem Abriss des Reaktorblocks frühestens 2030 begonnen werden.
Eines der berühmtesten Industriekomplexe im Ruhrgebiet sind die Krafwerke in Hamm-Uentrop. Das ehemalige Kernkraftwerk besaß die exakten Bezeichnung ‚THTR-300‘. Es wurde 1983 in Betrieb genommen und galt als weitaus unfallsicherer als vergleichbare ältere Kernkraftanlagen. Doch 1986 kam es zu einem Zwischenfall, bei dem auch geringe Mengen an Radioaktivität austraten. Der Betreiber geriet wenig später an den Rand der Insolvenz. 1989 wurde der Reaktor nach einer Laufzeit von nur 7 Jahren wieder vom Netz genommen. Während der große Trockenkühlturm bereits 1991 gesprengt wurde, kann mit dem Abriss des Reaktorblocks frühestens 2030 begonnen werden.
Gleich neben dem alten KKW entstand in unmittelbarer Nähe zur Lippe sowie am Ende des Datteln-Hamm-Kanals ein neues Gas- und Dampf-Kombikraftwerk, das mit seinen beiden riesigen Kühltürmen eine schon von Weitem erkennbare Landmarke darstellt. Das GuD-Krafwerk hat eine Leistung von 850 MW und ging 2007 in Betrieb.
Radrouten die durch Hamm führen:
Werse Rad Weg
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Rundkurs Ruhrgebiet
Route der Industriekultur per Rad
Radroute Historische Stadtkerne
Werne
ie im Jahre 824 erstmals urkundlich erwähnte Stadt an der Lippe liegt im südlichen Münsterland an der Grenze zum nordöstlichen Ruhrgebiet, wird aber noch durch die typische weite Parklandschaft des Münsterlandes geprägt. Um 800 hatte hier Liudger, der erste Bischof von Münster, im Auftrag von Kaiser Karl dem Großen, eine Kapelle errichten lassen. Werne besitzt einen hübschen historischen Stadtkern mit kleinen Gassen und alten Fachwerkhäusern. Besondere Anziehungspunkte sind das Alte Rathaus von 1514, die Kirche St. Christophorus aus dem 15. Jahrhundert und das ‚Alte Steinhaus‘ aus dem 14. Jahrhundert. Trotz der historischen Bausubstanz wirkt die jüngst umgestaltete Fußgängerzone mit seinen Geschäften und Cafés modern und zeitgemäß. Direkt an das Zentrum grenzt der Stadtpark mit seinem idyllischem See, dem Gradierwerk, dem Natursolebad und der Freilichtbühne, auf der in den Sommermonaten wechselnde Theaterstücke aufgeführt werden. Mit der stillgelegten alten Zeche Werne blieb ein Industriedenkmal erhalten, dass die unmittelbare Nähe zum Ruhrgebiet dokumentiert. Das beliebte Volksfest Sim-Jü, das auf das Marktrecht von 1342 zurückgeht, lockt jeden Oktober tausende von Menschen aus der Umgebung nach Werne. Ein weiterer Anziehungspunkt ist das Karl-Pollender-Museum mit seiner umfangreichen Ausstellung zur Stadtgeschichte.
Sehenswertes:
Die Altstadt Wernes mit seinen mittelalterlichen Fachwerkhäusern und seinen schmalen Gassen besitzt einen gemütlichen Charme. Der historische Marktplatz ist der zentrale Ort der Stadt. Hier steht mit dem zwischen 1512 und 1514 erbauten Alte Rathaus eines der ältesten Gebäude der Stadt. Es gilt als typisches Beispiel für ein münsterländisches Bogenhauses. In den gotischen Bogengängen befanden sich einst die Stadtwaage und die Wachstube. Hier stand der Pranger und hier wurden die öffentlichen Bekanntmachungen verlautbart. Darüber befanden sich die Ratskammern für das Ratsgericht und im Obergeschoß tagte im großen Saal der Rat der Stadt. Und das tut er sogar noch bis zum heutigen Tage!
Im Jahre 1691 wurde das ‚Alte Amtshaus‘ im Stadtzentrum als Fachwerkhaus erbaut. Es diente dem bischöflichen Amtsrentmeister als Amts- und Wohnsitz. 1962 richtete der Realschullehrer und Heimatvereinsvorsitzende Karl Pollender in zwei Räumen des Amtshauses ein kleines Heimatmuseum ein. Hier wurden heimatkundliche Gegenstände ausgestellt, die Pollender in vielen Jahren zusammengetragen hatte.
Inzwischen hat sich das Museum auf vier Etagen und eine Ausstellungsflächen von 1.000 m² ausgeweitet. Es behandelt die Vor- und Frühgeschichte, die Stadtgeschichte vom Mittelalter bis zur Neuzeit und zeigt Exponate aus der Landwirtschaft und dem Handwerk. Ein Raum widmet sich dem Somon-Juda-Markt, kurz ‚Sim-Jü‘, der auf das Marktrecht von 1362 zurückgeht und sich heute zu einem beliebten Jahrmarkt entwickelt hat. Das wertvollste Ausstellungsstück ist eine seidene Kasel, ein Priestergewand aus dem 13. oder 14. Jahrhundert.
Werne liegt zwar im südlichen Münsterland, aber dennoch am Rande des Ruhrgebietes. Als 1899 mit dem Abteufen der Schächte Werne 1 und 2 begonnen wurde, war die Zeche Werne das erste Bergwerk im Ruhrgebiet nördlich der Lippe. Bereits 1930 wurde die Zeche im Zuge der Weltwirtschaftskrise vorübergehend wieder stillgelegt, um nach dem Zweiten Weltkrieg den Betrieb wieder aufzunehmen. 1975 wurde die Zeche Werne dann endgültig geschlossen.
Mehrere Bauwerke, wie das Fördermaschinenhaus, die Schmiede, das Pförtnerhaus, die Turnhalle und die Verwaltung, sind noch erhalten und stehen inzwischen unter Denkmalsschutz. Die Liegenschaften werden auch heute noch gewerblich genutzt. Die Schachtanlagen Werne 1 und 2, sowie Werne 3 im benachbarten Rünthe wurden in die ‚Route der Industriekultur‘ aufgenommen.
In unmittelbarer Nähe zum Natur-Solebad entstand 1990 im Stadtpark das Gradierwerk. Über eine aus Schwarzdorn bestehende Rieselwand wird ständig solehaltiges Wasser geleitet, das durch seine Zerstäubung ein maritimes Kleistklima entstehen lässt. Diese Luft wirkt insbesondere bei Atemwegerkrankungen heilsam. Das Gradierwerk wird aber auch von vielen Einheimischen aufgesucht, die einfach kurz einmal die salzhaltige Luft tief einatmen wollen.
Die katholische Pfarrkirche ist die Urpfarre der Stadt Werne und wurde bereits im 11. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Bis in das 19. Jahrhundert war sie dem Kloster Cappenberg unterstellt. Mitte des 15. Jahrhunderts begann der Neubau des heutigen Gotteshauses, nachdem die Vorgängerkirche bei einem Feuer weitgehend zerstört wurde. Der zweiteilige Turm wurde 1555 vollendet. Sehenswert sind die spätgotische Sakristeitür und der reich mit Reliefs verzierte, achteckige Taufstein. Zu der Innenausstattung gehören eine Doppelmadonna aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert, ein Vesperbild aus der gleichen Zeit und eine große Statue des hl. Christophorus aus dem frühen 17. Jahrhundert.
Am südlichen Stadtrand Wernes steht die Klosteranlage St. Petrus und Paulus. Die Klosterkirche wurde 1680 fertig gestellt. Die Ausstattung aus der Anfangszeit mit dem Hochaltar, vom Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg gestiftet, den Seitenaltären und der hölzernen Kanzel, ist noch weitgehend erhalten. Das Astkreuz stammt sogar noch aus dem 14. Jahrhundert.
Die daneben stehenden Klostergebäude entstanden zwischen 1671 und 1673 und wirken eher schlicht.
Der Droste der Abtei Werden ließ dieses Haus im 14. Jahrhundert erbauen. In einer Zeit, in der die Häuser vornehmlich aus Fachwerk errichtet wurden, war es das erste Haus in Werne, das vollständig aus Stein gemauert wurde. Fast 250 Jahre war das Steinhaus im Besitz der Herren von Merveldt zu Westerwinkel. Heute beherbergt es die Stadtbücherei.
Um 1400 entstanden rings um den Kirchplatz kleine Fachwerkhäuser. Sie dienten als Getreidespeicher und als Platz zum Aufwärmen vor und nach den Kirchgängen, denn in der unbeheizten Kirche war es im Winter arg kalt! So kam es zum Namen dieser Fachwerkhäuschen. Doch bei einem Großbrand im Jahre 1586 wurden fast alle Wärmehäuschen zerstört. Erhalten haben sich das Haus Nr. 15 von 1562, das durch seine geschnitzten Blattmasken auffällt und das Haus Nr. 21 von 1447, das zu den ältesten Kleinfachwerkhäusern Westfalens zählt.
Radrouten die durch Werne führen:
Römer-Lippe-Route
Burg- und Schloss-Tour
Rundkurs Ruhrgebiet
Radroute Historische Stadtkerne
Bergkamen
ergkamen wurde seit dem Ende des 19. Jahrhunderts vom Bergbau geprägt. Mit den Zechen Monopol und Haus Aden gab es hier gleich zwei große Bergwerke, die jedoch beide in den 1990er Jahren im Verbund-Bergwerk Ost aufgingen. Aber auch dieses Bergwerk wurde 2010 schließlich stillgelegt. Die Doppelfördertürme von Schacht Grimberg 1/2 sowie der Zeche Haus Aden blieben als markante Industriedenkmäler erhalten. Am Marina Rünthe, dem größten Marinas Nordrhein-Westfalens, kann man richtiges maritimes Flair erleben. Wo noch bis in die 1990er Jahre Kohle umgeschlagen wurde, befindet sich heute ein Motorboothafen mit Promenade, Restaurants und Cafés – für Radler eine inzwischen häufig genutzte Raststätte.
Mit den Überresten des Römerlagers Oberaden besitzt die Stadt eine herausragende Sehenswürdigkeit, denn das Lager galt als größtes römisches Militärlager nördlich der Alpen. Von hier aus wurden die Feldzüge gegen die Germanen gestartet. Einige Grabungsfunde werden im Stadtmuseum ausgestellt.
Sehenswertes:
 Das Römerlager in Bergkamen-Oberaden war einst die bedeutendste militärische Anlage in Germanien und die größte nördlich der Alpen. Sie entstand im Jahre 11 v. Chr., wurde aber vermutlich bereits drei Jahre später wieder aufgegeben. Von hieraus wurden die augusteischen Germanienfeldzüge begonnen. Das römische Lager besaß eine Größe von 840 x 680 m und damit eine Fläche von rund 56 ha. Es beherbergte einst zwei Legionen mit insgesamt 15.000 Soldaten. Ein breiter und tiefer Graben umgab die Anlage, die mit einer Holzpfahlmauer zusätzlich geschützt war und im Abstand von ca. 25 m jeweils einen Wehrturm besaß. Über vier Tore konnte man in das Lager gelangen. Im Jahre 1905 wurde das römische Relikt wiederentdeckt. Einige der Ausgrabungsfunde sind im Stadtmuseum Bergkamen ausgestellt. Ein Lehrpfad mit mehreren Schautafeln gibt erklärende Informationen über die antike Militäranlage und die wichtigsten Fundorte des heute als Bodendenkmal geschützten Römerlagers. Eine begehbare Mauer ist unlängst rekonstruiert worden.
Das Römerlager in Bergkamen-Oberaden war einst die bedeutendste militärische Anlage in Germanien und die größte nördlich der Alpen. Sie entstand im Jahre 11 v. Chr., wurde aber vermutlich bereits drei Jahre später wieder aufgegeben. Von hieraus wurden die augusteischen Germanienfeldzüge begonnen. Das römische Lager besaß eine Größe von 840 x 680 m und damit eine Fläche von rund 56 ha. Es beherbergte einst zwei Legionen mit insgesamt 15.000 Soldaten. Ein breiter und tiefer Graben umgab die Anlage, die mit einer Holzpfahlmauer zusätzlich geschützt war und im Abstand von ca. 25 m jeweils einen Wehrturm besaß. Über vier Tore konnte man in das Lager gelangen. Im Jahre 1905 wurde das römische Relikt wiederentdeckt. Einige der Ausgrabungsfunde sind im Stadtmuseum Bergkamen ausgestellt. Ein Lehrpfad mit mehreren Schautafeln gibt erklärende Informationen über die antike Militäranlage und die wichtigsten Fundorte des heute als Bodendenkmal geschützten Römerlagers. Eine begehbare Mauer ist unlängst rekonstruiert worden.
Ein wesentliches Schwerpunktthema im Stadtmuseum Bergkamen ist das Römerlager Oberaden, das eine Zeit lang das größte römische Militärlager nördlich der Alpen war. Von hier gingen die Feldzüge nach Germanien aus. Die Ausstellung beschreibt das Leben der Legionäre und zeigt archäologische Fundstücke aus dem Römerlager. Weitere Schwerpunkte des Museums sind die Stadt- und Siedlungsgeschichte sowie die Entwicklung der Industrie. Besondere Höhepunkte der Ausstellung sind der begehbare Barbara-Stollen, ein alter Tante-Emma-Laden sowie Beispiele zur Wohnkultur aus der Zeit um 1900 und 1950.
Südlich der Lippe bei Rünthe sind noch die Reste einer alten Wallanlage zu erkennen. Sie besteht aus zwei Ringwällen, einer Vor- und einer Kernburg mit einer Fläche von rund 5 ha. Den Namen Bumannsburg hat sie erst später erhalten. Ihre ursprüngliche Bezeichnung ist nicht überliefert. Höchstwahrscheinlich hat sie bereits in den Sachsenkriegen im 8. Jahrhundert eine Rolle gespielt. Man vermutet, dass sie noch bis in das 12. Jahrhundert in Gebrauch war. Wann die Burg genau aufgegeben wurde, ist aber heute nicht mehr bekannt.
Die Gedenkstätte erinnert an ein düsteres Kapitel in der deutschen Geschichte. Das NS-Sammellager war in den 1920er Jahren als Sozialgebäude der Bergarbeitersiedlung ‚Kolonie Schönhausen‘ erbaut worden. Deshalb wurde sie während der Nazizeit auch KZ Schönhausen genannt. Zwischen April und Oktober 1933 diente das Gebäude als Sammellager für ungefähr 900 Menschen, die von hier aus in andere Lager weitergeleitet wurden. Heute dient das Gebäude der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde.
In der denkmalgeschützten Waschklause der Zeche ist heute ein Kulturzentrum untergebracht.
 Noch in den 1990er Jahren handelte es sich bei dem Hafen in Rünthe um einen düsteren Kohleumschlaghafen – gleich neben der großen Kohlenhalde.
Noch in den 1990er Jahren handelte es sich bei dem Hafen in Rünthe um einen düsteren Kohleumschlaghafen – gleich neben der großen Kohlenhalde.
Welch eine Entwicklung: heute glitzern weiße Bötchen an breiten Schwimmstegen in der Sonne. Das Marina Rünthe ist das größte Marina Nordrhein-Westfalens. Insgesamt gibt es hier über 300 Liegeplätze. Am Hafenbecken haben sich mehrere Restaurants, Cafés und Wassersporteinrichtungen angesiedelt und die Bänke auf der Promenade laden zum Verweilen und Pause machen ein.
Über 100 Jahre war die Zeche Monopol der wichtigste Arbeitgeber Bergkamens. Der Bergbau hat die Stadt nachhaltig geprägt. Die zu der Zeche gehörende Doppelschachtanlage Grimberg 1/2 wurde zwischen 1890 und 1894 errichtet. Noch in den 1980er Jahren wurde die Schachtanlage komplett modernisiert. Dabei entstand auch der neue markante 73 m hohe Förderturm, der heute ein bekanntes Denkmal im Ruhrgebiet ist. Durch die Zusammenlegung mit den Zechen von Haus Aden und Heinrich Robert in Hamm zum Verbund-Bergwerk Ost wurde die Förderung am Schacht Grimberg schon bald danach aufgegeben.
Die Halde ‚Großes Holz‘ wurde 1962 für die Entsorgung des Bergematerials der beiden Zechen Monopol und Haus Aden angelegt. Sie besitzt eine Höhe von rund 30 m und ist für Radfahrer und Fußgänger erschlossen. Seit der Fertigstellung im Jahre 2008 hat sie sich zum beliebten Aussichtspunkt entwickelt. Auf dem künstlichen Hügel steht die Lichtskulptur ‚Impuls‘ der Künstler Maik und Dirk Löbbert. Die mit Tausenden von LED-Leuchten besetzte Stahlsäulenkonstruktion besitzt nochmals eine Höhe von rund 30 m. Hinter der Szenerie: Wie der Name Monopol enstand In Bergkamen erzählt man sich eine amüsante Anekdote, wie der Name der Zeche Monopol endstanden sein soll. Als Heinrich Grimberg und Friedrich Grillo ihre Kohlenfelder vor dem Oberbergamt eintragen lassen wollten, hatten sie sich über einen Namen noch keinerlei Gedanken gemacht. Jetzt schaute der Beamte die beiden Unternehmer fragend an, welche Bezeichnung die neue Zeche denn nun bekommen solle. Die beiden einigten sich kurzer Hand auf den Markennamen des Champagners, mit dem sie am Vorabend auf die Geschäftsvereinbarung angestoßen hatten. Aus ‚Heidsiek Monopole‘ wurde die ‚Zeche Monopol‘. Die Schächte in Bergkamen wurden nun nach Heinrich Grimberg benannt, die in Kamen nach Friedrich Grillo.
 Neben der Zeche Monopol war das Bergwerk ‚Haus Aden‘ die zweite große Zeche Bergkamens. Die Doppelschachtanlage wurde erst 1938 errichtet. Als 1998 mit der Zusammenlegung der Zechen Haus Aden, Monopol und Heinrich Robert das neue Verbund-Bergwerk Ost entstand, verlor Haus Aden damit seine Funktion als Förderstandort. Aus der 54 ha großen Zechenbrache entstand nun ein Erholungsgebiet mit Wohnanlagen, Gewerbegebiet und einem neu angelegten See, der durch eine 800 m lange Gracht mit dem Datteln-Hamm-Kanal verbunden ist, so dass auch kleinere Schiffe auf dem See fahren können.
Neben der Zeche Monopol war das Bergwerk ‚Haus Aden‘ die zweite große Zeche Bergkamens. Die Doppelschachtanlage wurde erst 1938 errichtet. Als 1998 mit der Zusammenlegung der Zechen Haus Aden, Monopol und Heinrich Robert das neue Verbund-Bergwerk Ost entstand, verlor Haus Aden damit seine Funktion als Förderstandort. Aus der 54 ha großen Zechenbrache entstand nun ein Erholungsgebiet mit Wohnanlagen, Gewerbegebiet und einem neu angelegten See, der durch eine 800 m lange Gracht mit dem Datteln-Hamm-Kanal verbunden ist, so dass auch kleinere Schiffe auf dem See fahren können.
 Der alte Gutshof wurde 1864 erbaut und beherbergt heute die Ökologiestation des Kreises Unna. Der Wildbienenlehrpfad, ein Bauerngarten, der Umweltpädagogigteich und eine Pflanzenkläranlage sind frei zugänglich. Daneben werden Führungen durch einen Musterschweinestall und einen Fleischzerlegungsbetrieb nach Voranmeldung möglich. Am Verkaufstresen kann man regionale Produkte, wie Honig, Marmeladen und Säfte erwerben. Regelmäßig werden auf dem Gutshof wechselnde Kunstausstellungen präsentiert.
Der alte Gutshof wurde 1864 erbaut und beherbergt heute die Ökologiestation des Kreises Unna. Der Wildbienenlehrpfad, ein Bauerngarten, der Umweltpädagogigteich und eine Pflanzenkläranlage sind frei zugänglich. Daneben werden Führungen durch einen Musterschweinestall und einen Fleischzerlegungsbetrieb nach Voranmeldung möglich. Am Verkaufstresen kann man regionale Produkte, wie Honig, Marmeladen und Säfte erwerben. Regelmäßig werden auf dem Gutshof wechselnde Kunstausstellungen präsentiert.
Radrouten die durch Bergkamen führen:
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Rundkurs Ruhrgebiet
Route der Industriekultur per Rad
Lünen
ünen ist eine Mittelstadt im nördlichen Ruhrgebiet. Ehemals kreisfrei, ist Lünen heute die größte Stadt des Kreises Unna. Südlich des Zentrums befindet sich der Datteln-Hamm-Kanal, an dem sich mit dem Stadthafen ein bedeutender Umschlagpunkt für Handelsgüter befindet. Die Lippe fließt mitten durch den Stadtkern und teilt so Lünen in einen nördlichen und einen südlichen Bereich. Die Bauernschaften Alstedde, Nordlünen und Wethmar bildeten bis 1974 die eigenständige Gemeinde Altlünen, die historisch münsterländisch beeinflusst ist. Der südliche Teil Lünens dagegen ist vom Bergbau und den ehemaligen Zechen Victoria, Preußen und Gneisenau geprägt. Zechensiedlungen bestimmen hier das Stadtbild.
Von der historischen Altstadt sind leider nur noch wenige Fachwerkhäuser aus dem 17. Jahrhundert erhalten. Der überwiegende Teil wurde in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts abgerissen. Im Mittelalter war Lünen mit einer Stadtmauer befestigt und gehörte als Handelsmetropole der Hanse an. Seit 1341 besitzt Lünen das Stadtrecht, im Jahre 1512 wurde es bei einem verheerenden Stadtbrand weitgehend zerstört. Auch im Dreißigjährigen Krieg wurde Lünen stark mitgenommen. Mehrfach wurde die Stadtmauer geschleift, jeweils gleich danach jedoch wieder aufgebaut. Allein im Jahre 1634 wurde die Handelsstadt fünf Mal besetzt und dementsprechend stark beschädigt.
Zu den Sehenswürdigkeiten gehören Schloss Schwansbell südöstlich der Innenstadt, die Stadtkirche als ältestes Gebäude des Ortes von 1366 und das Colani-Ei, ein vom berühmten Designer Luigi Colani umgestalteter Steinkohle-Förderturm im Stadtteil Brambauer.
Sehenswertes:
Das älteste Bauwerk Lünens ist die von 1360 bis 1366 errichtete spätgotische Stadtkirche St. Georg. Sie befindet sich mitten in der heutigen Fußgängerzone. Bemerkenswert ist der um 1470 entstandene Flügelaltar sowie die Deckengemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert, die den Sündenfall und das Jüngste Gericht darstellen. Die Orgel und die Orgelempore entstammen der Barockzeit.
Die Pfarrkirche St. Marien wurde zwischen 1894 und 1896 als kreuzförmige Basilika im neugotischen Stil errichtet. Der mächtige rote Backsteinbau befindet sich unweit der Lippe auf der nördlichen Seite des Flusses. Ein erster mittelalterlicher Steinbau war bereits um 1018 an gleicher Stelle erbaut worden. Aus dieser Vorgängerkirche stammen noch Teile der heutigen Einrichtung, wie der zylindrische Taufstein (1270), das Triumphkreuz (14. Jhd.) sowie zwei Sandstein-Madonnen, die vermutlich aus dem 13. Jahrhundert stammen.
Leider sind in der Stadt Lünen in der Nachkriegszeit bis in die 1960er Jahre viele historische Gebäude abgerissen worden. Trotzdem blieben im Bereich des Roggenmarktes noch einige alte Fachwerkhäuser aus dem 17. Jahrhundert erhalten. Besonders erwähnenswert sind die Giebelhäuser am Roggenmarkt (Nr. 3) von 1609 und in der Silberstrasse (Nr. 3) von 1664 sowie ein so genanntes Traufenhaus von 1651 in der Mauerstrasse (Nr. 93).
Südöstlich der Innenstadt Lünens und unweit des Datteln-Hamm-Kanals liegt in einem Waldstück das Schloss Schwansbell. Das Gebäude mit seinen beiden prägenden achteckigen Türmen entstand zwischen 1872 und 1875 durch Wilhelm von Westerhold.
Bereits im 12. Jahrhundert befand sich auf dem Gelände eine Wasserburg, der Sitz des Rittergeschlechtes derer von Schwansbell. Diese Burg ist jedoch nicht mehr erhalten. Wo sie einst stand, umschließt der alte Wassergraben heute eine Garteninsel.
Schloss Schwansbell war von 1929 bis 1982 im Besitz der Stadt Lünen, heute befindet sich das Anwesen wieder im Privatbesitz. In den Innenräumen befinden sich Mietwohnungen und Büros.
In den Wirtschaftsgebäuden, dem Gesindehaus des Schlosses, ist das Museum der Stadt Lünen untergebracht. Das Heimatmuseum präsentiert die Wohnkultur der Bergarbeiter zwischen 1830 und 1930. Daneben ist auch die Puppen- und Spielzeugsammlung bemerkenswert.
Die alte Wassermühle Lippholtshausen ist ein spätbarockes Fachwerkgebäude. Sie wurde 1760 errichtet und gehörte als Schlossmühle ursprünglich zum im letzten Jahrhundert abgebrochenen Haus Buddenburg. Lange Zeit wurde die Mühle als Wohnhaus genutzt, heute gehört das Gebäude dem ‚Verein der Mühlenfreunde’. In den historischen Räumlichkeiten der Wassermühle finden heute auch standesamtliche Trauungen statt.
Im Jahr 1996 fand in Lünen die Landesgartenschau statt. Dazu gestaltete man eine alte Bergbaufläche, die einst zur Zeche Preußen gehörte und sich direkt am Datteln-Hamm-Kanal befand, zu einer großzügigen Parklandschaft um. In der Mitte des 63 ha großen frei zugänglichen Grüngeländes befindet sich der Horstmarer See, an dessen Nordufer sich ein Strandbad befindet. An den Seepark schließt sich die Preußenhalde, eine Abraumhalde der ehemaligen Zeche Preußen, an.
Der Preußenhafen ist eine Ausbuchtung im Datteln-Hamm-Kanal, angrenzend an den Seepark. Er dient einerseits als Anlegestelle für Bootstouristen, andererseits soll er aber auch ein Freizeittreffpunkt der Lüner Bevölkerung sein. Eine Promenade führt einmal um den gesamten Hafen herum, das Hafenhaus bietet Touristeninformationen auch für Radfahrer und Wanderer.
Direkt am Datteln-Hamm-Kanal liegt der Stadthafen Lünen. Er ist ein wichtiges Warenumschlagszentrum im nördlichen Ruhrgebiet. Der Hafen zieht sich am nördlichen Ufer des Kanals entlang und bietet eine Gesamtlagerfläche von ungefähr 100.000 m².
Im Lüner Stadtteil Brambauer befand sich einst das Bergwerk Minister Achenbach. Die Zeche wurde 1990 stillgelegt und anschließend zwischen 1993 und 1995 zum Technologiezentrum ‚Lüntec’ umgebaut. Die alte Schachthalle dient heute als Foyer, Veranstaltungsraum und als Ausstellungshalle.
Der ehemalige Förderturm der Schachtanlage 4 wurde von dem berühmten Designer Luigi Colani umgestaltet. Er entwarf ein UFO, das dem 35 m hohen Förderturm aufgesetzt wurde. Das im Volksmund ‚Colani-Ei’ genannte Gebilde soll den Strukturwandel im Ruhrgebiet symbolisieren. Im Inneren des UFOs wurde eine Business-Lounge eingerichtet, von der man bei klarem Wetter einen weiten Blick über Lünen und das Ruhrgebiet hat.
In der Ziethenstrasse befindet sich eine alte Bergarbeitersiedlung. Sie besteht aus 52 gleich gestalteten roten Backsteinhäusern und wurde 1898 für die Kumpel der Zeche Preußen erbaut. Obwohl die einzelnen Häuser für vier Familien konzipiert waren, wurden sie maximal für drei Familien genutzt. Typisch für diese Siedlung sind die großen Gärten, in denen sich auch Stallungen und das Klosett befanden. Der Bauherr, die Harpener Bergbau AG zeichnete sich auch verantwortlich für die Schulen, Kirchen und für eine Polizeistation. In der ehemaligen Pestalozzi-Schule befindet sich eine kulturelle Begegnungsstätte. Im Obergeschoss ist ein kleines Bergarbeitermuseum untergebracht.
An der Münsterstraße befindet sich die Bergarbeitersiedlung Victoria. Sie wurde zwischen 1910 und 1912 von der Gewerkschaft Viktoria Lünen geschaffen und wird geprägt durch hellgrau verputzte Einfamilien-Doppelhäuser, Reihenhäuser sowie von kleinen Plätzen. Diese Freiräume sorgen dafür, dass die Struktur dieser Siedlung sehr aufgelockert wirkt. Teil der Arbeiterwohnsiedlung waren auch Geschäfte sowie ein Wohlfahrtshaus mit Kindergarten und Badeanstalt.
Unweit des Preußenhafens, direkt am Datteln-Hamm-Kanal gelegen, befindet sich die Bergarbeitersiedlung ‚Am Kanal’. Sie wurde 1921/22 erbaut und war eine der ersten Siedlungen, die nicht allein durch eine Bergwerkgewerkschaft, sondern auch mit Hilfe von staatlichen Zuschüssen errichtet wurde. Einige Wohnungen wurden sogar direkt an Arbeiter verkauft, was ungewöhnlich für Bergarbeitersiedlungen war.
Die Siedlung sollte Wohnraum für die Arbeiter aller Lüner Zechen bieten (Viktoria, Preußen und Gneisenau). Sie bot auch öffentliche Einrichtungen, wie Schulen, Kirchen, Kinderbetreuungsanstalten sowie verschiedene Geschäfte. Bedingt durch ihre damalige abgeschiedene Lage war sie als geschlossene Siedlung konzipiert worden. Inzwischen wurden die Häuser privatisiert und gehören zum überwiegenden Teil den ehemaligen Mietern.
In dem Gebäude einer um 1900 erbauten Schule in Lünen-Süd befindet sich heute das Bergmannsmuseum. Die Ausstellung zeigt Fotos, Bilder und Alltagsgegenstände aus dem Leben von Bergmannsfamilien und wurde von ehemaligen Bergleuten selber zusammengetragen und eingerichtet. Nach dem allgemeinen Zechensterben zeigt dieses Museum bereits heute ein Stück regionale Vergangenheit. Auf dem Außengelände wurde ein Stollen nachgebaut, der einen kleinen Eindruck der Bergarbeiterwelt vermittelt. Neben dem Museum betreibt der Verein ‚ Multikulturelles Forum Lünen e.V.‘ im Haus auch eine Begegnungsstätte.
In einer ehemaligen Zechenkolonie im Stadtteil Brambauer befindet sich das Bergarbeiter-Wohnmuseum. Die Doppelhaushälfte, in der einst eine Bergarbeiterfamilie mit 14 Kindern hauste, wurde Anfang der 1990er Jahre ‚zurückrenoviert‘, um die Einrichtungen eines typischen Zechenhauses in der Zeit der 1920/30er Jahre zu zeigen – mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Plumpsklo! Die ausgestellten Exponate stammen zum großen Teil von Bewohnern der Siedlung.
Die Selimiye-Moschee in der Roonstraße wurde zwischen 1999 und 2008 erbaut. Betrieben wird sie durch die Türkisch-Islamische Gemeinde zu Lünen e.V. betrieben. Bei ihrer Eröffnung war sie mit einer Gebetsraumgröße von 640 m² und einer Gesamtfläche von 2.400 m² die größte Moschee in Nordrhein-Westfalen.
Das Betongebäude ist eher schmucklos gestaltet und besitzt ein Minarett. Ungleich mehr verziert ist der Innenraum des islamischen Gotteshauses. Es besitzt eine Vielzahl von Mosaiken und einen Brunnen, der sich genau unter der Kuppel befindet. Der eindrucksvolle Leuchter, der sich über diesem Brunnen befindet, wiegt ungefähr 450 kg und besitzt mehr als 100 Leuchten.
Radrouten die durch Lünen führen:
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Rundkurs Ruhrgebiet
Route der Industriekultur per Rad
Waltrop
m nördliche Rand des Ruhrgebietes liegt die Stadt Waltrop. Germanische Stämme haben hier bereits im 8. Jahrhundert v. Chr gesiedelt, die Bauernschaft ‘Elmenhorst’ wurde hier durch Karl den Großen gegründet. Der Name Waltrop entwickelte sich erst später aus ‘Walthorpe’, dem Dorf im Walde. 1939 wurden Waltrop die Stadtrechte verliehen. Die ‘Wohnstadt im Grünen’, wie sie sich gerne selber nennt, wird durchzogen von Lippe und Emscher sowie dem Dortmund-Ems-Kanal, dem Datteln-Hamm-Kanal und dem Rhein-Herne-Kanal. Der Schleusenpark Waltrop mit dem historischen Schiffshebewerk Henrichenburg ist die interessanteste und sehenswerteste Attraktion des Ortes.
Sehenswertes:
Ein Düker ist ein Bauwerk, bei dem ein Bach- oder Flusslauf mittels einer unter Druck stehenden Rohrleitung einen anderen Fluss, Kanal oder auch Gebäude unterfließt. In Henrichenburg befindet sich ein gutes Beispiel für ein solches Bauwerk, der Emscher-Düker. Hier wird die noch recht kleine Emscher unter dem Rhein-Herne-Kanal hergeleitet und kreuzt diesen damit. Der Düker wurde 1910 erbaut und ist das größte Bauwerk dieser Art an diesem Flusslauf.
Der Schleusenpark Waltrop mit dem alten Schiffshebewerk Henrichenburg ist eine technische Meisterleistung seiner Zeit und eine besondere Attraktion der Wasserstraßen Nordrhein-Westfalens. Das Schiffshebewerk befindet sich an der Kanalgabelung von Dortmund-Ems-Kanal und Rhein-Herne-Kanal und wurde 1899 von Kaiser Wilhelm II. eingeweiht. Bis 1969 blieb es in Betrieb. Mittels fünf großer zylindrischer Schwimmer wurde der damals in der Größe genormte Dortmund-Ems-Kanal-Kahn um 14 m gehoben bzw. gesenkt. Heute kann die alte Eisenfachwerkkonstruktion mit seinen Betriebsanlagen als Museum besichtigt werden. Im oberen Kanalteil liegen noch eine stattliche Anzahl von historischen Schiffen, von Polizei-Feuerlöschboot über Schlepper bis zum motorlosen Lastenkahn. Sehenswert ist auch die historische Hubbrücke von 1897. Im Unterwasser kann man das Motorgüterschiff ‘Franz-Christian’ besichtigen. Im Laderaum des 1929 gebauten Kahnes wird eine Ausstellung über das Arbeitsleben auf dem Schiff und seine Fahrten gezeigt.
Zum Schleusenpark Waltrop gehört auch das neue Schiffshebewerk. Dieses war von 1962 bis 2005 in Betrieb. Die alte Schachtschleuse von 1914 liegt heute trocken und kann der Länge nach durchquert werden. Die neue Schleuse ist seit 1989 in Betrieb und wickelt mittlerweile den gesamten Schiffsverkehr an dieser Stelle ab.
Die Zeche Waltrop war ein Steinkohlebergwerk nahe der Stadt Waltrop. Die Kohleförderung begann 1905, 1979 wurde das Bergwerk wieder stillgelegt. Zwischenzeitlich arbeiteten im Jahre 1957 hier über 2800 Mitarbeier, die höchste Jahresförderung wurde 1974 mit 1,13 Mio T erreicht.
Neun der ursprünglich elf Backsteingebäude der Tagesanlagen blieben erhalten und stehen heute unter Denkmalsschutz. Die im Stile des Historismus gestalteten Gebäude bilden nach der Zeche Zollverein in Essen den größten zusammenhängenden Hallenkomplex im Ruhrgebiet. Die Zeche wurde nach der Sanierung zum Gewerbepark umfunktioniert. Im Fördermaschinenhaus befinden sich heute Ausstellungsräume, die Kaue beherbergt das Warenhaus Manufactum.
Der Riphaushof ist eine jahrhunderte alte Hofanlage und war lange Zeit im Besitz der Familie Riphaus. Der heutige Gutshof stammt aus dem Jahre 1904 und seit 1996 ist das Haus als Heimatmuseum eingerichtet. Schwerpunkte der geschichtlichen Präsentation sind Landwirtschaft, Handwerk und Bergbau.
Mitten im historischen Ortskern der Stadt Waltrop befindet sich die katholische Pfarrkirche St. Peter. Der ursprünglich romanische Bau wird auf das 9./10. Jahrhundert geschätzt, eine erste urkundliche Erwähnung findet sich im 11. Jahrhundert. Um das Jahr 1500 wurde die Pfarrkirche zu einer großen dreischiffigen Hallenkirche im gotischen Stil umgebaut. Der heutige Kirchturm misst eine Höhe von ungefähr 40 m. Der romanische Taufstein aus dem 12. Jahrhundert ist der älteste im Vest Recklinghausen.
Um die alte Kirche herum hat sich ein Ensemble alter Fachwerkhäuschen erhalten. Das älteste ist der so genannte ‘Tempel von Waltrop’, ein spätgotisches Gebäude, das auf 1499 datiert wird und damit das älteste profane Haus in Waltrop ist.
Das einstige Schloss, das auch Haus Wilbring genannt wird, geht auf eine Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert zurück. Die heutige Anlage besteht aus einer bewohnten Vorburg und einer verfallenen Hauptburg. Beide Schlossteile stehen auf getrennten Inseln, die durch eine Brücke verbunden sind. Das Haupthaus entstand 1609 und wurde 1718 sowie 1866 umgebaut, blieb aber zuletzt unbewohnt. Der begonnene Abriss wurde 1918 eingestellt. Seitdem verfällt das Gebäude. Die Vorburg entstammt im Kern dem 18. Jahrhundert und wird heute landwirtschaftlich und als Reiterhof genutzt.
Radrouten die durch Waltrop führen:
Rad-Route Dortmund-Ems-Kanal
Emscher-Weg
Römer-Lippe-Route
Rundkurs Ruhrgebiet
Route der Industriekultur per Rad
Selm
ie Stadt Selm liegt im Übergangsbereich des südlichen Münsterlandes zum nördlichen Ruhrgebiet. Die nördlich der Lippe liegenden Ortschaften Selm, Borg und Cappenberg sind historisch münsterländisch geprägt. Durch die Entdeckung von Steinkohlevorkommen und dessen Abbau durch die Zeche Hermann vergrößerte sich Anfang des letzten Jahrhunderts die Einwohnerzahl der Gemeinde um ein vielfaches und so entstand der eher industriell geprägte Ortsteil Beifang. Bis 1974 gehörte Selm zum Kreis Lüdinghausen, seit 1975 gehört es zum Kreis Unna und wird nun offiziell dem städtischen Verdichtungsraum Ruhrgebiet zugerechnet, auch wenn das viele Bürger mit münsterländischen Wurzeln nicht gerne hören. Das erstmals 858 unter dem Namen ‚Seliheim’ erwähnte Selm erhielt 1977 das Stadtrecht, erste Siedlungen im Bereich des heutigen Ternscher Sees gab es hier bereits in der Jungsteinzeit. Hier besteht noch ein Hügelgräberfeld aus dieser Zeit. Besonders sehenswert ist das Schloss Cappenberg. Das ehemalige Residenzschloss der mächtigen Herren von Cappenberg wurde im 12. Jahrhundert Kloster des Premontratenserordens, im 19. Jahrhundert erwarb es der Freiherr von und zum Stein als Wohnsitz. Es beherbergt heute eine ständige Ausstellung zum Thema Freiherr von und zum Stein, außerdem finden hier überregional beachtete Kunstausstellungen des Kreises Unna statt. In der erhaltenen Stiftskirche werden regelmäßig Orgelkonzerte aufgeführt und ein kleines Theater rundet das Kulturangebot des Schlosses ab.
Sehenswertes:
 Nördlich des Ruhrgebietes steht auf der Gipfelkante einer Anhöhe mächtig in die Lippeniederung schauend das Schloss Cappenberg. Es gehört zu den wenigen Höhenburgen im ansonsten eher flachen Münsterland. Im Laufe der Geschichte wurde die Anlage einige Jahrhunderte als Kloster genutzt und gilt heute als bedeutendes barockes Klosterbauwerk. Die Schlosskirche ist berühmt für ihr spätgotisches Chorgestühl und beherbergt darüber hinaus einen vergoldeten Bronzekopf, der den Kaiser Barbarossa darstellt. Sie gilt als die erste bekannte Kaiserplastik des Mittelalters. Bedeutend ist auch der gemalte Altar von Jan Baegert, der dem Künstler den Beinamen ‚Meister von Cappenberg’ einbrachte. Bedeutendster Besitzer des Schlosses war der Freiherr von und zum Stein. Er erwarb das Anwesen im Jahre 1816 aus politischen Gründen, sorgte für den Umbau vom Kloster zum Schloss und lebte hier für sieben Jahre bis zu seinem Tode. Schloss Cappenberg zeigt heute vom Kreis Unna und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz organisierte wechselnde Kunstausstellungen. Auf dem Schlossgelände befindet sich neben einem kleinen Theater eine Weinstube. Der Schlossherr, Graf von Kanitz, besitzt einige Weinlagen im Rheingau. Diese Weine können hier verköstigt und erworben werden.
Nördlich des Ruhrgebietes steht auf der Gipfelkante einer Anhöhe mächtig in die Lippeniederung schauend das Schloss Cappenberg. Es gehört zu den wenigen Höhenburgen im ansonsten eher flachen Münsterland. Im Laufe der Geschichte wurde die Anlage einige Jahrhunderte als Kloster genutzt und gilt heute als bedeutendes barockes Klosterbauwerk. Die Schlosskirche ist berühmt für ihr spätgotisches Chorgestühl und beherbergt darüber hinaus einen vergoldeten Bronzekopf, der den Kaiser Barbarossa darstellt. Sie gilt als die erste bekannte Kaiserplastik des Mittelalters. Bedeutend ist auch der gemalte Altar von Jan Baegert, der dem Künstler den Beinamen ‚Meister von Cappenberg’ einbrachte. Bedeutendster Besitzer des Schlosses war der Freiherr von und zum Stein. Er erwarb das Anwesen im Jahre 1816 aus politischen Gründen, sorgte für den Umbau vom Kloster zum Schloss und lebte hier für sieben Jahre bis zu seinem Tode. Schloss Cappenberg zeigt heute vom Kreis Unna und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz organisierte wechselnde Kunstausstellungen. Auf dem Schlossgelände befindet sich neben einem kleinen Theater eine Weinstube. Der Schlossherr, Graf von Kanitz, besitzt einige Weinlagen im Rheingau. Diese Weine können hier verköstigt und erworben werden.
Geschichtlicher Ablauf
|
855 |
Der Überlieferung nach existierte auf diesem Platz bereits vor der Zeit Karls des Großen eine sächsische Fluchtburg. Sachsenherzog Ludolf hatte hier seinen Stammsitz. Sein Vater Ekbert soll von Kaiser Karl dem großen wegen seiner Verdienste mit Cappenberg belohnt worden sein. Ekbert, ein Nachfahre Widukinds begründete den Zweig der Grafen von Westfalen, die mit dem Tode Wichmanns III. 1016 ausstarben. |
|
1017 |
Übernahme der Grafschaft durch die Grafen von Cappenberg. |
|
1118 |
Gottfried II. von Cappenberg übernimmt die Grafschaft. Die Herren von Cappenberg ergreifen bei einem Konflikt für den Papst in Opposition gegen den Kaiser und trugen so zu dessen militärischen Erfolgen bei, was ihre Macht und Einflussnahme stärkte. |
|
1121 |
Treffen von Gottfried II. mit Norbert von Xanten, dem Gründer des Prämonstratenserordens. Dieser überzeugte den Grafen schließlich, seinen gesamten Besitz dem Orden zu stiften und diesem selber auch beizutreten. |
|
1122 |
Übergabe des Schlosses an Norbert von Xanten. Mitte des Jahres wurde der Klosterbetrieb aufgenommen. |
|
1127 |
Bau der Kapelle |
|
1530 |
Jan Baegert malt den Altar der Pfarrkirche. Das Gemälde machte ihn berühmt und brachte ihm den Beinamen ‚Meister von Cappenberg’ ein. |
|
17. Jhd. |
Das Schloss in seiner heutigen Form wurde in der zweiten Hälfte der Jahrhunderts als Dreiflügelanlage erstellt. Das Gebäude gilt heute als eines der wichtigsten Beispiele der westfälischen, barocken Klosterbaukunst. |
|
1708 |
Fertigstellung des barocken Mitteltraktes der Anlage. |
|
1719 |
Anlegung des Tiergartens. |
|
1740 |
Bau der beiden Torhäuser und der Brauerei. |
|
1780 |
Durch einen aufwendigen und teuren Lebensstil hatte sich der Orden gegen Ende des Jahrhunderts hoch verschuldet, konnte aber die Auflösung noch einmal abwenden. |
|
1802 |
Cappenberg fällt nach dem Reichsdeputationshauptausschuß an Preußen. König Friedrich Wilhelm hebt das Kloster auf. |
|
1806-13 |
Schloss Cappenberg fällt unter französische und bergische Verwaltung, wird danach aber wieder von Preußen in Besitz genommen. |
|
1816 |
Freiherr von und zum Stein erwirbt aus politischen Motiven das Schloss und baut es großzügig um. |
|
1824-31 |
Der Freiherr von und zum Stein nutzt Cappenberg als Hauptwohnsitz bis zu seinem Tode. |
|
1899 |
Bau des 135 m hohen Wasserturms, der bis 1927 für die Wasserversorgung der gesamten Schlossanlage genutzt wurde. |
|
1943 |
Um die kulturellen Bestände des Städtischen Kunst- und Gewerbemuseums in Dortmund zu schützen, lagerte man diese im Schloss Cappenberg aus. Nach dem Krieg wurde nur ein Teil wieder zurückgeführt. So entstand auf dem Schloss das ‚Dortmunder Museum für Kunst- und Kulturgeschichte’, das hier bis 1983 beheimatet war. |
|
1983 |
Der Kreis Unna und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz veranstalten bis heute in den Räumlichkeiten des Schlosses Ausstellungen zu wechselnden Themen. |
|
1992 |
Der Freiherr von und zum Stein nutzt Cappenberg als Hauptwohnsitz bis zu seinem Tode. |
|
1995 |
Renovierung des Westflügels und Eröffnung einer Weinstube neben dem Wasserturm. In der Folgezeit wurde auch ein kleines Theater in den Ostflügel integriert. |
 Mitten im Selmer Stadtteil Beifangs steht die Burg Botzlar. Mit dem neu errichteten und vorgelagerten Bürgerhaus bildet es ein Ensemble am Willy-Brandt-Platz. Dem uralten Gemäuer fehlt es inzwischen leider etwas an Originalität, denn die meisten burgtypischen Charakteristiken sind inzwischen verschwunden, seien es die Gräften, die Vorburg oder die Burgtürme. Nachdem einige Bauteile abgerissen wurden, besitzt die im Mittelalter von sieben Gräften umflossene Burg Botzlar einen rechteckigen Grudriß seine Fassade wirkt schlicht und schmucklos. Nur die im letzten Jahrhundert restaurierte Dachbereich mit seinen Erkern und seiner verwinkelten Dachpfannenablage weicht von der einfach-symmetrischen Grundform ab. An der Rückfront erinnert noch eine zugemauerte Tür an den ehemaligen Gefängnisturm, zwei entenbelagerte Teiche erinnern an die ehemalige Burggräfte. Heute dient die Burg als Rats- und Bürgerzentrum der Stadt Selm.
Mitten im Selmer Stadtteil Beifangs steht die Burg Botzlar. Mit dem neu errichteten und vorgelagerten Bürgerhaus bildet es ein Ensemble am Willy-Brandt-Platz. Dem uralten Gemäuer fehlt es inzwischen leider etwas an Originalität, denn die meisten burgtypischen Charakteristiken sind inzwischen verschwunden, seien es die Gräften, die Vorburg oder die Burgtürme. Nachdem einige Bauteile abgerissen wurden, besitzt die im Mittelalter von sieben Gräften umflossene Burg Botzlar einen rechteckigen Grudriß seine Fassade wirkt schlicht und schmucklos. Nur die im letzten Jahrhundert restaurierte Dachbereich mit seinen Erkern und seiner verwinkelten Dachpfannenablage weicht von der einfach-symmetrischen Grundform ab. An der Rückfront erinnert noch eine zugemauerte Tür an den ehemaligen Gefängnisturm, zwei entenbelagerte Teiche erinnern an die ehemalige Burggräfte. Heute dient die Burg als Rats- und Bürgerzentrum der Stadt Selm.
Hinter der Szenerie: Unheimliche Geschichten ranken sich um dieses alte Gemäuer. Viele Menschen, insbesondere auch Kinder, starben hier eines unerwarteten und nicht erklärbaren Todes. Ein schwarzer Geist mit Hut soll innerhalb der Burg Botzlar sowie den unterirdischen Gängen sein Unwesen treiben. Selbst heute noch lebende Personen würden alles schwören, um diesen Spuk zu bezeugen! Grundsätzlich soll der Geist zwar harmlos sein, aber allein dem Schrecken sollen viele erlegen sein…
Geschichtlicher Ablauf
|
12. Jhd. |
Gegen Anfang des Jahrhunderts wurde die Wasserburg Botzlar wahrscheinlich durch die Grafen von Cappenberg erbaut. Sie diente als Ersatz für Schloss Cappenberg, welches 1122 zum Kloster umgewandelt wurde. Aber auf einen Familienstammsitz sollte nicht verzichtet werden. Burg Botzlar wurde zum Zentrum des Gerichtsbezirkes ‘Beifang’, der in späteren Jahren zur Bauernschaft wurde. |
|
1226 |
Belehnung der Vogtei Selm an Ritter Rudolf von Meinhövel. |
|
1282 |
Älteste urkundliche Erwähnung der Burg. Verkauf von Burg und Hof an Bischof Eberhard. |
|
1315 |
Nach zeitweiliger Verpfändung des Leihgutes ging der Besitz vollständig an die Herren von Meinhövel über, da der Bischof die Burg nicht mehr zurücklösen konnte. Mittelalter Stationierung von Burgmännern zum Landesschutz auf der Burg. Die Burgen Botzlar, Rechede und Patzlar dienten dem Fürstbischof von Münster, die Südgrenze ihrer Herrschaft sichern zu lassen. Im Laufe der Jahrhunderte war die Burganlage einigen baulichen Veränderungen unterworfen. Sie besaß zeitweilig auch einen Turm mit einem Verließ an der Südwestecke der heutigen Wehranlage und war zur Verteidigung siebenfach von Wassergräben umgeben. Ursprünglich gehörte zur Burg auch eine Öl- und Wassermühle. |
|
Um 1500 |
Die Gerichtsbarkeit geht an das bischöfliche Gericht in Werne über. Später wurde die Burg als gemeiner Gutsbesitz verpachtet. Die Bewohner, zumeist Vasallen der Bischöfe von Münster, erhielten Botzlar als Lehen. |
|
1550 |
Tod des Jakob von Münster zu Meinhövel, mit dem der Familienzweig ausstarb. In den folgenden Jahren wechselten vielfach die Namen der Besitzer. |
|
1590 |
Schließlich kam die Burg in den Besitz der Familie von Ascheberg. |
|
1750 |
Durch Heirat wechselte Burg Botzlar in den Besitz von Hermann Anton Reichsfreiherr von und zu Velen, nach dessen Vornamen die spätere Zeche und die der Burg angrenzende Siedlung benannt worden sein soll. |
|
Um 1800 |
Abtragung eines Teiles der Burg an anschließender Neu- bzw. Umbau als Wohngebäude. |
|
1806 |
Verpachtung als Gut an Bauernschaft. |
|
1852 |
Einrichtung einer staatlich geförderten Ackerbauschule durch Ökonomierat Brüning. |
|
1906 |
Gründung der Zeche Hermann unweit der Burganlage. |
|
1907 |
Die Familie von Landsberg zu Velen-Gemen verkauft Burg Botzlar inklusive der dazugehörigen 1340 Morgan Land an die Trierer Bergwerkgesellschaft ‘Hermann’. Die Burg wird zum städtebaulichen Mittelpunkt der in den folgenden Jahren entstehenden Hermannsiedlung, einer Bergarbeiterkolonie. |
|
1960er Jahre |
Ende des Jahrzehnts wird der letzte Burggraben zugeschüttet, da es immer wieder Probleme mit Überschwemmungen gab. Zwei Teiche sollen heute noch an die Gräfte erinnern. Die maroden Wirtschaftsgebäude wurden abgerissen. |
|
1982 |
Nachdem die Burg fünfzehn Jahre lang leer gestanden hatte, wurde es nun zum Bürger- und Ratszentrum der Stadt Selm umfunktioniert. Der Sitzungssaal befindet sich im ersten Geschoss, ein Jugendcafé ist in den Kellergewölben untergebracht, das Dachgeschoss wird privat bewohnt. |
Hinter der Szenerie: Wie der Bahnhof Selm-Beifang entstand Nach der Schließung der Zeche Hermann fanden viele Bergarbeiter nur außerhalb von Selm eine neue Arbeitsstätte und waren so auf die Zugverbindung angewiesen, die seit ehedem von Dortmund nach Gronau durch das Westmünsterland führte. Aber die Züge hielten nur im so genannten ‚Selm-Dorf’, zwei Kilometer abseits der Bergarbeiterkolonie von Beifang. So bürgerte sich die Gewohnheit ein, dass immer einer der Arbeiter auf Höhe der Hermann-Siedlung die Notbremse zog und die Eisenbahn so zum Stehen brachte. Das nutzte dann jeweils ein Schwung von Fahrgästen, um auf dem freien Feld auszusteigen und nach Feierabend den kurzen Weg nach Hause zu gehen. Nach einiger Zeit hatte die Bahn ein Einsehen und schuf den Bahnhof Selm-Beifang als offizielle Haltestation. Im frühen 20. Jahrhundert wurden auch unterhalb von Selm Steinkohlevorkommen gefunden, die ab 1906 zum Bau der Zeche Herrmann führten. Seit 1909 wurde Kohle gefördert, und zwischen der Zeche Herrmann und der Burg Botzlar entstand als Bergbaukolonie mit der Hermann-Siedlung ein neues Ortszentrum. Bereits 1926 wurde die Zeche aber aus Rentabilitätsgründen wieder geschlossen und die Bergleute auf umliegende Bergwerke im Süden verteilt. Trotzdem geriet die Arbeitslosigkeit in Selm so hoch, dass die Gemeinde als ‚ärmste Gemeinde Deutschlands’ bis 1956 als Notstandsgemeinde galt.
Im frühen 20. Jahrhundert wurden auch unterhalb von Selm Steinkohlevorkommen gefunden, die ab 1906 zum Bau der Zeche Herrmann führten. Seit 1909 wurde Kohle gefördert, und zwischen der Zeche Herrmann und der Burg Botzlar entstand als Bergbaukolonie mit der Hermann-Siedlung ein neues Ortszentrum. Bereits 1926 wurde die Zeche aber aus Rentabilitätsgründen wieder geschlossen und die Bergleute auf umliegende Bergwerke im Süden verteilt. Trotzdem geriet die Arbeitslosigkeit in Selm so hoch, dass die Gemeinde als ‚ärmste Gemeinde Deutschlands’ bis 1956 als Notstandsgemeinde galt.
 In der Altstadt von Selm steht neben der hoch aufragenden Ludgerikirche etwas versteckt die Friedenskirche. Diese den beiden Heiligen Fabian und Sebastian geweihte ehemalige Pfarrkirche stammt ursprünglich aus dem 11. Jahrhundert, brannte aber im Jahre 1490 ab, wobei der Westturm bis heute erhalten blieb. Der Neubau wurde 1530 vollendet und zeichnet sich im Innenbereich durch seine reichhaltige Bemalung aus. Als nicht weit entfernt die Ludgerikirche im Jahre 1907 fertig gestellt wurde, verlor das alte Gemäuer seinen Status als Pfarrkirche, diente zwischenzeitlich als Lagerhalle und verfiel in der Folgezeit immer mehr. Zwischen 1963 und 1965 wurde die Kirche umfangreich renoviert und erhielt im Inneren eine Grabstätte eines im Zweiten Weltkrieg gefallenen unbekannten Soldaten. So erhielt das Gotteshaus den Namen ‚Friedenskirche’.
In der Altstadt von Selm steht neben der hoch aufragenden Ludgerikirche etwas versteckt die Friedenskirche. Diese den beiden Heiligen Fabian und Sebastian geweihte ehemalige Pfarrkirche stammt ursprünglich aus dem 11. Jahrhundert, brannte aber im Jahre 1490 ab, wobei der Westturm bis heute erhalten blieb. Der Neubau wurde 1530 vollendet und zeichnet sich im Innenbereich durch seine reichhaltige Bemalung aus. Als nicht weit entfernt die Ludgerikirche im Jahre 1907 fertig gestellt wurde, verlor das alte Gemäuer seinen Status als Pfarrkirche, diente zwischenzeitlich als Lagerhalle und verfiel in der Folgezeit immer mehr. Zwischen 1963 und 1965 wurde die Kirche umfangreich renoviert und erhielt im Inneren eine Grabstätte eines im Zweiten Weltkrieg gefallenen unbekannten Soldaten. So erhielt das Gotteshaus den Namen ‚Friedenskirche’.
 Im Stadtteil Bork befindet sich die von 1718 bis 1724 errichtete Stephanuskirche. Der Vorgängerbau war im Jahre 1699 niedergebrannt. Die St.-Stephanuskirche zeichnet sich durch den rechteckigen Zwiebelturm aus, der im nordwestdeutschen Raum sehr selten ist.
Im Stadtteil Bork befindet sich die von 1718 bis 1724 errichtete Stephanuskirche. Der Vorgängerbau war im Jahre 1699 niedergebrannt. Die St.-Stephanuskirche zeichnet sich durch den rechteckigen Zwiebelturm aus, der im nordwestdeutschen Raum sehr selten ist.
 Sie Synagoge in Selm-Bork gehört zu den wenigen erhaltenen Synagogen in Westfalen. Sie stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert und wurde bis 1939 in dieser Funktion genutzt. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich als Kohlenlager genutzt. Nach der Renovierung in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird das denkmalgeschützte Gebäude seit dem Jahre 2000 wieder als jüdisches Gotteshaus genutzt.
Sie Synagoge in Selm-Bork gehört zu den wenigen erhaltenen Synagogen in Westfalen. Sie stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert und wurde bis 1939 in dieser Funktion genutzt. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich als Kohlenlager genutzt. Nach der Renovierung in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird das denkmalgeschützte Gebäude seit dem Jahre 2000 wieder als jüdisches Gotteshaus genutzt.
Radrouten die durch Selm führen:
100 Schlösser Route – Südkurs
Römer-Lippe-Route
Burg- und Schloss-Tour
Rundkurs Ruhrgebiet
Olfen
lfen liegt im südlichen Münsterland nördlich der Lippe an der Stever und wurde 889 erstmals als Besitzung von Wolfhelm, damaliger Bischof von Münster, erwähnt. Beim ‚Großen Brand von Olfen’ wurde 1857 ein großer Teil des Ortes zerstört. Die gemütliche Kleinstadt gerät einmal im Jahr zur Karnevalszeit in den Ausnahmezustand. Unweit der St.-Vitus-Kirche erinnert der KITT-Brunnen an die lange Karneval-Tradition. Dieser besitzt eine eingebaute Bierzapfanlage, und so wird jedes Jahr zum Karneval die Wasseranlage in einen Bierbrunnen umfunktioniert. Am Nelkendienstag findet mit dem großen Umzug der Höhepunkt des närrischen Treibens statt, der alljährlich von Tausenden am Straßenrand verfolgt wird. Im Ortsteil Vinnum befindet sich mit dem Schloss Sandfort eine sehenswerte Schlossanlage, die auf das 15. Jahrhundert zurückgeht und später im barocken Stil umgestaltet wurde.
Sehenswertes:
 Das Schloss Sandfort liegt in einem idyllischen Waldstück auf halbem Wege zwischen Selm und Olfen. Es ist bemerkenswert gut erhalten und gliedert sich typisch münsterländisch in eine Vorburg mit Innenhof, Stallungen und Werkstatt, sowie einer Oberburg, die privat als Wohnung von der Familie Hagen-Plettenberg genutzt wird. Außerdem befindet sich hier die Verwaltung mit einigen Büros. Eine Zufahrt führt axial an den Gebäuden der Vorburg vorbei auf das Hauptportal zu, dass sich im untersten Stockwerk eines mächtigen viereckigen Turmes befindet, der die ganze Anlage beherrscht. Er steht direkt im Wasser der das Schloss umfließenden Gräfte, besitzt ohne Keller vier Stockwerke sowie eine geschwungene welsche Haube. Das Herrenhaus, wie auch der Turm wurde zunächst im Stil der Renaissance mit Ziegelsteinen und Sandsteingliederung erbaut, später im barocken Sinne umgestaltet. Eine Besonderheit auf der Vorburg ist das Brauhaus, welches im 15. oder 16. Jahrhundert erbaut wurde und somit den ältesten Gebäudeteil der Schlossanlage darstellt. Zu dieser Zeit besaß Sandfort das örtliche Bierbraumonopol. Das Brauhaus befindet sich auf der rechten Seite der Zufahrt, hinter den Stallungen an der Gräfte zur Oberburg. Dem gegenüber befindet sich das ehemalige Herrenhaus, welches kurze Zeit später entstanden sein muss und das nicht abgerissen wurde, als Anfang des 17. Jahrhunderts die neue Oberburg errichtet wurde. Das alte Herrenhaus liegt direkt an der Gräfte und besitzt zwei runde Ecktürme mit Kegelhauben, welche wie der Rest des Brauhauses aus Backsteinen besteht. Schmale, hochgezogene Schießscharten deuten auf die Wehrhaftigkeit des Schlosses hin. Hier befand sich bis ins vorletzte Jahrhundert die Hauptzufahrt über eine Zugbrücke. Schloss Sandfort ist heute die Deckstation des Westfälischen Landesgestüts Warendorf Die Vorburg darf ausdrücklich kurz betreten werden, die bewohnte Oberburg dagegen nicht. Aber es führen Wege nahezu um das ganze Schloss herum, so dass man die gesamte Anlage gut einsehen kann.
Das Schloss Sandfort liegt in einem idyllischen Waldstück auf halbem Wege zwischen Selm und Olfen. Es ist bemerkenswert gut erhalten und gliedert sich typisch münsterländisch in eine Vorburg mit Innenhof, Stallungen und Werkstatt, sowie einer Oberburg, die privat als Wohnung von der Familie Hagen-Plettenberg genutzt wird. Außerdem befindet sich hier die Verwaltung mit einigen Büros. Eine Zufahrt führt axial an den Gebäuden der Vorburg vorbei auf das Hauptportal zu, dass sich im untersten Stockwerk eines mächtigen viereckigen Turmes befindet, der die ganze Anlage beherrscht. Er steht direkt im Wasser der das Schloss umfließenden Gräfte, besitzt ohne Keller vier Stockwerke sowie eine geschwungene welsche Haube. Das Herrenhaus, wie auch der Turm wurde zunächst im Stil der Renaissance mit Ziegelsteinen und Sandsteingliederung erbaut, später im barocken Sinne umgestaltet. Eine Besonderheit auf der Vorburg ist das Brauhaus, welches im 15. oder 16. Jahrhundert erbaut wurde und somit den ältesten Gebäudeteil der Schlossanlage darstellt. Zu dieser Zeit besaß Sandfort das örtliche Bierbraumonopol. Das Brauhaus befindet sich auf der rechten Seite der Zufahrt, hinter den Stallungen an der Gräfte zur Oberburg. Dem gegenüber befindet sich das ehemalige Herrenhaus, welches kurze Zeit später entstanden sein muss und das nicht abgerissen wurde, als Anfang des 17. Jahrhunderts die neue Oberburg errichtet wurde. Das alte Herrenhaus liegt direkt an der Gräfte und besitzt zwei runde Ecktürme mit Kegelhauben, welche wie der Rest des Brauhauses aus Backsteinen besteht. Schmale, hochgezogene Schießscharten deuten auf die Wehrhaftigkeit des Schlosses hin. Hier befand sich bis ins vorletzte Jahrhundert die Hauptzufahrt über eine Zugbrücke. Schloss Sandfort ist heute die Deckstation des Westfälischen Landesgestüts Warendorf Die Vorburg darf ausdrücklich kurz betreten werden, die bewohnte Oberburg dagegen nicht. Aber es führen Wege nahezu um das ganze Schloss herum, so dass man die gesamte Anlage gut einsehen kann.
1290 Erstmalige Erwähnung eines Wasserschlosses, das im Besitz derer von Mecheln war und sich in unmittelbarer Umgebung der nicht mehr erhaltenen Burgen Rauschenberg, Rechede, Füchteln und Olfen befand. 16. Jhd. Bau des Brauhauses auf der linken Seite der Vorburg, kurze Zeit später wird das alte Herrenhaus erbaut. 17. Jhd. Anfang des Jahrhunderts endstand der mächtige, viereckige Turm des Herrenhauses, wahrscheinlich durch Melchior van Friedrich, einem holländischen Baumeister. 1695 Umbau des Herrenhauses im barocken Stil. Als Untergrund sich eicherne Pfosten neu in das Sumpfgelände geschlagen worden, da die alten langsam nachgegeben hatten. 1711 Erweiterung der Befestigungsanlagen sowie des Brückenturmes. 1719 Die Familie von Bodelschwingh-Plettenberg erwarb das Schloss. 1834 Umbau der Vorburg und Errichtung der Wirtschaftsgebäude. 1841 Der baufällig gewordene Turm wird restauriert und umgebaut. 1853 Abbau der Zugbrücke und Umgestaltung der Hauptzufahrt. Sie verläuft seitdem über eine Brücke axial auf das Hauptportal zu. Besitzer war zu diesem Zeitpunkt der Graf von Wedel. 1870 Gründung eines Holzpfahlrostes und Bau eines Gewächshauses auf dem Rost. 1912 Nach dem Abriss des Gewächshauses Anbau eines Küchentraktes mit Nebenräumen auf dem sanierten Holzpfahlrost. 1976 Da der Küchenanbau das harmonische Gesamtbild der Oberburg störte, ließ ihn der Graf von Hagen-Plettenberg wieder abreißen und stellte so den ursprünglichen Bauzustand wieder her.Geschichtlicher Ablauf
 Südlich von Olfen im Dorf Sülsen befindet sich die Ruine Rauschenberg. Von der einstigen stolzen Wasserburg sieht man heute nur noch die Reste der im 19. Jahrhundert verfallenen Wehranlage sowie Teile der Gräfte. Die 1326 erstmals erwähnte Rauschenburg diente der Sicherung der Lippe als Grenzfluss.
Südlich von Olfen im Dorf Sülsen befindet sich die Ruine Rauschenberg. Von der einstigen stolzen Wasserburg sieht man heute nur noch die Reste der im 19. Jahrhundert verfallenen Wehranlage sowie Teile der Gräfte. Die 1326 erstmals erwähnte Rauschenburg diente der Sicherung der Lippe als Grenzfluss.
 Die mächtige Pfarrkirche St.Vitus ist das Wahrzeichen von Olfen. Schon von weitem kann man ihren stolzen Kirchturm erblicken. Das Gotteshaus wurde 1888 an der Stelle einer Vorgängerkirche aus dem 15. Jahrhundert erbaut. Auf dem Kirchplatz befindet sich das Denkmal von Wolfhelm. Dieser war Bischof von Münster im ausgehenden 9. Jahrhundert und besaß umfangreiche Besitztümer in dieser Gegend, die er alle dem Kloster Werden schenkte. Aus dem Namen ‚Wolfhelm’ entwickelte sich der Name der Stadt ‚Olfen’.
Die mächtige Pfarrkirche St.Vitus ist das Wahrzeichen von Olfen. Schon von weitem kann man ihren stolzen Kirchturm erblicken. Das Gotteshaus wurde 1888 an der Stelle einer Vorgängerkirche aus dem 15. Jahrhundert erbaut. Auf dem Kirchplatz befindet sich das Denkmal von Wolfhelm. Dieser war Bischof von Münster im ausgehenden 9. Jahrhundert und besaß umfangreiche Besitztümer in dieser Gegend, die er alle dem Kloster Werden schenkte. Aus dem Namen ‚Wolfhelm’ entwickelte sich der Name der Stadt ‚Olfen’.
 Östlich von Olfen in der Siedlung Benthof befindet sich mit der Recheder Mühle ein weiteres historisches Mühlengebäude auf dem Stadtgebiet. Wie die Füchtelner Mühle gehörte auch die Recheder Mühle zu einem Adelssitz, der jedoch nicht mehr erhalten ist. Haus Rechede diente ursprünglich dem Fürstbischof von Münster, die Südgrenze seiner Herrschaft sichern zu lassen. Das Mühlengebäude aus dem 17. Jahrhundert liegt direkt an der Stever, wird aber nur noch als Wohngebäude genutzt.
Östlich von Olfen in der Siedlung Benthof befindet sich mit der Recheder Mühle ein weiteres historisches Mühlengebäude auf dem Stadtgebiet. Wie die Füchtelner Mühle gehörte auch die Recheder Mühle zu einem Adelssitz, der jedoch nicht mehr erhalten ist. Haus Rechede diente ursprünglich dem Fürstbischof von Münster, die Südgrenze seiner Herrschaft sichern zu lassen. Das Mühlengebäude aus dem 17. Jahrhundert liegt direkt an der Stever, wird aber nur noch als Wohngebäude genutzt.
 Haus Füchteln war im Mittelalter Stammsitz der Ritter von Kukelshem. Zu diesem Rittergut gehörte auch eine Mühle, die Anfang des 14. Jahrhunderts an der Stever errichtet wurde. Der heute erhaltene Mühlenbau stammt aus dem Jahre 1665. Im 19. Jahrhundert nutzte man die Mühle auch als Sägemühle, und aus dem benachbarten Gutshof wurde ein Gasthof und daraus ein Restaurant, welches bis heute besteht. Aus den beiden historischen Mühlengebäuden entstand eine Wohnhaus sowie ein Wasserkraftwerk.
Haus Füchteln war im Mittelalter Stammsitz der Ritter von Kukelshem. Zu diesem Rittergut gehörte auch eine Mühle, die Anfang des 14. Jahrhunderts an der Stever errichtet wurde. Der heute erhaltene Mühlenbau stammt aus dem Jahre 1665. Im 19. Jahrhundert nutzte man die Mühle auch als Sägemühle, und aus dem benachbarten Gutshof wurde ein Gasthof und daraus ein Restaurant, welches bis heute besteht. Aus den beiden historischen Mühlengebäuden entstand eine Wohnhaus sowie ein Wasserkraftwerk.
 Bei der Steveraue Olfen handelt es sich um eine 80 ha große renaturierte Auenlandschaft nördlich von Olfen. Die Stadt hatte einige zusammenhängende Flächen am Südufer der Stever erworben und naturnah zurückgebaut. Vorher waren diese landwirtschaftlich genutzt worden. Weitere Flächen sollen noch dazukommen. Heute ist die Steveraue ein stadtnahes Erholungsgebiet, das zum Spatzieren gehen einlädt. Die regionalen Radwanderwege ‚Steveraue Olfen’ und ‚…rund um Olfen’ führen durch das reizvolle Gebiet. Heckrinder, Wildesel und Koniks weiden hier in aller Ruhe und man kann Storche in ihren Nestern beobachten. Aussichtsplattformen bieten einen erhöhten Blick über die Auenlandschaft und Schautafeln erklären Details zu dem Projekt.
Bei der Steveraue Olfen handelt es sich um eine 80 ha große renaturierte Auenlandschaft nördlich von Olfen. Die Stadt hatte einige zusammenhängende Flächen am Südufer der Stever erworben und naturnah zurückgebaut. Vorher waren diese landwirtschaftlich genutzt worden. Weitere Flächen sollen noch dazukommen. Heute ist die Steveraue ein stadtnahes Erholungsgebiet, das zum Spatzieren gehen einlädt. Die regionalen Radwanderwege ‚Steveraue Olfen’ und ‚…rund um Olfen’ führen durch das reizvolle Gebiet. Heckrinder, Wildesel und Koniks weiden hier in aller Ruhe und man kann Storche in ihren Nestern beobachten. Aussichtsplattformen bieten einen erhöhten Blick über die Auenlandschaft und Schautafeln erklären Details zu dem Projekt.
 Zwischen Datteln und dem alten Hafenbecken von Olfen befindet sich die ‚Alte Fahrt’ des Dortmund-Ems-Kanals. Nördlich von Olfen wurde dieser teilweise abgetragen, kann aber auf der verbliebenen Seite weiterhin als Fuß- und Radweg genutzt werden. Von hier aus hat man einen weiten Blick über die Steverauenlandschaft. Vier historische Brücken haben sich noch erhalten: Die 1895 fertig gestellte ‚Kanalbrücke Alte Fahrt’ führt 18 m hoch über die Lippe. Drei Sandsteinbögen tragen auf einer Länge von 70 Metern den alten Kanal über den Fluss. Die ‚Schiefe Brücke’ führt im Stadtgebiet von Olfen die Oststraße unter der Alten Fahrt hindurch. Die 1894 bis 1897 gebaute Brücke bekam ihren Namen durch den flachen Einfahrtswinkel von nur 60° zu dem Kanalverlauf, der heute allerdings kein Wasser mehr führt. Auch im Bereich der ‚Kanalbrücke über die Stever’ befindet sich kein Wasser mehr im alten Brückentrog. Auch diese historische Brücke wurde 1894 aus Ruhrsandstein errichtet. Eine vierte Brücke führt nordöstlich von Datteln über die Pelkumer Strasse.
Zwischen Datteln und dem alten Hafenbecken von Olfen befindet sich die ‚Alte Fahrt’ des Dortmund-Ems-Kanals. Nördlich von Olfen wurde dieser teilweise abgetragen, kann aber auf der verbliebenen Seite weiterhin als Fuß- und Radweg genutzt werden. Von hier aus hat man einen weiten Blick über die Steverauenlandschaft. Vier historische Brücken haben sich noch erhalten: Die 1895 fertig gestellte ‚Kanalbrücke Alte Fahrt’ führt 18 m hoch über die Lippe. Drei Sandsteinbögen tragen auf einer Länge von 70 Metern den alten Kanal über den Fluss. Die ‚Schiefe Brücke’ führt im Stadtgebiet von Olfen die Oststraße unter der Alten Fahrt hindurch. Die 1894 bis 1897 gebaute Brücke bekam ihren Namen durch den flachen Einfahrtswinkel von nur 60° zu dem Kanalverlauf, der heute allerdings kein Wasser mehr führt. Auch im Bereich der ‚Kanalbrücke über die Stever’ befindet sich kein Wasser mehr im alten Brückentrog. Auch diese historische Brücke wurde 1894 aus Ruhrsandstein errichtet. Eine vierte Brücke führt nordöstlich von Datteln über die Pelkumer Strasse.
Radrouten die durch Olfen führen:
100 Schlösser Route – Südkurs
Rad-Route Dortmund-Ems-Kanal
Römer-Lippe-Route
Burg- und Schloss-Tour
Hohe Mark Route
Datteln
atteln liegt am nördlichen Rand des Ruhrgebietes, wo dieses in die grüne Wiesenlandschaft des Münsterlandes übergeht. Im Nordwesten befindet sich der Naturpark Hohe Mark mit der Haard. einem ausgedehnten Waldgebiet. Die Stadt besitzt den größten Kanalknotenpunkt der Welt. Hier treffen am Stadthafen der Datteln-Hamm-Kanal, Wesel-Datteln-Kanal, Rhein-Herne-Kanal und der Dortmund-Ems-Kanal mit seiner Alten und seiner Neuen Fahrt aufeinander und bilden eine einzigartige Wasserstraßen-Konstellation. Durch den Ausbau der Leinpfade kann man an fast allen Kanalufern spazieren gehen und Rad fahren.
Erstmals 1147 erwähnt, entwickelte sich Datteln im Mittelalter zu einem der größten Kirchspiele des Vests Recklinghausen. Teile der St. Amansuskirche stammen noch aus dem 13. Jahrhundert. Mit dem Schacht ‚An der Haard I’ wurde im Jahr 2001 die letzte Zeche in Datteln stillgelegt.
Sehenswertes:
 Das Kanalkreuz Datteln, auch Dattelner Meer oder Wasserstraßenkreuz Datteln genannt, ist der größte Kanalknotenpunkt der Welt. Hier treffen Datteln-Hamm-Kanal, Wesel-Datteln-Kanal, Rhein-Herne-Kanal und der Dortmund-Ems-Kanal aufeinander. Als erstes wurde 1899 der Dortmund-Ems-Kanal, damals noch auf seiner Ersten oder auch Alten Fahrt, eröffnet. Am Abzweig zum Wesel-Datteln-Kanal wurde später die Zweite oder auch Neue Fahrt errichtet. Der Wesel-Datteln-Kanal kam 1930 als letzter Kanal hinzu. Alle Wasserstraßen gruppieren sich um den Dattelner Hafen herum, der heute allerdings nicht mehr als Umschlagshafen, sondern nur noch als Anlegestelle für Sportboote sowie der Boote der Marinekameradschaft und des Reservistenvereins dient. Insgesamt umfassen die Wasserstraßen in Datteln eine Länge von 17 Kilometern. Die alten Leinpfade sind heute gut ausgebaut und dienen so der Naherholung, für Spaziergänger und natürlich für Radfahrer.
Das Kanalkreuz Datteln, auch Dattelner Meer oder Wasserstraßenkreuz Datteln genannt, ist der größte Kanalknotenpunkt der Welt. Hier treffen Datteln-Hamm-Kanal, Wesel-Datteln-Kanal, Rhein-Herne-Kanal und der Dortmund-Ems-Kanal aufeinander. Als erstes wurde 1899 der Dortmund-Ems-Kanal, damals noch auf seiner Ersten oder auch Alten Fahrt, eröffnet. Am Abzweig zum Wesel-Datteln-Kanal wurde später die Zweite oder auch Neue Fahrt errichtet. Der Wesel-Datteln-Kanal kam 1930 als letzter Kanal hinzu. Alle Wasserstraßen gruppieren sich um den Dattelner Hafen herum, der heute allerdings nicht mehr als Umschlagshafen, sondern nur noch als Anlegestelle für Sportboote sowie der Boote der Marinekameradschaft und des Reservistenvereins dient. Insgesamt umfassen die Wasserstraßen in Datteln eine Länge von 17 Kilometern. Die alten Leinpfade sind heute gut ausgebaut und dienen so der Naherholung, für Spaziergänger und natürlich für Radfahrer.
Die Stadt Datteln wird geprägt durch die St. Amaduskirche. Der Turm des Gotteshauses entstammt noch dem 13. Jahrhundert. Die restliche Bausubstanz ist aber jüngeren Datums, da die Kirche während des Zweiten Weltkrieges weitgehend zerstört wurde.
Der erste Vorgängerbau an diesem Ort war vermutlich eine Holzkirche, die bereits im 9. Jahrhundert errichtet wurde. Als besonders sehenswert gilt das romanische Amanduskreuz, ein 1m hohes Kruzifix aus Eichenholz, welches auf das 12. Jahrhundert datiert wird. An ihm hängt ein über den Tod triumphierender Christus.
Im Dorfschultenhof, einem fast zweihundert Jahre alten Fachwerkgebäude, das früher als Bauerhof diente und in der Form eines dreischiffigen, westfälischen Hallenhauses errichtet wurde, befindet sich seit 1936 ein städtische Museum. Es beheimatet eine umfangreiche Sammlung zur Geschichte der Stadt sowie das frei zugängliche Stadtarchiv. Sammlungsschwerpunkte sind frühgeschichtliche Funde aus Stein-, Bronze und Eisenzeit, die Geschichte Dattelns vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, die Kirchengeschichte sowie die Entwicklung von Handel und Handwerk.
Das Museum beherbergt die ältesten Gussstahlglocken Deutschlands. Im alten Backhaus neben dem Museum wird mehrmals im Jahr zu besonderen Anlässen Steinofenbrot gebacken.
Das Rathaus von Datteln ist ein imposantes Bauwerk, das sich etwas abseits der Stadt befindet. Durch den enormen Bevölkerungszuwachs, der im Zuge der Industrialisierung Anfangs des 20. Jahrhunderts zu verzeichnen war, wurde ein größeres Amtshaus notwendig. Es entstand in den Jahren 1912/13.
Um das Rathaus herum wurde der ‚Dattelner Baumpfad’ angelegt. Dessen außergewöhnlichstes Gehölz ist ein Urweltmammutbaum, der einen Stammdurchmesser von bis zu 2 Metern und eine Höhe von bis zu 50 Metern erreichen kann. Der Baum gilt heute als lebendes Fossil.
 Das Haus Vogelsang ist eine mittelalterliche Wasserburganlage im Stadtteil Ahsen unweit der Lippe. Die heute nicht mehr erhaltene Hauptburg wurde auf einem künstlichen Erdhügel, einer so genannten Motte errichtet und war lange Zeit im Besitz der Herren von Trickel. Heute ist nur noch ein Gebäude der Vorburg aus dem 18. Jahrhundert erhalten. Der zweigeschossige Bau aus der Barockzeit besitzt einen auffälligen quadratischen Eckturm mit einer geschweiften Haube.
Das Haus Vogelsang ist eine mittelalterliche Wasserburganlage im Stadtteil Ahsen unweit der Lippe. Die heute nicht mehr erhaltene Hauptburg wurde auf einem künstlichen Erdhügel, einer so genannten Motte errichtet und war lange Zeit im Besitz der Herren von Trickel. Heute ist nur noch ein Gebäude der Vorburg aus dem 18. Jahrhundert erhalten. Der zweigeschossige Bau aus der Barockzeit besitzt einen auffälligen quadratischen Eckturm mit einer geschweiften Haube.
Radrouten die durch Datteln führen:
Radroute Dormund-Ems Kanal
Römer-Lippe Route
Rundkurs Ruhrgebiet
Haltern am See
altern am See liegt am Mündungsbereich der Stever in die Lippe am nördlichen Ruhrgebiet und wird geprägt durch den Halterner Stausee. Dieser dient sowohl der Trinkwassergewinnung als auch als Naherholungsgebiet für das gesamte Ruhrgebiet und zieht im Sommer täglich tausende von Ausflüglern aus dem Umland an. In der unmittelbaren Umgebung Halterns befinden sich mit der Haard, der Hohen Mark und den Borkenbergen naturgeschützte weitläufige Wald- und Heidelandschaften, so dass die Region auch oft als ‚grüne Lunge des Ruhrgebietes’ bezeichnet wird. Das hiesige Wasserwerk versorgt 2 Millionen Menschen mit Trinkwasser und gilt damit als das Größte Europas. Die Geschichte Halterns ist über 2000 Jahre alt. Hier befand sich zu Zeiten von Kaiser Augustus einer der wichtigsten militärischen Stützpunkte des Römischen Reiches mit entsprechend vielen hier stationierten Legionären. An der Stelle des einstigen Feldlagers befindet sich heute das LWL-Römermuseum, welches eine Vielzahl von Grabungsfunden präsentiert und das alltägliche Leben der römischen Legionäre erfahrbar macht. Im Mittelalter hatte Haltern durch die geographische Lage an der Lippe, wo sich die Grenze zwischen Westfalen und dem Rheinland befand, eine bedeutende, strategische Rolle inne. Bereits im Jahr 1289 erhielt es die Stadtrechte und somit das Recht, einen befestigten Schutzwall zu errichten. Bis 1929 gehörte die münsterländisch geprägte Stadt dem Kreis Coesfeld an, dann wurde sie dem Kreis Recklinghausen zugeschlagen. Seit dem Jahre 2001 trägt Haltern den Zusatz ‚am See’.
Sehenswertes:
Vom ehemaligen Wasserschloss Sythen, nördlich vom Haltener Stausee im gleichnamigen Stadtteil gelegen, sind nur noch zwei Gebäudeteile erhalten. Das schlichte Torhaus aus dem 17. Jahrhundert besitzt einen Rundbogendurchgang, die Zufahrt davor lässt noch eine ehemalige Brücke über eine inzwischen zugeschüttete Gräfte erahnen. Der untere Teil des Torhauses besteht aus altem Bruchstein, darüber schließt sich roter Backstein an. Mehrere Schießscharten belegen die einstige Wehrhaftigkeit der Burg. Im hinteren Bereich schließt sich ein Fachwerk an. Etwas zurückversetzt steht noch ein weiteres, freistehendes Gebäude. Die Außenwand besteht auch hier im unteren Teil aus Bruchstein, weiter oben aus roten Backsteinen. Die gesamte Fassade trägt Spuren von Veränderungen: Fenster wurden versetzt, Stellen am Mauerwerk wurden ausgebessert. Im Jahre 1971 wurde das Herrenhaus abgerissen, um ein modernes Erholungsheim bauen zu können. Dieses Vorhaben wurde letztlich nicht realisiert, das Haupthaus des Schlosses ging damit unwiderruflich verloren.
Geschichtlicher Ablauf
|
758 |
Unter König Pippin wir die Burg Sythen erstmalig urkundlich als ‚Sitina’ erwähnt. Als germanische Wallburg war sie am Krieg zwischen Sachsen und Franken beteiligt. |
|
805 |
Karl der Große übergibt Liudger, dem ersten Bischof von Münster, weitreichenden Besitzungen, darunter auch Burg Sythen. |
|
1268-1301 |
Ritter Diederich ist als Bewohner der Anlage belegt. |
|
1301-1450 |
Die Ritter von Hagenbeck bewohnen die Burg. |
|
1331 |
Erstmalige Erwähnung der wassermühle als Bestandteil der Burganlage. |
|
1450 |
Übernahme der Burganlage durch Johan von Besten. |
|
1530 |
Konrad von Ketteler zu Assen übernimmt das Anwesen durch Heirat. |
|
1704 |
Die Schlossanlage fällt an Anton von Galen zu Bisping durch Heirat. |
|
1728 |
Der Besitz fällt an Christian Franz von Fürstenberg durch Heirat. |
|
1821-1965 |
Schloss Sythen wird von der Familie der Grafen von Westerholt und Gysenberg übernommen. |
|
1946 |
Verpachtung an den Caritasverband Recklinghausen. Dieser richtet auf dem Schloss ein von Oberschwestern betriebenes Kindererholungsheim ein. |
|
1965 |
Der Caritasverband Recklinghausen erwirbt Schloss Sythen. |
|
1971 |
Abriss des Herrenhauses. Geplante Bauvorhaben wurden aber nicht realisiert. |
|
1979 |
Verkauf des Besitzes an den Makler Winfried Humberg. |
|
1989 |
Kauf der inzwischen stark verfallenen Anlage durch die Stadt Haltern. |
Im Halterner Stadtteil Lippramsdorf liegt unten an der Lippe das Haus Ostendorf. Erhalten haben sich nur noch ein Teil der Wirtschaftsgebäude, das Herrenhaus wurde 1934 bei einem Großbrand vernichtet und nicht wieder aufgebaut. Nähert man sich der Anlage von der höher gelegenen Freiheit aus, fällt einem gleich die wuchtige Vorburg auf. Sie lässt erahnen, welche Ausmaße die gesamte Burganlage einmal gehabt haben muss. Das lang gestreckte, einstöckige Wirtschaftsgebäude wird flankiert von zwei mächtigen Türmen. Der linke Turm besitzt eine Durchfahrt auf den Innenhof, der einst zum Herrenhaus führte. Die Gebäude dort sind neueren Datums, die gesamte Anlage ist im privaten Besitz.
Geschichtlicher Ablauf
|
1316 |
Ritter Bernhard Bitter und seine Frau Getrude von Ostendorf machen die Burg zum Offenhaus für den Bischof von Münster. So wurde das Rittergut zum Lehnsbesitz des Bischofs von Münster, was es bis in das 19. Jahrhundert hinein blieb. Im Gegenzug erhielt der Ritter Ländereien zum Lehen. |
|
1325 |
Übernahme der Wasserburg durch die Herren von Raesfeld zu Ostendorf durch Heirat. Die Familie von Raesfeld blieb über 400 Jahre im Besitz des Gutes. |
|
1803-1815 |
Haus Ostendorf ist Lehn der Fürsten Salm-Salm, Landesherr im Amt Ahaus. |
|
1825 |
Graf August Ferdinand von Merfeldt zu Lembeck übernimmt Haus Ostendorf. |
|
1934 |
Das Herrenhaus brennt vollständig ab und wird nicht wieder aufgebaut.
Die Gewerkschaft Auguste Viktoria erwirbt die Reste des Anwesens und die Ländereien für den Ausbau der Aussenschachtanlage. |
| Haus Ostendorf ist heute im Privatbesitz. |
Bei heißem Wetter im Sommer hat man das Gefühl, dass das ganze Ruhrgebiet zum Haltener Stausee hinaus fährt. Der See ist ein viel genutztes Naherholungsziel und besitzt einen etwa 1000 m langen Sandstrand. Hier kann man baden und schwimmen, segeln und surfen, Tret- und Ruderboot fahren. Um den See herum sorgen Restaurants und Cafés für das leibliche Wohl, mehrere Campingplätze bieten Übernachtungsmöglichkeiten. Das 182 personen fassende Fährgastschiff ‚Möwe’ bietet während der Sommermonate stündlich Rundfahrten auf dem See an. Anlegestellen sind ‚Seehof’, ‚Stadtmühle’ und ‚Haus Niemen’.
Der offiziell Stevertalsperre Haltern genannte Bereich besteht aus zwei Seen: dem Südsee und dem größerem Nordsee, der sogar eine 30 ha großen Insel besitzt. Obwohl der Stausee zur Trinkwasserversorgug genutzt wird, sind Freizeitaktivitäten erlaubt. Das liegt daran, dass nur versickertes und gefiltertes Wasser entnommen wird. Die Talsperre versorgt weite Teile des Westmünsterlandes sowie des nördlichen Ruhrgebietes mit Trinkwasser. Mit Ausnahme des Fährgastschiffes Möwe, sowie Boote des Betreibers Gelsenwasser und der DLRG sind keine Motorboote erlaubt.
Der Haltener Stausee wurde bereits 1930 erbaut, 1972 aber von der Größe her auf ein Volumen von 20,5 Millionen m3 Wasser verfünffacht. Er wird aus dem Fluß Stever gespeist, seine Staumauer hat eine Länge von 1300 Meter und eine Höhe von 8,9 Metern. Kurz nach dem Abfluss über die Staumauer mündet die Stever in die Lippe.
Ungefähr 2 km oberhalb des Halterner Stausees befindet sich mit dem Hullener See ein weiterer, etwas kleinerer Stausee. Auch er wird zur Trinkwassergewinnung genutzt. Die Talsperre Hullern lädt zum Spatzieren gehen ein, hier geht es bedeutend ruhiger zu als an der Talsperre Haltern.
Zwischen Dülmen und Haltern befindet sich der Seenverbund der Silberseen. Einige der Seen sind als Naturschutzgebiete ausgewiesen, der Silbersee IV dient Quarzsandgewinnung. Darüber hinaus sind die Silberseen ein viel frequentiertes Naherholungsgebiet. Der Silbersee II besitzt im südlichen Teil einen 800 Meter langen Sandstrand und zählt an heißen Spitzentagen bis u 15.000 Badegäste. Neben dem Surfen ist in bestimmten Bereichen auch FKK erlaubt.
Was viele nicht wissen: vor 2000 Jahren waren in Germanien mehr römische Legionäre stationiert als irgendwo sonst im gesamten römischen Reich. Entlang der Lippe entstanden zahlreiche römische Feldlager für Tausende von Legionären. Das Römerlager Haltern zählte zu den wichtigsten Stützpunkten des Römischen Reiches. 28 Jahre lang hielten sich die Römer in Germanien auf, bis sie durch die so genannte Varusschlacht im Jahre 9. nach Christus jäh vertrieben bzw. ausgelöscht wurden. Um diesen Tatsachen gerecht zu werden, und um die Geschichte der Römer in Westfalen lebendig werden zu lassen, entstand auf dem Gelände des ehemaligen Feldlagers Haltern das Römermuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). In dem 1993 fertig gestellten Museum werden auf 1000 m2 Ausstellungsfläche Funde aus allen Römerlagern an der Lippe gezeigt. Man erhält einen Überblick über das tägliche Leben der Legionäre und erfährt etwas über die Lippe als unentbehrlichen Transport- und Versorgungsweg. Die Ausgrabungen finden seit dem Jahre 1899 statt und ein erstes Römisch-Germanisches Museum war bereits 1907 eröffnet worden. Dem heutigen flachen Museumsbau sind gläserne Lichtkuppeln aufgesetzt, die an ein römisches Zeltlager erinnern sollen.
An der nördlichen Seite des viel belebten, zentralen Marktplatzes befindet sich das Alte Rathaus. Es wurde in den Jahren 1575 -1577 errichtet, nach schweren Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg jedoch nur vereinfacht wieder aufgebaut. Die Giebel besitzen den typisch münsterländischen Dreistaffelgiebel, an einem zusätzlichen Giebel zur Marktseite befinden sich ein Glockenspiel mit 15 Glocken, eine Uhr und darunter das Stadtwappen. Das Erdgeschoß des zweistöckigen Gebäudes besitzt an der Hauptfront einen Arkadengang mit Spitzbögen.
Das Alte Rathaus wird auch heute noch für standesamtliche Trauungen genutzt, darüber hinaus dienen die historischen Räumlichkeiten kulturellen Veranstaltungen sowie ordentlichen Empfängen.
Am zentralen Marktplatz Halterns befindet sich die katholische Stadtkirche St. Sixtus. Die nach einem Papst und Märtyrer aus dem 3. Jahrhundert benannte dreischiffige Hallenkirche wurde 1879 im neugotischen Stil errichtet, besaß aber an gleicher Stelle mehrere Vorgängerbauten. Bereits im 9. Jahrhundert stand hier wohl eine Holzkirche, später ein romanischer Steinbau. Das im Inneren des Gotteshauses bewahrte Gabelkruzifix stammt wohl bereits aus der Zeit um 1340. Darüber hinaus sind das Antwerpener Retabel, ein Flügelaltar vom Anfang des 16. Jahrhunderts sowie das im Jahre 1710 errichtete Epitaph von Galen beachtenswert.
Der Siebenteufelsturm ist das einzige Relikt der mittelalterlichen Stadtbefestigung, die bereits im 18. Jahrhundert wieder abgetragen wurde. Der 1502 fertig gestellte Rundturm besitzt einen Spitzbogenfries und wurde aus Ziegelsteinen errichtet.
Im Halterner Ortsteil Lippramsdorf befindet sich das Heimathaus Lippramsdorf. Das niederdeutsche Bauernhaus stammt vermutlich bereits aus dem 16. Jahrhundert. Noch bis 1974 wurde es bewirtschaftet. Inzwischen wurde es vom Heimatverein Lippramsdorf liebevoll renoviert und dient seit 1995 als kulturelle Begegnungsstätte für Lesungen, Konzerte, Ausstellungen und Heimatabende. Im Dachgeschoß wurde ein kleines Handwerksmuseum eingerichtet.
Flaesheim, ein Ortsteil der Stadt Haltern am See, liegt direkt am Wesel-Datteln Kanal und an der Lippe. Die ehemalige Stiftskirche wurde im 12. Jahrhundert im romanischen Stil erbaut und später gotisch ergänzt. Zunächst diente sie als Kirche eines Prämonstratenser-Nonnen-Klosters, der im Zuge der Reformation im Jahre 1550 zu einem freiweltlichen Damenstift umgewandelt wurde, das noch bis 1803 bestand.
Zur heutigen Ausstattung gehört ein prächtiger Hochaltar aus Sandstein, Marmor und Alabaster aus dem Jahre 1658.
Radrouten die durch Haltern am See führen:
100 Schlösser Route – Westkurs
Römer-Lippe-Route
Rundkurs Ruhrgebiet
Hohe Mark Route
Marl
arl ist als Stadt noch recht jung und das Leben hier wird von dem riesigen Chemiepark bestimmt. Noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts besaß das damalige Heidedorf gerade einmal 4.500 Einwohner. Der Chemiepark prägt die jüngere Geschichte der Stadt und ist Ankerpunkt auf der Straße der Industriekultur. So findet man in der Stadt neben jahrhundertealten Fachwerkbauten in Alt-Marl auch Arbeiter- und Zechensiedlungen, die den typischen Charme des Ruhrgebietes wiederspiegeln. Nach Norden wechselt die Landschaft vollständig und unmittelbar, schließlich liegt die Stadt am Südrand der Haard und des Naturparks Hohe Mark-Westmünsterland.
Marl bietet eine abwechslungsreiche Museumsauswahl. Das Skulpturenmuseum Glaskasten präsentiert eine interessante Ausstellung mit Werken aus der klassischen Moderne und aus der zeitgenössischen Kunst. In einem ehemaligen Erzschacht wurde ein Bergbaumuseum eingerichtet und das Stadt- und Heimatmuseum, das sich in einer alten Wassermühle befindet, gibt einen Überblick über die Wohnverhältnisse im 17. Jahrhundert.
In Marl wird alljährlich der Grimme-Preis verliehen. 2009 wurde Marl mit dem Titel ‚Ort der Vielfalt‘ ausgezeichnet.
Sehenswertes:
Der heutige Chemiepark wurde 1938 als ‚Chemische Werke Hüls GmbH‘ gegründet. Anfänglich wurde hier synthetischer Kautschuk für Autoreifen hergestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden hier Kunststoffe und Rohstoffe für Waschmittel. Inzwischen hat sich das Industriegelände zu einem umfangreichen Dienstleistungs- und Produktionspark verschiedener Firmen entwickelt und bietet rund 10.000 Beschäftigten Arbeit. Er ist heute der drittgrößte Verbund-Standort Deutschlands und erstreckt sich über eine Fläche von 6,5 km². Der Park besitzt ein Rohrleitungsnetz von 1200 km und ein Kanalnetz von 70 km. Das Schienennetz ist 120 km lang und besitzt einen eigenen Frachtbahnhof. Drei eigene Kraftwerke liefern Strom für die über 100 Produktionsbetriebe und rund 900 Gebäude.
Am historischen Feierabendhaus gibt es eine Ausstellung über die Geschichte und die Gegenwart des Chemieparks. Bei einer Werksführung kann man auch auf das neustöckige Hochhaus steigen, von dem man einen überwältigenden Blick über die gigantische Industrieanlage hat. Der Chemiepark ist der einzige noch in Betrieb befindliche Ankerpunkt der Route der Industriekultur.
Unter dem Sitzungstrakt des Marler Rathauses befindet sich das gänzlich mit Glas umbaute Skulpturenmuseum. Die Sammlung umfasst Skulpturen der klassischen Moderne und der zeitgenössischen Kunst, aber auch Bildhauerzeichnungen, dreidimensionale Arbeiten und Installationen. Berühmte Künstler, wie Auguste Rodin, Max Ernst, Jean Arp, Alberto Giacometti und Bernhard Heiliger sind in der Ausstellung vertreten. Bereits im weiteren Außenbereich sind mehr als 70 Objekte aufgestellt. Der Glaskasten soll Offenheit und Transparenz versinnbildlichen: Kunst soll nicht hinter dicken Mauern verschwinden, sondern sichtbar für jedermann sein. Zum Museum gehört auch die städtische Paracelsus-Klinik, deren Sammlung von Bildern des 20. Jahrhunderts inzwischen auf über 300 Werke angewachsen ist.
Im Ruhrgebiet wurde nicht nur Kohle gefördert, sondern auch Erz. In Marl wurde zwischen 1938 und 1962 Blei, Zink und Silber gefördert. Das Gelände des einstigen Erzschachtes 4/5 ist heute als kleines Museum zu besichtigen. Im Fördermaschinenhaus ist eine Ausstellung mit Uniformen, Fotos und Bergbau-Utensilien eingerichtet. Auf dem Außengelände ist neben alten Bergbau-Gerätschaften auch das Strebengerüstes von 1930/31 zu sehen.
Noch bis Ende 2015 wird hier Kohle gefördert. Danach wird auch diese Schachtanlage endgültig stillgelegt. Für Besucher steht schon heute am Schacht 8 eine Infostrecke zur Verfügung, die den modernen Kohleabbau demonstriert. Die Ruhrkohle AG wird dem Heimatverein diese Infostrecke überlassen, so dass die kleine Sammlung am Erzschacht danach zu einem größeren Bergbaumuseum ausgebaut werden kann.
In einer alten, aber immer noch vollständig funktionsfähigen Wassermühle aus dem 17. Jahrhundert, befindet sich im Volkspark von Alt-Marl das Heimatmuseum. Die Mühle war bis 1927 in Betrieb und wurde 1953 noch einmal vollständig restauriert. Das Museum, zu dem auch noch Räume in der nahe gelegenen Schererschen Villa gehören, beschreibt die Geschichte der Stadt Marl, zeigt die Wohnverhältnisse im 17. bis 19. Jahrhundert sowie altertümliche Werkzeuge, vornehmlich aus der häuslichen und kleinindustriellen Textilproduktion. Im Keller der Mühle wurde ein Strebausbau der Zeche Auguste Victoria rekontruiert.
Marl ist keine historisch gewachsene Stadt, sondern entstand durch das Zusammenwachen alter Dörfer mit der Arbeitersiedlungen der Zechen und des Chemiewerkes. Ein wirkliches Zentrum gab es zunächst nicht. So wurde in den 1960er Jahren ein neues Stadtzentrum auf dem Reißbrett geplant. Auf der grünen Wiese entstanden das Rathaus, das Einkaufszentrum ‚Marler Stern‘ und mehrere Wohnhochhäuser.
Der Bau des Rathauskomplexes wurde bei einem Architekturwettbewerb im Jahre 1957 ausgelobt. Es entstand in den 1960er Jahren nach Plänen von Johan Hendrik van den Broek und Jacob Berend Bakema und gliedert sich in einen Ratstrakt, einem zentralen mit Marmor verkleideten Publikumsgebäude und in die beiden Bürotürme. Auf dem Vorplatz wurde ein modernes Wasserbecken angelegt. Die Stahlbetonbauten besitzen mit ihren Aluminiumfassaden eine kühle Eleganz. Ihre außergewöhnliche Formbebung soll Offenheit und Anti-Autorität versinnbildlichen.
Als 1938 die Chemischen Werke Hüls entstanden, aus denen später der Chemiepark Marl wurde, baute man gleichzeitig nahe des Werkes eine Siedlung mit Platz für 448 Familien. Die hier immer noch stehenden Bunker waren für Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg erbaut.
Südwestlich der Bereitschaftssiedlung befindet sich die Siedlung Brassert. Sie entstand ab 1906 für die Bergarbeiter der gleichnamigen Zeche, auf der in den 50er Jahren bis zu 5.000 Menschen arbeiteten. 1972 wurde das Bergwerk geschlossen und heute befindet sich auf dem Gelände ein Freizeitpark. Wenige der Zechengebäude sind noch erhalten, darunter die einstige Markenkontrolle. Sie beherbergt heute das Fahrradbüro der Stadt Marl.
Südlich des Wesel-Datteln-Kanal, unweit des Chemieparks Marl, erhebt sich die Halde Brassert III, auch ‚Lipper Höhe‘ genannt, über das umliegende Gelände. Zwischen 1955 und 1992 wuchs die Abraumhalde durch das Bergematerial der Zechen Brassert und Leopold auf eine Höhe von 51 Metern gegenüber der Umgebung und 88 Metern über dem Meeresspiegel. Seit 1978 wird der künstliche Berg renaturiert und bildet heute ein ökologisch wichtiges Refugium. Die Lipper Höhe bietet oben am grünen Gipfelkreuz einen weiten Blick über das Ruhrgebiet und das angrenzende Münsterland.
Das Bergwerk, das nach der letzten deutschen Kaiserin Auguste Victoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1858-1921) benannt wurde, nahm 1905 am Schacht AV1 die Steinkohleförderung auf. Bis heute gehört sie zu den ertragsreichsten Förderstandorten der Deutschen Steinkohle AG. Dennoch wird Ende 2015 auch hier der Betrieb eingestellt. Die beiden abgestrebten Fördertürme von Schacht ½ stammen noch aus der Gründungszeit des Bergwerkes.
Zwischen 1938 und 1962 wurden hier nicht nur Kohle, sondern auch Blei, Zink und Silber gefördert. Nördlich des Wesel-Datteln-Kanals erhebt sich von Weitem sichtbar das große grüne A-förmige Stahlgerüst vom Schacht 8 über die Lippeaue. Der Versorgungsschacht führt hier in eine Tiefe von 1.300 Metern.
Radrouten die durch Marl führen:
Dorsten
ie ehemalige Hansestadt Dorsten liegt südlich der Lippe im nördlichen Ruhrgebiet am Rande zum Münsterland. Das im Renaissancestil erbaute Rathaus dominiert den zentralen Marktplatz und erinnert noch an die alte Hansezeit. Bereits im Jahre 1251 hatte Dorsten das Stadtrecht erhalten. Bereits vor über 2000 Jahren hatte es hier mit dem Römerlager Holsterhausen einen bedeutenden Stützpunkt der Römer im damaligen Germanien gegeben. Das Bergwerk Fürst Leopold, welches Arbeitgeber für tausende von Dorstener war, stellte im Jahre 2001 die Förderung ein. Die Siedlung Fürst Leopold im Ortsteil Hervest gilt als eine der schönsten Gartenstadt-Kolonien des Ruhrgebietes. Mit der Angliederung der ‚fürstbischöflich-münsterischen Herrlichkeit Lembeck’ im 20. Jahrhundert gehört zu Dorsten im Norden auch ein Stück dörflich geprägtes Münsterland.
Sehenswertes:
 Das Schloss Lembeck gehört zu den schönsten und bedeutendsten Schlössern im Münsterland. Ende des 17. Jahrhunderts in seiner heutigen Form erbaut, liegt es im nördlichen Teil des Landkreises Recklinghausen zwischen den Ortschaften Wulfen und Lembeck. Die imposante Schlossanlage wurde auf zwei Inseln errichtet. Eine lang gezogene Wegachse führt geradewegs auf das Schloss zu, durch das Torhaus der Vorburg hindurch, durch eine gewölbte Durchfahrt der Oberburg hindurch, durch die Parkanlage bis zum Parkausgangstor. Dabei überquert sie mehrere Brücken. Die gesamte Anlage ist symmetrisch entlang dieser Achse angelegt worden. Die Flügel von Vor- und Oberburg wurden hier nicht nach vorne gebaut, wie sonst häufig bei barocken Dreiflügelanlagen, sondern sie führen einrahmend nach hinten, so dass sich eine fast zu allen Seiten geschlossene Schlossanlage ergibt. Die Hauptburg war als symmetrische Dreiflügelanlage geplant, aber aus nicht bekannten Gründen wurde Schloss Lembeck nicht vollendet und verblieb so als Zweiflügelanlage. Beachtenswert sind die Ecktürme mit ihrer welschen Haube sowie das von Johann Conrad Schlaun geschaffene hintere Barocktor mit den Wappen haltenden Putten. Schlaun schmückte auch den Großen Saal, den mit 120m² größten Raum von Schloss Lembeck, im spätbarocken Stil aus. Im Stockwerk darüber befindet sich eine Galerie mit einer ständigen Ausstellung des Malers Hanns Hubertus Graf von Merveld, ein Mitglied der das Schloss besitzenden Familie. Darüber hinaus werden Sonderausstellungen zu Themen zeitgenössischer Kunst präsentiert. Im Dachgeschoß befindet sich zusätzlich noch ein Heimatmuseum.
Das Schloss Lembeck gehört zu den schönsten und bedeutendsten Schlössern im Münsterland. Ende des 17. Jahrhunderts in seiner heutigen Form erbaut, liegt es im nördlichen Teil des Landkreises Recklinghausen zwischen den Ortschaften Wulfen und Lembeck. Die imposante Schlossanlage wurde auf zwei Inseln errichtet. Eine lang gezogene Wegachse führt geradewegs auf das Schloss zu, durch das Torhaus der Vorburg hindurch, durch eine gewölbte Durchfahrt der Oberburg hindurch, durch die Parkanlage bis zum Parkausgangstor. Dabei überquert sie mehrere Brücken. Die gesamte Anlage ist symmetrisch entlang dieser Achse angelegt worden. Die Flügel von Vor- und Oberburg wurden hier nicht nach vorne gebaut, wie sonst häufig bei barocken Dreiflügelanlagen, sondern sie führen einrahmend nach hinten, so dass sich eine fast zu allen Seiten geschlossene Schlossanlage ergibt. Die Hauptburg war als symmetrische Dreiflügelanlage geplant, aber aus nicht bekannten Gründen wurde Schloss Lembeck nicht vollendet und verblieb so als Zweiflügelanlage. Beachtenswert sind die Ecktürme mit ihrer welschen Haube sowie das von Johann Conrad Schlaun geschaffene hintere Barocktor mit den Wappen haltenden Putten. Schlaun schmückte auch den Großen Saal, den mit 120m² größten Raum von Schloss Lembeck, im spätbarocken Stil aus. Im Stockwerk darüber befindet sich eine Galerie mit einer ständigen Ausstellung des Malers Hanns Hubertus Graf von Merveld, ein Mitglied der das Schloss besitzenden Familie. Darüber hinaus werden Sonderausstellungen zu Themen zeitgenössischer Kunst präsentiert. Im Dachgeschoß befindet sich zusätzlich noch ein Heimatmuseum.
Geschichtlicher Ablauf
|
1017 |
Verfügung des Laibrechtes über den Ort Lembeck durch den Ottonischen Kaiser Heinrich II. zugunsten des Paderborner Domes. |
|
1177 |
Erstmalige urkundliche Erwähnung der Herren von Lembeck |
|
Um 1230 |
Bezeichnung des Besitzers des Haupthofes von Lembeck als Ritter und als Ministerialer des Landes. Verwandt waren diese mit den Herren von Gemen und Raesfeld. Bei kriegerischen Streitigkeiten verbündeten sie sich miteinander. |
|
14. Jhd. |
Erichtung eines Zwei-Kammer-Hauses auf einer Motte |
|
15. Jhd. |
Ausbau zum Drei-Kammer-Haus mit Turm. Die Turmhügelburg wurde bereits als ‚Herrlichkeit’ bezeichnet. |
|
1528 |
Mit Johann von Lembeck starb das Familiengeschlecht aus. Übernahme der Herrlichkeit Lembeck durch Bernhard von Westerholt, einem Vertrauten des Fürstbischofs von Münster. Seine Kinder jedoch traten später zum Kalvinismus über und wenden sich damit vom Fürstbischof ab. |
|
1621 |
Nach der Gegenreform findet der erste katholische Gottesdienst auf Lembeck statt. |
|
1670-92 |
Ausbau der Hauptburg zur barocken Zwei-Flügel-Anlage unter Dietrich Dietrich Conrad Adolf von Westerholt-Hackfurt. Die südlichen Bauten entstanden sowie zwei Pavillontürme. Die Fassade wurde angeglichen. |
|
1702 |
Mit dem Tode von Dietrich Conrad Adolf von Westerolt-Hackfurt starb auch die männliche Linie des Familiengeschlechtes aus. |
|
1708 |
Ferdinand Dietrich Freiherr von Merveldt zu Westerwinkel übernimmt das Schloss Lembeck. |
|
1726 |
Stiftung der Michaeliskirche in Lembeck durch die Witwe des letzten Westerholt-Hackfurt. Erbaut wurde sie durch den berühmten westfälischen Barockbaumeister Johann Conrad Schlaun, der auch verantwortlich war für die Innenausstattung des großen Saales sowie die Wappen haltenden Putten im Schlossgarten. |
|
1804 |
Anlegung der Gartenanlage durch den Münsteraner Architekten Reinking. |
|
1852 |
Umbau des nordwestlichen Turmes der Hauptburg zur Kapelle im neugotischen Stil durch den Essener Baumeister Freyse. |
|
1887 |
Der nördliche Flügel der Vorburg brennt vollständig nieder und wird nicht wieder aufgebaut. |
 An der östlichen Stirnseite des zentralen Marktplatzes in Dorsten befindet sich das Alte Rathaus. Obwohl es den weitläufigen Platz dominiert, wirkt es neben den Geschäftshäusern eher als zierlich. Das Erdgeschoß des zweistöckigen, gradlinigen Gebäudes besitzt an der Hauptfront einen Arkadengang mit fünf Rundbögen, darüber sind fünf Fenster diesen Bögen zugeordnet. Der Renaissancebau wurde ursprünglich im 15. Jahrhundert als Stadtwaage errichtet. Auswärtige Händler mussten hier das Gewicht ihrer Waren nach der Stadtnorm bestimmen lassen. Im Jahre 1797 wurde das Gebäude aufgestockt und war seit dem Sitz des Stadtrates.
An der östlichen Stirnseite des zentralen Marktplatzes in Dorsten befindet sich das Alte Rathaus. Obwohl es den weitläufigen Platz dominiert, wirkt es neben den Geschäftshäusern eher als zierlich. Das Erdgeschoß des zweistöckigen, gradlinigen Gebäudes besitzt an der Hauptfront einen Arkadengang mit fünf Rundbögen, darüber sind fünf Fenster diesen Bögen zugeordnet. Der Renaissancebau wurde ursprünglich im 15. Jahrhundert als Stadtwaage errichtet. Auswärtige Händler mussten hier das Gewicht ihrer Waren nach der Stadtnorm bestimmen lassen. Im Jahre 1797 wurde das Gebäude aufgestockt und war seit dem Sitz des Stadtrates.
Östlich der Altstadt Dorstens liegt das Jüdische Museum. Das 1992 eröffnete Museum wurde als Begegnungs- und Dokumentationsstätte konzipiert und präsentiert in einer Dauerausstellung Briefe und Urkunden, aber auch Alltags- und Kulturgegenstände, die das jüdische Leben in Westfalen vom Mittelalter bis zur Gegenwart dokumentieren.
 Östlich der Altstadt Dorstens liegt das Jüdische Museum. Das 1992 eröffnete Museum wurde als Begegnungs- und Dokumentationsstätte konzipiert und präsentiert in einer Dauerausstellung Briefe und Urkunden, aber auch Alltags- und Kulturgegenstände, die das jüdische Leben in Westfalen vom Mittelalter bis zur Gegenwart dokumentieren.
Östlich der Altstadt Dorstens liegt das Jüdische Museum. Das 1992 eröffnete Museum wurde als Begegnungs- und Dokumentationsstätte konzipiert und präsentiert in einer Dauerausstellung Briefe und Urkunden, aber auch Alltags- und Kulturgegenstände, die das jüdische Leben in Westfalen vom Mittelalter bis zur Gegenwart dokumentieren.
 Nach der Gründung der Zeche Leopold im Jahre 1910 gab es das Problem, dass es im zu diesem Zeitraum eher ländlich geprägten Dorsten viel zu wenige Arbeitskräfte gab. Um Bergarbeiter anzuwerben, sollte eine besonders schöne und lebenswerte Siedlung geschaffen werden. Es entstand zwischen 1912 und 1920 im Stadtteil Hervest eine Gartenstadt-Kolonie, die an den Baustil des anfänglichen 19. Jahrhunderts erinnerte. Die heute noch in iherer Ursprünglichkeit weitgehend erhaltene Kolonie besitzt einen zentralen Marktplatz mit Arkaden und Laubengängen, der heutige Brunnenplatz. Den Eingang zum Platz bildet ein überhöhtes und markantes Torhaus. Auf der Mitte des Platzes befindet sich ein Brunnen, geschaffen vom Künstler Reinhold Schröder. Die Kolonie besteht aus insgesamt 720 Wohnungen.
Nach der Gründung der Zeche Leopold im Jahre 1910 gab es das Problem, dass es im zu diesem Zeitraum eher ländlich geprägten Dorsten viel zu wenige Arbeitskräfte gab. Um Bergarbeiter anzuwerben, sollte eine besonders schöne und lebenswerte Siedlung geschaffen werden. Es entstand zwischen 1912 und 1920 im Stadtteil Hervest eine Gartenstadt-Kolonie, die an den Baustil des anfänglichen 19. Jahrhunderts erinnerte. Die heute noch in iherer Ursprünglichkeit weitgehend erhaltene Kolonie besitzt einen zentralen Marktplatz mit Arkaden und Laubengängen, der heutige Brunnenplatz. Den Eingang zum Platz bildet ein überhöhtes und markantes Torhaus. Auf der Mitte des Platzes befindet sich ein Brunnen, geschaffen vom Künstler Reinhold Schröder. Die Kolonie besteht aus insgesamt 720 Wohnungen.
Die Tüshaus-Mühle liegt im Dorstener Ortsteil Deuten und gilt als die einzige noch voll funktionstüchtige Wassermühle Nordrhein-Westfalens. In dem technischen Kulturdenkmal, das 1615 erbaut wurde und das noch bis in das 20. Jahrhundert als Ölmühle genutzt wurde, befindet sich heute ein kleines Museum.
 Die ‚Baldur‘ gehört zu den drei Lippefähren, mit denen Fußgänger und Radfahrer kostenfrei den Fluss überqueren können. Allerdings ist die eigene Muskelkraft erforderlich, um die Fähre in Dorsten-Holsterhausen in Bewegung zu setzen. Mit einem Handrad wird das an einer Kette befestigte Boot in Bewegung gesetzt. Die Betriebszeit der Fähre ‚Baldur‘, die seit 2005 durch den Lippeverband betrieben wird, ist zwischen April und Mitte Oktober.
Die ‚Baldur‘ gehört zu den drei Lippefähren, mit denen Fußgänger und Radfahrer kostenfrei den Fluss überqueren können. Allerdings ist die eigene Muskelkraft erforderlich, um die Fähre in Dorsten-Holsterhausen in Bewegung zu setzen. Mit einem Handrad wird das an einer Kette befestigte Boot in Bewegung gesetzt. Die Betriebszeit der Fähre ‚Baldur‘, die seit 2005 durch den Lippeverband betrieben wird, ist zwischen April und Mitte Oktober.
Radrouten die durch Dorsten führen:
100 Schlösser Route – Westkurs
Römer-Lippe-Route
Rundkurs Ruhrgebiet
Schermbeck
itten im Naturpark ‚Hohe Mark‘, in der Grenzregion zwischen Münsterland und Niederrhein, liegt landschaftlich reizvoll die Gemeinde Schermbeck. Sie taucht bereits im Jahre 799 als ‚Scirenbeke‘ erstmals schriftlich auf und profitierte im frühen 13. Jahrhundert davon, dass eine wichtige Handelroute durch den Ort führte. Um das Jahr 1415 wurde Schermbeck zur Stadt erhoben und mit zwei Toren und acht Türmen befestigt. Reste der Stadtmauer und der klevischen Grenzburg sind noch erhalten. Leider wüteten mehrfach verheerende Feuer in der Stadt. Dennoch sind einige alte Bauwerke noch erhalten. Der historische Rundwanderweg führt zu rund 20 Baudenkmälern innerhalb des Ortskerns. Mit der Römer-Lippe-Route, der Niederrheinroute und der 3-Flüsse-Route führen gleich drei Radfernwege durch die Gemeinde.
Sehenswertes:
Die auch häufig als Wasserschloss bezeichnete Burganlage wurde 1319 erstmals urkundlich erwähnt. Zunächst diente der Adelssitz als Landesburg von Kleve. Mehrfach wurde die Wehranlage zerstört, danach aber immer wieder neu aufgebaut. 1662 kam sie in privaten Besitz und auch heute noch wird Burg Schermbeck privat bewohnt.
Schon vor dem Bau der Georgskirche stand an der gleichen Position eine Kapelle, die wohl im 14. Jahrhundert errichtet worden war. Die Georgskirche entstand dann im frühen 15. Jahrhundert als spätgotische dreischiffige Basilika. Mehrfach wurde das Gotteshaus bei Großbränden stark in Mitleidenschaft gezogen. Der wuchtige Kirchturm verlor bei einem Feuer im 18. Jahrhundert seinen spitzen Helm, der danach durch die heutige stumpfe Turmhaube ersetzt wurde. In dieser Zeit erhielt der Turm den goldenen Schwan, der das Luthertum symbolisieren soll. 1945 wurde die Kirche durch Fliegerbomben erneut zerstört. Die historische Ausstattung ging dabei bis auf das zuvor ausgelagerte Altarbild verloren.
Das älteste Wohngebäude Schermbecks entstand zwischen 1569 als Ackerbürgerhaus. Heute beherbergt es das vom Heimat- und Geschichtsverein e.V. betreute Heimatmuseum. Die Ausstellung beherbergt zahlreiche alte Landwirtschaftsgeräte, historische Werkzeuge und Einrichtungsgegenstände, die die Geschichte und die Kultur des Ortes nachvollziehen lassen. Häufig wird die Sammlung durch wechselnde Sonderausstellungen ergänzt.
Die Turmwindmühle im Schermbecker Ortsteil Damm wurde 1830 als runder Backsteinbau auf einem aufgeschütteten Hügel errichtet. Als östlichste Windmühle des Niederrheins war sie bis 1940 in Betrieb. Über Jahrzehnte stand sie ohne ihre mächtigen Windmühlenflügel da. Erst nach einer umfassenden Sanierung erhielt sie 1983 ein neues Flügelkreuz.
Am Ortsausgang von Gahlen steht am Mühlenteich die alte Wassermühle Benninghof. Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert und war noch bis zum Jahr 1958 in Betrieb.
‚Hermann‘ wird der Stromturm liebevoll genannt, der im Schermbecker Ortsteil Damm das ‚kleinste Strommuseum der Welt‘ beherbergt. Die ausgestellten Gegenstände versprechen eine spannende Zeitreise durch die Geschichte der Elektrizität.
Das Museum ist zwischen Mai und Oktober jeweils am ersten Sonntag im Monat geöffnet. Nach vorheriger Absprache sind auch andere Besichtigungstermine möglich.
Zwischen Damm und Marienthal liegt mitten auf einer Wiese ein riesiger Findling aus nordischem Granit. Es wird vermutet, dass er mit einem Eisberg an seine heutige Position transportiert wurde, als hier noch ein riesiger Ozean das Land bedeckte. Um das imposante, baumhohe Naturdenkmal ranken sich mehrere Sagen und Geschichten. Hinter der Szenerie: Der Wurf des Teufelssteins Dereinst bauten in Marienthal fromme Mönche ein Kloster zu Ehren Gottes. Und auch im heute zu Hünxe gehörenden Drevenack wurde eine stolze Kirche erbaut, die schon von Weitem über die Felder zu sehen war. Das ärgerte den Teufel sehr und er befahl den Nixen in der Issel ungehalten, den Fluss aufzustauen, sodass die Kirche überschwemmt und damit unbrauchbar werden sollte. Doch das störte die gottesfürchtigen Männer nicht – sie bauten ihr Kirchlein auf dem Hügel etwas höher wieder auf. Der Höllenfürst schäumte vor Wut und stieß mit seinem Pferdefuß fest auf den Boden. Da sah er einen großen Stein, hob ihn auf und unter donnerndem Getöse schleuderte er den Granitblock gegen die Kirche – oder gegen das Kloster – hier differieren die verschiedenen Überlieferungen. Die eine spricht davon, dass der Wurf zu kurz war, die andere behauptet, der Stein wäre über die Kirche hinaus geflogen. Welche der beiden Geschichten nun wirklich der alleinigen und absoluten Wahrheit entspricht, lässt sich heute nur noch schwer nachvollziehen… Sei’s drum: nach dem satanischen Wurf blieb der Riesenstein mitten auf dem Felde liegen. Hier liegt er bis zum heutigen Tage und deshalb wird er auch heute noch ‚Teufelsstein‘ genannt.
Das weißgetünchte achteckige Kirchengebäude mit dem Glockenturmaufsatz wurde 1786 fertiggestellt. Doch heute finden hier keine Gottesdienste mehr statt. Seit 2004 beherbergt der Zentralbau die Kulturstiftung der Gemeinde Schermbeck. Der Saal dient als Räumlichkeit für kulturelle Veranstaltungen.
Die zweischiffige gotische Backsteinkirche wurde im späten 12. Jahrhundert errichtet. Teile des Hauptschiffes sind sogar noch älter und stammen von der Vorgängerkirche. Auch der vorgesetzte Wehrturm stammt noch aus romanischer Zeit. Die Gründung der Gemeinde geht auf karolingische Zeit zurück. 1552 war sie auf eigene Initiative zum lutherischen Glauben gewechselt. Zu der Innereinrichtung gehört eine aufwendig geschnitzte Kanzel von 1654 sowie ein spätgotischer Wandtabernakel.
Radrouten die durch Schermbeck führen:
Hünxe
ie Gemeinde Hünxe liegt unweit vom Niederrhein an der Lippe und am Wesel-Dattel-Kanal. Der größte Teil des Ortes befindet sich im Naturpark Hohe Mark, zu dem auch das Naturschutzgebiet Kaninchenberge gehört. Besonders reizvoll ist das Treidelschifferdorf Krudenburg an der Lippe. Hier lebten früher Fischer und Schiffer, die mit Hilfe von Pferden ihre Kähne vom Ufer aus über die damals noch schiffbare Lippe zogen. Heute ist Krudenburg ein beliebter Ausflugsort. Mit dem barocken Schloss Gartrop und dem Haus Schwarzenstein stehen auf dem Gemeindegebiet noch zwei alte Adelssitze. Sehenswert ist auch die evangelische Kirche in Drevenack, deren romanischer Kirchturm noch aus dem 12. Jahrhundert stammt. Bekanntester Sohn des Ortes ist der Maler und Graphiker Otto Pankok, der hier lange Jahre lebte und arbeitete. In seinem Wohnhaus, dem Haus Esselt in Drevenack, ist heute ein Museum untergebracht, dass seine Werke in wechselnden Ausstellungen präsentiert.
Sehenswertes:
Otto Pankok (1893 – 1966) war ein bekannter Maler, Grafiker und Bildhauer. Seine Bilder werden den expressiven Realismus zugeordnet und beeindrucken durch ihre leuchtende Farbigkeit. Sein umfangreiches graphisches Werk, das aus 6000 Kohlezeichnungen, rund 800 Holzschnitten, 800 Radierungen und 500 Lithographien bestand, war dagegen überwiegen schwarz-weiß gestaltet. In den 1950er Jahren erwarb der Künstler das Landgut Haus Esselt in Drevenack, wo er bis zu seinem Tode lebte. Pankoks Witwe richtete in dem Gebäude zu Ehren ihres Mannes ein Museum ein, das bis heute in wechselnden Ausstellungen die Werke des Künstlers zeigt.
Umgeben von einem 3 ha. großem englischem Landschaftspark steht in den Lippeauen des Hünxer Ortsteiles Gartrop-Bühl das barocke Wasserschloss Gartrop. Das zweistöckige Herrenhaus wurde im strengen niederländischen Stil erbaut und ist von einer teichartigen Gräfte umgeben. Die vier Flügel umfassen einen kleinen Innenhof. Teile der Bausubstanz stammen noch von der Vorgängerburg aus dem 14. Jahrhundert. Das heutige Schloss mit seinem Walmdach und seinem von einer geschweiften Haube gekrönten niedrigen Uhrenturm wurde 1675 erbaut. Die Anlage besteht neben dem Herrenhaus aus einer Vorburg, zwei Torhäusern und einer Wassermühle aus dem 15. Jahrhundert, die noch ein intaktes Mahlwerk besitzt.
Rund einen Kilometer nördlich von Hünxe liegt an der Lippe das Dorf Krudenburg. Das Fischerdorf war in brandenburgischer Zeit sogar zur Herrlichkeit erhoben worden. Damals war die Lippe noch schiffbar. Krudenburg besaß einen Hafen und eine Station für Pferde, denn die Kähne wurden damals von Zugtieren über sogenannte Leinpfade getreidelt, also vom Ufer aus gezogen. In Krudenburg lebten viele Treidelschiffer. Der historische Ortskern wurde inzwischen liebevoll restauriert und steht heute vollständig unter Denkmalschutz. Im Wettberwerb ‚Unser Dorf soll schöner werden‘ wurde Krudenberg, das inzwischen zum beliebten Ausflugsziel geworden ist, mehrfach ausgezeichnet.
Im 15. Jahrhundert wurde die Kirche in Drevenack als zweischiffige Backsteinkirche errichtet. Vom romanischen Vorgängerbau aus dem 12. Jahrhundert hat sich noch der Westturm aus Grauwackenbruchstein erhalten. Ursprünglich dem hl. Sebastian geweiht, wurde die Kirche gegen 1560 reformiert. Zu der Ausstattung gehört ein Taufstein aus Baumberger Sandstein (1717), die hölzerne Kanzel von 1674 und das Orgelprospekt aus dem 18. Jahrhundert.
Die Ursprünge des ehemaligen Rittersitzes gehen auf das 14. Jahrhundert zurück. Die Besitzer des einst landtagsfähigen und von einer Wassergräfte umgebenen Adelssitzes wechselten häufig. 1890 wurde das alte Gebäude jedoch abgetragen. Das heutige Haus wurde auf den alten Fundamenten über dem noch erhaltenen Gewölbe errichtet. Heute wird Haus Schwarzenstein vom Rheinisch-Westfälischen Schleppjagdverein genutzt.
Sonntagvormittags öffnet in einem ehemaligen Schulgebäude von 1900 das Heimatmuseum. Es zeigt, wie der Klassenraum in einer alten Landschule früher einmal ausgesehen hat. Daneben werden bäuerliche Gegenstände und Werkzeuge sowie vorgeschichtliche Funde ausgestellt. Das Museum kann nach vorheriger Absprache auch zu anderen Zeiten besichtigt werden. Auch Gruppenführungen sind möglich.
Radrouten die durch Hünxe führen:
Wesel
ie heißt der Bürgermeister von Wesel?, ruft man gerne im bergigen Süddeutschland, um als Echo die Antwort ‚Esel‘ zu erhalten. Dabei liegt die Hansestadt sehr viel nördlicher, am unteren Niederrhein, wo die Lippe und der Wesel-Datteln-Kanal in den Rhein münden. Die Geschichte Wesels ist von Überschwemmungen und Flussbettveränderungen geprägt. Noch vor über 300 Jahren waren dem Ort im Mündungsbereich zwei Inseln vorgelagert. Im Mittelalter entwickelte sich die Stadt, die bereits im 8. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wurde, wegen seiner Flusslage zum wichtigen Handelsort und zum Umschlagsplatz für Waren zwischen den Niederlanden, Westfalen und Köln. Neben der Zollfreiheit erhielt die Stadt bereits im 13. Jahrhundert das Markt- und Brauereirecht. Der Kornmarkt bildet das Zentrum Wesels und wahrscheinlich befand sich hier mit einem fränkischen Gutshof auch die Keimzelle der Stadt. Heute stehen hier der Willibrordi-Dom und das historische Rathaus, einer der bekanntesten gotischen Profanbauten am Rhein. Beide Gebäude wurden im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und erst später wieder aufgebaut. Das Rathaus wurde sogar erst 2011 wiederhergestellt. Der Kornmarkt ist inzwischen vor allem als Kneipenviertel bekannt. Von der mittelalterlichen Stadtbefestigung ist nur noch das Berliner Tor erhalten. Die mächtige Zitadelle am Stadtrand ist die größte erhaltene Festungsanlage im Rheinland und beherbergt heute ein Kulturzentrum und ein Heimatmuseum.
Im Stadtteil Diesfordt befindet sich das gleichnamige barocke Wasserschloss, in dem sich heute ein Hotel und ein kleines Museum befinden.
Sehenswertes:
Die fünfschiffige Basilika entstand zwischen 1498 und 1540 und gilt heute als eines der wichtigsten Bauwerke der norddeutschen Spätgotik. Der Turm stammt bereits aus dem 15. Jahrhundert. Mehrere Kirchenbauten standen bereits zuvor an der gleichen Position. Bereits im 8. Jahrhundert befand sich hier eine Fachwerkkirche. Später folgten zumindest zwei romanische Gotteshäuser, ehe die Stadtkirche in ihrer heutigen Form aufgebaut wurde. Zeitweilig besaß die Basilika mehr als 30 Altäre, doch im Zuge der Reformation wurde Wesel zum Zentrum der Reformierten Kirche. Auch heute noch ist die Inneneinrichtung des Domes sehr schlicht gehalten. Dennoch gibt es einige Sehenswürdigkeiten, wie die Heresbach-Kapelle, die Alyschläger-Kapelle aus der Spätgotik und die Figuren des Großen Kurfürsten und des Kaisers Wilhelm I., sowie den modernen Weseler Altar, den Ben Willkens erst 1996 erschaffen hat.
Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, ab 1948 aber wieder aufgebaut. Seit Mitte der Neunziger Jahre erklingt vier Mal am Tage ein Glockenspiel. Im Dom werden regelmäßig Orgel- und Bläserkonzerte im Rahmen der Weseler Domkonzerte veranstaltet.
Das alte Rathaus am Großen Markt gilt als das Wahrzeichen der Stadt Wesel. Es wurde Mitte des 15. Jahrhunderts im gotischen Stil erbaut und zwischen 1698 und 1700 noch einmal erheblich erweitert. Leider wurde das historische Gebäude im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört. Erst 2011 konnte die alte Fassade rekonstruiert werden, so dass man heute eines der bedeutendsten profanen Baudenkmäler der Spätgotik wieder im alten Glanz bewundern kann.
Im Osten der Innenstadt steht das repräsentative Berliner Tor. Das Bauwerk ist der einzig erhaltene Rest der ehemaligen Festung Wesel. Es wurde 1718 – 1722 im preußischen Barock erbaut und 1791 noch einmal überarbeitet. Die Plastiken stammen ursprünglich von Gillaume Hulot. Ende des 19. Jahrhunderts, als die Festung weitgehend abgetragen wurde, und auch während des Zweiten Weltkrieges wurde das stolze Bauwerk jeweils stark beschädigt, konnte jedoch beide Male erhalten werden. Der Platz am Berliner Tor wurde 1984 neu gestaltet.
Die Weseler Zitadelle war einst die größte Festungsanlage des Rheinlandes. Obwohl nur noch ein kleiner Rest des einstigen Bollwerkes steht, ist die Zitadelle auch heute noch die größte erhaltene Festung der Region. Sie wurde zwischen 1688 und 1722 auf Weisung von Friedrich Wilhelm von Brandenburg als fünfzackiger Stern angelegt. Jede einzelne der fünf spitzen Ausbuchtungen stellte eine Bastion dar. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Festung jedoch zum großen Teil wieder abgetragen. Das noch erhaltene Haupttor wurde 1718 fertig gestellt und beherbergt heute die Abteilungen ‚Schill Kasematten‘ und ‚Festungsgeschichte‘ des Städtischen Museums. In den Kasematten befindet sich die Gefängniszelle der aufständigen Schillschen Offiziere. Der preußische Offizier Ferdinand von Schill (1776 – 1806) hatte im Jahre 1806 einen Volksaufstand entfachen, um den preußischen König sowie Österreich zum Krieg gegen Frankreich zu bewegen. Das Vorhaben scheiterte, und Schill wurde in Stralsund im Straßenkampf getötet. Seine Offiziere wurden nach Wesel überführt und nach einem kurzen Prozess vor dem Kriegsgericht in den Lippewiesen erschossen. Zum Städtischen Museum gehört auch die Galerie im ‚Centrum‘ mit einer Ausstellung über das Weseler Silber. Zudem finden hier ständig wechselnde Sonderausstellungen statt.
Die ehemalige Kaserne VIII wurde als zweistöckiger Ziegelsteinbau zwischen 1805 und 1814 während der französischen Besatzung errichtet. Heute beherbergt der langgestreckte Bau die Musik- und Kunstschule.
Weitere erhaltene Bauteile der ehemaligen Zitadelle sind das in Privatbesitz befindliche Offiziersgefängnis von 1727, die Garnisonsbäckerei No. II von 1809, in dem sich heute das Stadtarchiv befindet und das Körnermagazin von 1835, in dem sich das Preußen-Museum Wesel befindet. Das Museum behandelt die rheinisch-preußische Geschichte der Stadt. Große Teile des Rheinlandes und Westfalens gehörten über 300 Jahre lang zu Preußen.
Zwischen 1886 und 1956 war das Wasserwerk mit dem markanten Wasserturm für die Trinkwasserversorgung der Stadt Wesel verantwortlich. Die Pumpstation wurde zunächst von einer Dampfmaschine, später von einem Elektromotor angetrieben. In dem historischen Gebäude sind noch eine alte Dampfpumpanlage mit einem Dampfkessel von 1903 sowie eine elektrische Kreiselpumpe von 1924 zu sehen. Die Anlage ist nach Voranmeldung zu besichtigen. Ein zugehöriger Trinkwasser-Lehrpfad erklärt allerlei Wissenswertes über die städtische Wasserversorgung.
Bereits vor 700 Jahren stand an der Stelle des heutigen Wasserschlosses eine Wehrburg. Sie gehörte als Lehen den Grafen von der Mark bzw. den Herzögen von Kleve und diente eins wahrscheinlich der Sicherung einer Furt. Wann die Burg genau entstand, ist heute nicht mehr bekannt. Eine erste schriftliche Erwähnung findet sich in einer Urkunde von 1334.
Als die Anlage im Jahr 1831 in den Besitz des Grafen zu Stolberg-Wernigeroch kam, wurde die Burg zu einem spätbarocken Schloss umgebaut. Doch 1928 wurde es bei einem Feuer fast vollständig zerstört und danach nur noch vereinfacht wieder aufgebaut. Nur die Vorburg hat den Großbrand unbeschadet und unverändert überstanden.
Das Schloss beherbergt heute ein Heimatmuseum und ein Hotel, wird aber auch noch von den Schlossherren privat bewohnt. Im Museum wird die Geschichte Diesfordts und die des Schlosses sowie die Entwicklung der regionalen Landwirtschaft behandelt.
Die schmucke Schlosskirche wurde 1952 wieder aufgebaut.
Die katholische Kirche im Weseler Ortsteil Ginderich wurde im 14. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut. Der romanische Westturm wurde vom Vorgängerbau übernommen. Bereits 1190 war die Kirche urkundlich erwähnt worden. Im Mittelalter war sie aufgrund eines Gnadenbildes der Maria Ziel einer Wallfahrt, die jedoch 1640 durch einen Erlass beendet wurde. Erst 2005 wurde Ginderich als Wallfahrtsort durch das Bistum Münster wieder offiziell ausgerufen.
Zur Inneneinrichtung des dreischiffigen Gotteshauses, das 1870 noch einmal erheblich erweitert wurde, gehört ein Taufstein aus der Zeit um 1475 sowie vier spätgotische Figuren, die unter anderen den Jakobus sowie Rochus von Montpellier darstellen.
Zwischen Wesel und Rees, nahe am Deich des Rheins, steht die katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptistae. Sie entstand im 12. Jahrhundert als dreischiffige romanische Pfeilerbasilika und diente zunächst mit ihren dicken Tuffsteinmauern auch als Wehrkirche. Noch bis zum letzten Krieg hatte das Gebäude Schießscharten aus dieser Zeit besessen.
Zur Inneneinrichtung gehören ein prächtiger neugotischer Langenberg-Flügelaltar von 1882 sowie ein geschnitztes Johannishaupt, das einer mündlichen Überlieferung nach das Kernstück des ersten gotischen Hochaltars aus dem 15. Jahrhundert bildete. Besonders beachtenswert ist das gotische Sakramentshäuschen aus Kalkstein an der Nordwestseite des Chors, das noch aus dem frühen 16. Jahrhundert stammt.
Als im 16. Jahrhundert die Reformation in Wesel Einzug hielt, durften zunächst aus Gründen der evangelischen Einheit die Reformierte Kirche und die Lutherische Kirche keine eigenen Gemeinden bilden. Erst im 17. Jahrhundert nutzten die Lutheraner ein Wohnhaus als Versammlungsstätte, das sie 1729 zu einer Kirche auf quadratischem Grundriss umbauten. Nachdem das Gotteshaus im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört wurde, baute man es danach nur vereinfacht wieder auf. Die ehemalige Kirche dient heute als evangelisches Beratungszentrum sowie als kirchlicher und kultureller Veranstaltungsort.
Die Lippe ist mit einer Länge von 220 Kilometern der längste Fluss Nordrhein-Westfalens und der nördlichste rechte Nebenfluss des Rheins. Die Quelle befindet sich am Fuße des Eggegebirges mitten in der Stadt Bad Lippspringe und gehört mit ihrer Ausschüttung zu den wasserreichsten Quellen Deutschlands. Nach nur kurzer Wegstrecke verbindet sich die Lippe mit dem nur einen Kilometer langen Jordan. Im Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus mündet die Pader, der mit einer Länge von nur rund 4 Kilometern kürzeste Fluss Deutschlands, in die Lippe. So schwillt diese bereits nach kurzer Zeit zu einem stattlichen Fluss an und schlängelt sich durch die Hellweg-Region, das Münsterland, die Metropole Ruhr bis zum Niederrhein. Dabei durchfließt sie die Innenstädte von Lippstadt, Hamm und Lünen, um dann bei Wesel in den Rhein zu münden. Die Schifffahrt auf der Lippe geht bis in römische Zeit zurück, in Preußischer Zeit wurde diese sogar noch stark ausgebaut. Transportkähne mit Salz, Getreide, Eisenerz, Steine und Holz wurden hier getreidelt, also von Land aus gezogen. Später wurden sogar Dampfschiffe eingesetzt. Elf Schleusen sorgten für den nötigen Wasserstand. Im 20. Jahrhundert übernahmen dann der parallel verlaufende Hamm-Datteln-Kanal sowie der Datteln-Wesel-Kanal die Aufgabe als Transportweg. Dort, wo die Lippe im 19. Jahrhundert noch schiffbar war, entsteht gerade mit der renaturierten Lippeaue eines der längsten zusammenhängenden Naturschutzgebiete Deutschlands. Die Lippe soll sich zum lebendigen Fluss zurückverwandeln und ein Refugium für Flora und Fauna bieten. Der Mündungsbereich südlich von Wesel wurde 2014 offiziell fertig gestellt und bietet auch kleine Wege zum Spazierengehen, um die zurückgewonnene Natur genießen zu können.
Der Wesel-Datteln-Kanal (WDK) führt nördlich am Ruhrgebiet vorbei und parallel zur Lippe vom Dortmund-Ems-Kanal bei Datteln bis zum Rhein bei Wesel. Inoffiziell wird die 60 Kilometer lange Wasserstraße auch häufig Lippe-Seitenkanal genannt. Sie gehört zu den meistbefahrensten und wichtigsten Kanälen Deutschlands und besitzt insgesamt 6 Staustufen, die einen Höhenunterschied von bis zu 44 Metern ausgleichen. Der Bau wurde bereits 1915 begonnen, lag dann aber eine Zeit lang brach, ehe er 1930 endlich fertig gestellt wurde. Zwischen dem Kanalkreuz in Datteln bis nach Friedrichsfeld verläuft direkt an der Wasserstraße ein Betriebsweg, der auch von Radfahrern und Fußgängern benutzt werden kann. Nur am Chemiepark Marl muss kurzzeitig auf den Radweg an der Lippe ausgewichen werden. Die Mündung des Datteln-Wesel-Kanals befindet sich unmittelbar südlich der renaturierten Lippemündung und des Städtischen Rheinhafens.
Schon 1355, so belegt es eine alte Urkunde, wurden in Wesel auf dem Rhein Güter mit Hilfe eines Kranschiffes umgeschlagen. Ein erstes Hafenbecken, das inzwischen allerdings wieder zugeschüttet wurde, entstand Mitte des 17. Jahrhunderts. Der heutige Rheinhafen wurde zwischen 1870 und 1875 ausgehoben, um eine bessere Anbindung an den Eisenbahnverkehr zu ermöglichen. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die gesamte Anlage durch Fliegerbomben stark beschädigt, bis 1950 aber wieder vollständig hergestellt.
Der Hafen besitzt eine rund 800 Meter lange Kaimauer. Heute werden hier insbesondere Kies und andere Baumaterialien, Futtermittel, Brennstoffe und Öl umgeschlagen. Das Hafenbecken, das parallel zur Lippe ausgerichtet ist, besitzt auch einen Anleger für Ausflugsschiffe.
Die Lippe besaß einst eine lange Schifffahrtstradition, die bis in die römische Zeit zurückgeht. Später wurden Eisenerz, Getreide, Holz und Salz über den Fluss getreidelt, also auf Kähnen vom Ufer aus mit Pferden gezogen. Die Hochzeit erlebte die Schifffahrt auf der Lippe ab 1840, als der Fluss durchgängig bis Lippstadt schiffbar war. An diese Zeit erinnert der alte Lippehafen in Wesel mit seiner alten Hafenmauer. Doch nachdem die Schifffahrt gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgegeben wurde, verwaiste der Hafen. Heute befindet sich hier der Vereinssitz des Weseler Rudervereins.
Einsam und verlassen steht eine langgestreckte Brückenruine auf der Wiese am Rhein. Die historische Eisenbahnbrücke wurde zwischen 1872 und 1874 durch die Cöln-Mindener Eisenbahngesellschaft als Teil der Bahnstrecke zwischen Hamburg und dem niederländischen Venlo erbaut. Damals war es die nördlichste deutsche Rheinbrücke. Nach 1917 kam in unmittelbarer Nähe noch eine Straßenbrücke hinzu. Als die Deutsche Wehrmacht gegen Ende des Zweiten Weltkrieges vor den alliierten Streitmächten zurückwich, sprengte sie im März 1945 beide Brücken, um den Vormarsch des Gegners aufzuhalten. Die Eisenbahnbrücke wurde nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut, blieb aber als Ruine erhalten.
Das Museum soll ein lebendiger Ort sein, wo unter dem Motto: ‚Dorf am Deich‘ Zeugnisse der Vergangenheit zusammengetragen und ausgestellt werden, die einen kultur- und sozialgeschichtlichen Überblick über das Leben in der Gemeinde zu geben. Dabei spielt das Leben am Rhein, die Schifffahrt, der Fischfang und der Deichbau eine besondere Rolle. Die ständige Ausstellung wird häufig durch Sonderausstellungen sowie durch Vorführungen alter Handwerkstechniken und Backen im alten Backhaus ergänzt.
Die Lippefähre Quertreiber ist eine unbemannte Gierseilfähre, die bis zu sechs Personen mit Fahrrädern gleichzeitig benutzen können. Sie verbindet die Hauptroute der Römer-Lippe-Route mit der Lippemündungsschleife vor Wesel und ist zwischen Mitte April und Mitte Oktober in Betrieb. Der Fahrgast kann die Fähre mit eigener Muskelkraft zum anderen Ufer ziehen. Ein 100 m langes Tragseil sorgt dafür, dass die Fähre zur gegenüber liegenden Anlegestelle geführt wird.
Radrouten die durch Wesel führen:
Römer-Lippe-Route
Rundkurs Ruhrgebiet
NiederRheinroute
Erlebnisweg Rheinschiene
Xanten
ie Domstadt am Niederrhein, die sich gleichzeitig auch Römerstadt und Siegfriedstadt nennt, hat dem Besucher einiges an Geschichte, Kultur und Natur zu bieten. Wer an Xanten denkt, dem fallen zunächst meist die alten Römer ein, die hier schon vor 2.000 Jahren in der Stadt ‚Colonia Ulpia Traiana‘ lebten. In der Antike war die Stadt eine der größten Metropolen in den germanischen Provinzen Roms und neben Köln die einzige Colonia in Niedergermanien. Im LVR-Archäologischen Park Xanten kann man eine Vielzahl von rekonstruierten römischen Bauten besichtigen, die auf den originalen Fundamenten stehen, darunter Wohnhäuser, eine Herberge, der Hafentempel, die Stadtmauer, Tore und ein Amphitheater. Der Archäologische Park ist das größte Freilichtmuseum Deutschlands. Zu ihm gehört auch das RömerMuseum, in dem die faszinierende Geschichte der Römer am Niederrhein anschaulich beschrieben wird.
Siegfried, der drachenbezwingende Held aus der berühmten Nibelungensage, war der Geschichte nach ein Königssohn aus Xanten, ehe er nach Burgund auszog, um dort um die Hand der schönen Königstocher Kriemhild zu werben. Natürlich gibt es hier ein Museum, das die Geschichte hinter der Sage beleuchtet sowie Straßen, Restaurants und Mühlen, die sich mit ihren Namen auf das deutsche Heldenepos beziehen.
Auch kirchengeschichtlich ist die Stadt am Niederrhein bedeutend. Der gotische St.-Viktor-Dom im historischen Zentrum wird hier der ‚größte Dom zwischen Köln und dem Meer‘ genannt und geht auf die Gründung eines Stiftes im 8. Jahrhundert zurück. Er besitzt die bedeutendste sakrale Bibliothek am Niederrhein und einen wertvollen Kirchenschatz, der im StiftsMuseum besichtigt werden kann. Kultureller Anlaufpunkt ist in unmittelbarer Nähe zum Dom das DreiGiebelHaus mit seinen verschiedenen Ausstellungen. Wer es natürlicher mag, dem bietet die Bislicher Insel eine intakte Auenlandschaft, die aus den Flusslaufveränderungen des Rheins entstand. Und mit der Xantener Nord- und Südsee besitzt die Stadt ein ausgedehntes Freizeitzentrum für Wassersportler und sonstige Wasserbegeisterte. Xanten ist seit 1988 staatlich anerkannter Erholungsort und seit 2014 sogar Luftkurort – und ein wahrer Radfernwegknotenpunkt. Die Römer-Lippe-Route und die Via Romanica starten bzw. enden hier, der Rheinradweg, die Erlebniswelt Rheinschiene, die 2-Länder Route und die Nieder-Rhein-Route führen durch die Stadt.
Sehenswertes:
Wenn man an Xanten denkt, dann denkt man auch gleich an die alten Römer, die an diesem Ort schon vor über 2.000 Jahren zunächst im Lager ‚Vetera‘ und später in der Stadt ‚Colonia Ulpia Traiana‘ lebten. In der Antike war die Stadt mit 10.000 Einwohnern eine pulsierende Metropole und nach Köln der zweitgrößte Handelsposten in der Provinz Germanien. Im Lager Vetera waren schon zuvor durchgängig 8.000 – 10.000 römische Legionäre stationiert. Im Jahre 275 n.Chr. wurde die Colonia zwar durch die Franken nahezu vollständig zerstört, doch bereits um 310 entstand unter dem Namen ‚Tricensimae‘ eine kleinere, aber besser befestigte Stadt. Im 5. Jahrhundert wurde aber auch diese dann endgültig aufgegeben.
Der Archäologische Park Xanten (APX) ist heute das größte Freilichtmuseum Deutschlands und umfasst fast das gesamte Gebiet der ehemaligen Stadt Colonia Ulpia Traiana. Auf den freigelegten originalen Fundamenten wurden zahlreiche römische Bauwerke rekonstruiert, so dass man das Leben in der antiken Colonia mit etwas Phantasie sehr gut nachvollziehen kann. Neben Wohnhäusern und Villen wurde auch der imposante Hafentempel, ein Matronentempel, die Therme und Teile der Stadtbefestigung mit den Stadttoren wieder aufgebaut.
Zu der Anlage gehört auch das LVR-RömerMuseum, das sich noch bis 2006 in der Xantener Innenstadt befunden hatte und einen Überblick über die römische Geschichte, die römische Kultur und das römische Leben am Niederrhein und in der Provinz Niedergermanien gibt.
Das eindrucksvolle Amphitheater wurde im Gegensatz zu den anderen Gebäuden nicht auf den originalen Fundamenten errichtet. Diese waren bereits 1887 ausgegraben worden und durch die Witterung hatten diese starke Schaden genommen. Teile der originalen Pfeilerkonstruktion sind aber heute neben der Arena zu sehen.
1263 begann man mit dem Bau des Xantener Doms. Die Fertigstellung der heutigen Probsteikirche zog sich über mehr als 280 Jahre hin. Der mit einer Höhe von 74 Metern ‚größte Dom zwischen Köln und dem Meer‘ wurde von Papst Pius XI. im Jahre 1937 in den Rang einer Basilica minor erhoben. Bereits 752 hatte es an gleicher Stelle eine Kirche gegeben, um die sich ein Kanoniker-Stift gründete. Die Stadt entwickelte sich um diesen Stift herum. Aus der Bezeichnung ‚ad Sanctos‘ entwickelte sich für die Siedlung der Name ‚Xanten‘. Nachweislich hatte es insgesamt sieben Vorgängerkirchen gegeben, ehe der heutige Dom St. Viktor entstand. Gegenüber dem Erzbistum Köln konnte sich der Stift immer eine gewisse Selbstständigkeit bewahren, doch 1802 wurde der Konvent im Zuge der Säkularisierung aufgelöst.
Mit der alten Stiftsbibliothek, die bereits 1547 eingerichtet wurde, enthält der Dom die wohl bedeutendste sakrale Bibliothek des Niederrheins. Die Büchersammlung umfasst heute rund 20.000 Werke, darunter auch rund 150 historische Handschriften, die zum Teil bis in das 8. Jahrhundert zurückreichen. Zu den bedeutendsten Werken zählen eine handschriftliche Ausgabe der Bibel aus dem frühen 12. Jahrhundert, der einzig erhaltene Teil des “Dialogus super libertate ecclesiastica” von Heinrich Urdemann aus den Jahren 1482/1483 sowie die “Schedelsche Weltchronik” von Hartmann Schedel mit ihren 1.809 teils von Albrecht Dürer gefertigten Holzschnitten aus dem Jahr 1493.
1933 fand man bei Ausgrabungen unter dem Chor ein Doppelgrab, das man auf das 4. Jahrhundert datierte und um das man eine Krypta anlegte. Der Legende nach handelte es sich bei den Gebeinen um die sterblichen Überreste des Kirchenpatrons Viktor – sehr wahrscheinlich ist diese Annahme jedoch nicht. In der erweiterten Krypta wurden Opfer des Nationalsozialismus beigesetzt und auch eine Reliquie des Bischofs Clemens August Graf von Galen, der im Dom mutig gegen den Nationalsozialismus gepredigt hatte, wurde hierher übergeführt.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche durch Fliegerbomben schwer beschädigt. Die wertvollen Ausstattungsgegenstände hatte man jedoch zuvor in Sicherheit gebracht. Der Wiederaufbau hatte bis 1966 gedauert.
Der prächtige Hochaltar (1529-44) mit dem edelsteinbesetzten Schrein, der die Gebeine des hl. Viktors enthält, ist das bedeutendstes Heiligtum des Domschatzes. Er gehört zu den Hauptwerken der rheinischen Renaissance. Weitere 23 Altäre, die meisten aus Holz geschnitzt, sind erhalten geblieben. Am bemerkenswertesten sind der Märtyreraltar von 1525, der Marienaltar von 1536, der Martiniusaltar von 1477 und der Matthiasaltar. Die 38 Steinskulpturen an den Pfeilern des Mittelschiffes, die verschiedene Heilige sowie den Kirchenpatron Viktor darstellen, wurden um 1300 gefertigt.
In den historischen Gebäuden des ehemaligen Kanoniker-Stifts befindet sich das StiftsMuseum. Es gilt aufgrund seiner stimmungsvollen Präsentation als eines der schönsten kirchlichen Museen Deutschlands und beherbergt den prachtvollen Kirchenschatz des Domes.
Das Klever Tor erinnert an die mittelalterliche Stadtbefestigung Xantens, die im 19. Jahrhundert zum größten Teil abgetragen wurde. Das Stadttor besteht eigentlich aus zwei Toren, die durch eine Brücke über den ehemaligen Stadtgraben verbunden sind. Stadteinwärts besteht das Tor aus einem quadratischen Turm, in dem heute drei Ferienwohnungen untergebracht sind. Das äußere Tor besteht neben dem Mauerbogen aus zwei Rundtürmen, den sogenannten Eulentürmen. Zeitweilig hatte das Tor im 19. Jahrhundert auch als Gefängnis gedient. Während der Oberbau im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt wurde und danach rekonstruiert werden musste, blieb der Unterbau von 1393 noch original erhalten.
>Die mittelalterliche Stadtbefestigung Xantens entstand Ende des 14. Jahrhunderts und umschloss ein rechteckiges Areal mit einer rund acht Meter hohen Mauer. Vier Doppeltore und 18 Wehrtürme sorgten für die Wehrhaftigkeit der Stadt. Doch im 19. Jahrhundert wurde die inzwischen nutzlose Verteidigungsanlage, darunter auch das Marstor und das Scharntor, wieder weitgehend abgetragen. Neben dem Klever Tor blieben nur noch zwei alte Wachtürme erhalten.
Der Schweineturm am Südwall thronte einst als Wehrturm über die Stadtmauer. Der ehemals vollkommen runde Turm wurde im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut und diente im 16. Jahrhundert als Wohnung für den städtischen Schweinehirten, was ihm seinen Namen einbrachte. Später nutzten Stiftsherren den Wohnturm als Gartenhäuschen und auch heute noch wird er als Privatwohnung genutzt.
Auch der Rundturm am Nordwall diente zunächst als Wehrturm. 1820 wurde auch er zum Gartenhaus umgebaut. Reste der Stadtmauer sind an den Seiten noch erkennbar.
Die Krimhildmühle am Rand der Innenstadt Xantens geht auf das 14. Jahrhundert zurück, als sie als Wachturm auch Teil der Stadtbefestigung war. Nach starken Beschädigungen im Dreißigjährigen Krieg wurde sie als ‚Nachtwächterturm‘ bezeichnet, da hier Bedienstete der Stadt, darunter auch die Nachtwächter, wohnten. Im 19. Jahrhundert wurde der Mühlenturm zunächst zur Ölmühle und später zur Getreidemühle umgebaut. Zeitweilig wurde dann jedoch der Abriss diskutiert. Nach einer umfangreichen Sanierung wird seit 1992 in der Mühle wieder Brot gebacken. Beeindruckend sind die Mühlenflügel, die nach alter holländischer Art mit Stoffsegeln bespannt sind. Sie gilt als einzige Mühle am Niederrhein, die täglich betrieben wird. Während der Betriebszeiten ist auch eine Besichtigung möglich.
Auch die Siegfriemühle besitzt eine lange Geschichte. Sie wurde 1744 als sechsstöckiger Galerieholländer erbaut. Nachdem 1912 ein Blitz in die Windmühle eingeschlagen war und starke Schäden verursacht hatte, wurde der Betrieb eingestellt. In den 1960er Jahren hatte die Mühle neue Flügel bekommen, die aber im Jahre 2002 einem schweren Sturm zum Opfer fielen. Inzwischen wurde die Mühle, die auch nach der Müllerfamilie Biermanns-Mühle genannt, wird, in den Archäologischen Park integriert und hat nun auch ihre Flügel wiederbekommen.
Die Ursprünge des ehemaligen Kartäuserklosters in Xanten gehen auf das frühe 15. Jahrhundert zurück. Damals befand sich das Kloster allerdings noch in Flüren bei Wesel auf der anderen Rheinseite. Erst 1628 wurde die Kartause nach Xanten verlegt. Bald darauf war in unmittelbarer Nähe des Domkapitels das Konventgebäude mit seinem schmalen, achteckigen Treppentürmchen und den auffälligen Giebeln entstanden. Die Andreaskapelle, die die Mönche als Klosterkirche nutzten, wurde inzwischen abgerissen. Nachdem das Kloster 1802 im Zuge der Säkularisierung aufgelöst wurde, wurde es zunächst privat genutzt und kam später in städtischen Besitz. Der Bestand der Klosterbibliothek ging in der Stadtbibliothek Xanten auf, die sich heute wieder im oberen Stockwerk der Kartause befindet. Der untere Teil des Gebäudes beherbergt heute ein Restaurant.
In den Räumen des ehemaligen Lehrerseminars eines Kapuzinerklosters befindet sich heute das Rathaus der Stadt Xanten. Das historische Gebäude wurde 1877 erbaut und mit einem modernen Anbau ergänzt.
Eines der eindrucksvollsten profanen Häuser in Xanten ist sicherlich das Gotische Haus am Markt. Es wurde 1540 als Kontor und Handelshaus erbaut und ist bis heute in nahezu unverändertem Zustand erhalten. Der Backsteinbau wird durch Sandstein gegliedert und besitzt einen markanten Treppengiebel. Heute beherbergt das Gebäude über drei Etagen ein Restaurant.
Mit seiner aufwendig gestalteten Backsteinfassade wirkt das Gebäude kaum wie ein ehemaliges Armenhaus. Der auffällige Treppengiebel und die hohen Kreuzstockfenstern würden eher ein patriarchalisches Bürgerhaus vermuten lassen. Tatsächlich aber war das Arme-Mägde-Haus im 16. Jahrhundert von Kanonikern gestiftet worden, um den älteren, alleinstehenden Bediensteten des Stiftes ein würdiges Zuhause für ihren restlichen Lebensabend bieten zu können.
Die evangelische Kirche am Marktplatz entstand in den Jahren 1648 – 49. Dabei wurden die Steine einer zuvor gesprengten Burganlage im Nachbarort als Baumaterial genutzt. Die barock geschweifte Haube wurde dem Kirchturm erst 13 Jahre später aufgesetzt. Aufgrund des Platzmangels um die Kirche herum wurden bis 1777 die meisten Gemeindeglieder im Kellergewölbe des Gotteshauses beigesetzt.
Fast 500 Jahre befand sich zwischen Xanten und Birten am Alten Rhein das Benediktinerkloster Fürstenberg, das jedoch bereits 1586 von den Spaniern zerstört wurde. 1671 ließ die Äbtissin Brigitte Wilhelmine von Backum in Erinnerung an dieses Kloster an gleicher Stelle eine kleine Kreuzkapelle errichten. Das hübsch gelegene Gotteshaus steht auf einer kleinen Anhöhe und wurde 1977 noch einmal von Grund auf saniert.
Die 1853 errichtete Dampfkornbrennerei ist in Xanten das einzige erhaltene Industriedenkmal aus dem 19. Jahrhundert. Eigentlich war der Backsteinkomplex zunächst als Ölmühle gebaut worden, ehe an diesem Ort Schnaps und Liköre hergestellt wurden. Die Alte Kornbrennerei war noch bis in die 1970er Jahre in Betrieb.
Das Nibelungenlied gilt als DAS Nationalepos der Deutschen. Der Text wurde im frühen 13. Jahrhundert aufgeschrieben, ist aber wohl bedeutend älter, da er zuvor über Generationen mündlich übermittelt wurde. Der Held des Nibelungenliedes ist Siegfried, der Königssohn aus Xanten, der im ersten Teil der Sage an den Königshof von Worms kommt, um dort um die Hand der schönen Königstocher Kriemhild zu werben. Unterwegs erschlägt er mit seinem Schwert zwölf Riesen und sechshundert Recken, besiegt den mächtigen Zwerg Alberich und tötet schließlich den gefährlichen Drachen. Das Baden im Drachenblut macht ihn unverwundbar, doch ein Lindenblatt sparte einen kleinen Teil seines Körpers aus. Bei der Jagd wird Siegfried schließlich durch Hagen von Tronje getötet, der mit seinem Speer hinterrücks auf diese verwundbare Stelle am Rücken gezielt hatte. Der zweite Teil der Sage erzählt dann von der Rache Kriemhilds. Das Nibelungenlied wurde als bedeutendes Meisterwerk der Weltliteratur in den Kanon des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.
Durch die Herkunft Siegfrieds ist das berühmte Heldenepos untrennbar mit Xanten verbunden. In logischer Konsequenz entstand hier das SiegfriedMuseum. Die anschauliche Ausstellung erklärt ausführlich die Hintergründe dieser Sage, geht auf die Quellen, auf Wahrheit und Fiktion sowie die Charaktere der Geschichte ein und beschreibt die wesentlichen Einflüsse und Auswirkungen auf Literatur, Kunst, Politik und Gesellschaft.
Das Museum befindet sich auf dem Areal der mittelalterlichen Bischofsburg von Xanten, die aus den Steinen der einstigen römischen Siedlung erbaut wurde. Mit dem freigelegten Mauerwerk des alten Wehrganges sind hier noch Spuren der Ursprünge Xantens zu sehen.
Ein beliebtes Ziel für Naherholungssuchende sind die Xantener Nord- und Südsee. Die beiden großen Seen sind durch einen Kanal miteinander verbunden und bieten vielfältige Möglichkeiten des Wassersportes: hier kann man segeln, windsurfen, Wasserski und Boot fahren, paddeln, tauchen und angeln. Das Nibelungenbad an Xantener Südseestrand bietet darüber hinaus Badespaß für die ganze Familie mit Wellenbad und Saunalandschaft. An den Bootshäfen Vynen, Wardt und Xanten findet sich ein maritimes Flair mit Cafés und Restaurants.
Zwischen Xanten und Ginderich liegt eine der wenigen intakten Auenlandschaften Deutschlands. Das Areal entstand durch die Flusslaufveränderungen des Rheins und beschreibt eine Fläche von rund 12 km², von denen 9 km² als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. Die Bezeichnung ‚Bislicher Insel‘ geht noch eine lange vergangene Zeit zurück, als sich hier tatsächlich noch eine Insel im Rhein befunden hatte. Diese verlandete, als Friedrich der Große im Jahre 1788 den Rhein an dieser Stelle begradigen ließ. Mit dem Xantener Altrheinarm und der künstlich geschaffenen Seenlandschaft wurde die regelmäßigüberflutete Auenlandschaft zum wertvollen Refugium für zahlreiche Tiere und Pflanzen, insbesondere auch für seltene Vogelarten, wie unter anderem Baumfalken, Schwarzmilane, Fischadler, Rohrdommeln, Nachtigallen, Teichrohrsänger und Pirole. Bis zu 30.000 Wildgänse überwintern hier. Inmitten des Naturschutzgebietes befindet sich in einem ehemaligen Gehöft die Dauerausstellung ‚AuenGeschichten‘, die vom Regionalverband Ruhr Grün zusammengestellt wurde. Die Bislicher Insel lädt zu geruhsamen und ausgedehnten Spaziergängen durch die Natur ein.
In Birten steht eine der ältesten Burganlagen am Niederrhein. Schloss Winnenthal wurde bereits im frühen 14. Jahrhundert an der damaligen Grenze zwischen Kleve und Kurköln erbaut. Als Herzogssitz wurde sie im 15. Jahrhundert zu einer großen und wehrhaften Wasserburg mit Vorburg und dreiflügliger Hauptburg ausgebaut. Nach 1600 folgte der Umbau zu einem barocken Schloss. Zeichnungen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts lassen erkennen, dass man Vor- und Hauptburg zu einer Vierflügelanlage verbunden hatte. Doch im 19. Jahrhundert wurden wesentliche Teile der Anlage wieder abgetragen und die einstige Burg diente fortan als landwirtschaftliches Gut. Nachdem das Herrenhaus im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurde, verkam der ehemalige Adelssitz zur Ruine und wurde erst in den 1980er Jahren wieder aufgebaut. Von der einstigen Anlage blieb als Herrenhaus nur der zweigeschossige Nordostflügel erhalten. Die jetzige Vorburg besteht aus einer neuzeitlich umgebauten Dreiflügelanlage, die ursprünglich aus dem frühen 19. Jahrhundert stammte. Heute beherbergt Schloss Winnenthal eine Seniorenresidenz.
Die Wallfahrtskirche in Marienbaum wird alljährlich von rund 15.000 Pilgern besucht, die das Gnadenbild der Maria aus dem frühen 14. Jahrhundert sehen wollen. Ursprünglich war das Gotteshaus 1460 als Klosterkirche erbaut worden. Im Marienkloster lebten bis zu 60 Nonnen und 25 Geistliche. 1714 wurde die baufällige Kapelle zum größten Teil wieder abgetragen und durch die heutige Kirche St. Mariä Himmelfahrt ersetzt. Nur der Chor und der gerade vier Jahre zuvor entstandene barocke Kreuzgang blieben erhalten. Nachdem das Brigittenkloster 1802 im Zuge der Säkularisierung aufgelöst wurde, wurde das Gotteshaus zur Pfarrkirche erhoben. Bis auf den zweistöckigen Kapitelsaal, der heute als Sakristei dient, wurden die restlichen Klostergebäude abgerissen. Der neugotische Turm der Kirche wurde übrigens erst 1867 ergänzt. Zur heutigen Ausstattung gehört neben dem Gnadenbild der Maria der Hochaltar von 1441 mit Gemälden von Barthel Bruyn d.Ä.. Erhalten haben sich im Bereich des Chores einige mittelalterliche Fresken, die noch aus der Zeit des ersten Kirchenbaus stammen.
Als kultureller Anlaufpunkt hat sich im Zentrum Xantens das DreiGiebelHaus etabliert. Das auffällige Gebäude bietet mehrere Ausstellungen unter einem Dach an.
In der Galerie stellt der Vereine Stadtkultur Xanten e.V. und der Kunstverein Xanten zeitgenössische Kunst von lokalen und überregionalen Künstlern aus. Die Galerie versteht sich als kreativer Ort, wo Neues erprobt werden kann und wo eine Brücke zwischen Künstlern und Kunstfreunden geschlagen wird.
Die Ausstellung Josef Hehl widmet sich einem Künstler, den man in seiner Wahlheimat Xanten achtungsvoll ‚Meister Jupp‘ nannte. Josef Hehl (1885-1953) war zu seiner Zeit ein bekannter Bildhauer. Er fertigte Keramiken und getöpferte Skulpturen, von denen über 400 Exponate als Schenkung der Stadt Duisburg nach Xanten kamen. In der Ausstellung werden diese Werke in Erinnerung an den Künstler präsentiert.
Das LVR-Kulturfenster zeigt eine Ausstellung über das Kultur-, Geschichts- und Umweltangebot des Landschaftsverbandes Rheinland. Der LVR betreibt in Xanten den Archäologischer Park sowie das RömerMuseum.
Das DreiGiebelHaus beherbergt darüber hinaus die Stadtbücherei sowie die Dommusikschule.
Das Amphitheater im Südosten von Xanten stammt wohl noch aus dem 1. Jhd n. Chr. Zu dieser Zeit existierte nahe dem heutigen Xanten noch das römische Lager Vetera. Die Stadt ‚Colonia Ulpia Traiana‘ wurde erst später errichtet. Der Rundbau ist für sein Alter noch überraschend gut erhalten. Angeblich soll hier Viktor von Xanten, der Schutzpatron des Xantener Doms, im 4. Jhd. sein Martyrium erlitten haben. Die Spielstätte wird auch heute noch vereinzelnd für Konzerte und sonstige Aufführungen genutzt.




























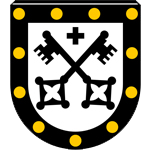






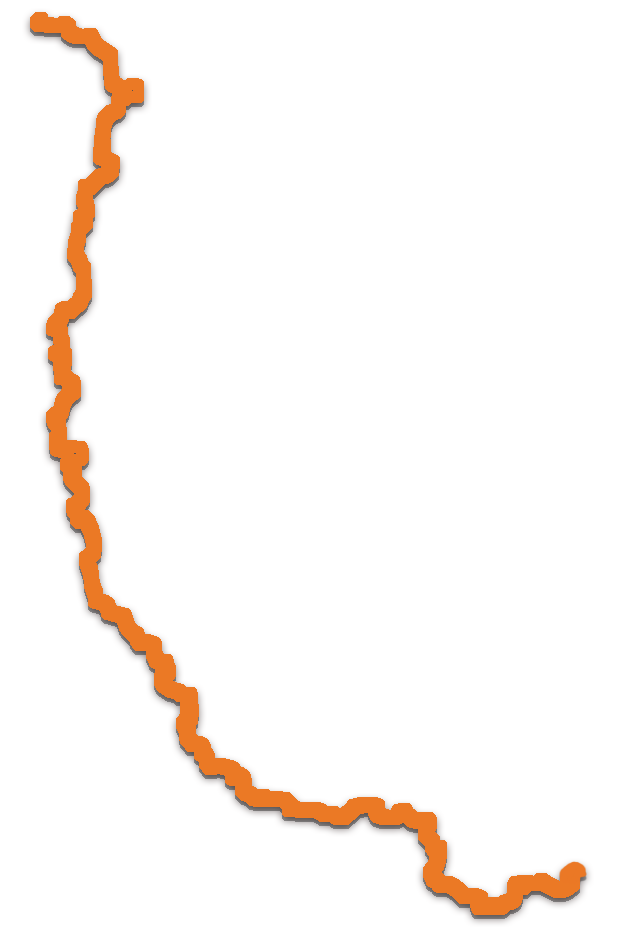
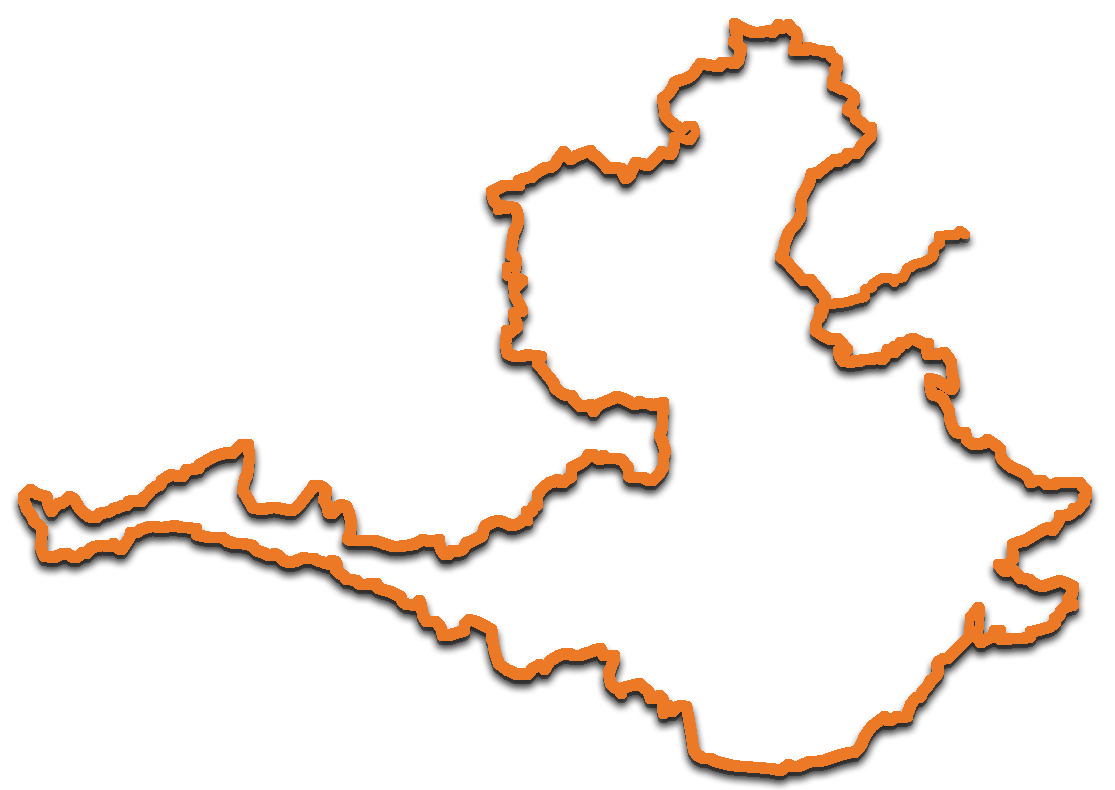
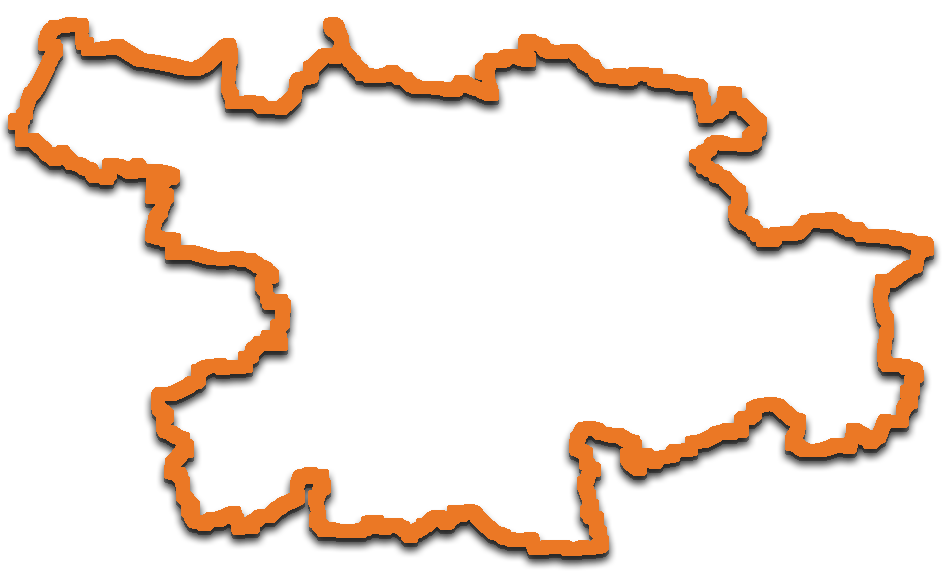

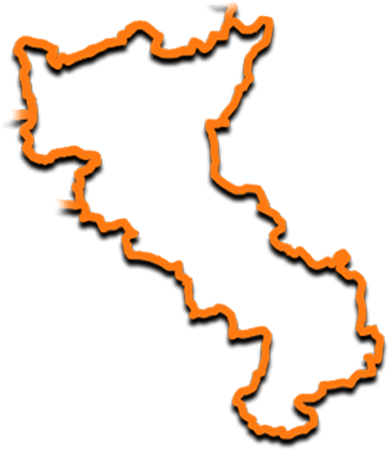
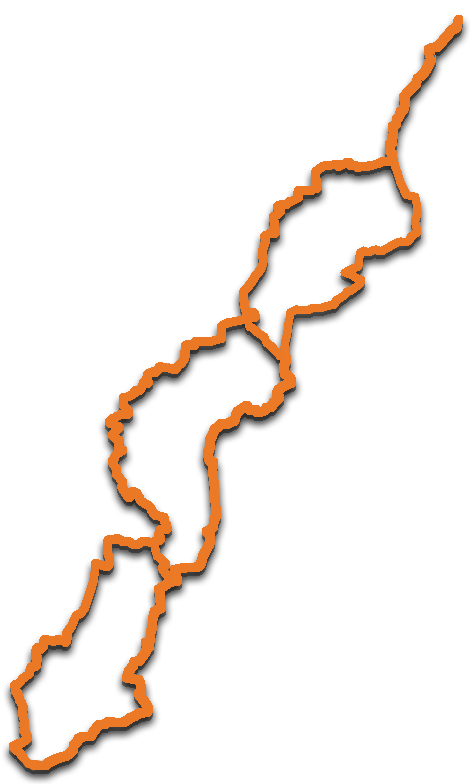


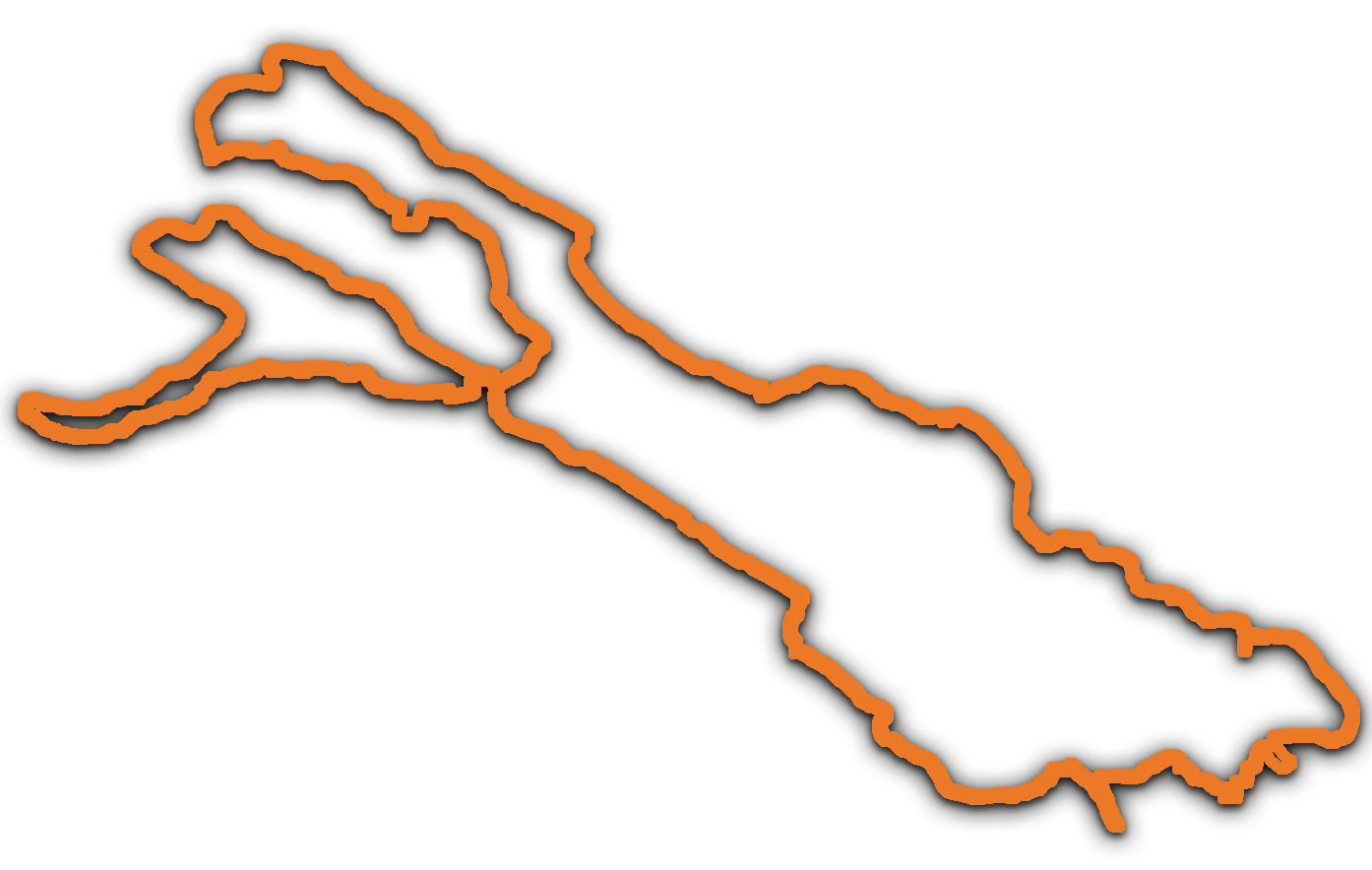

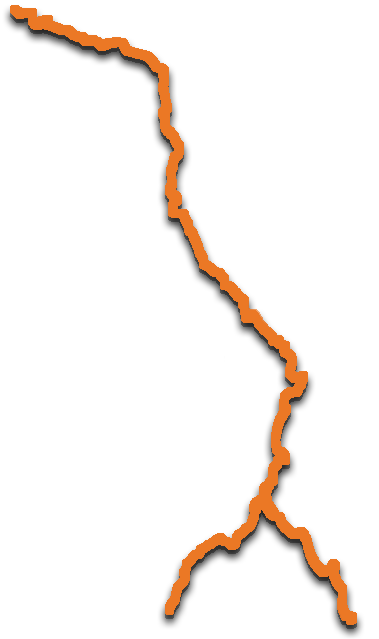
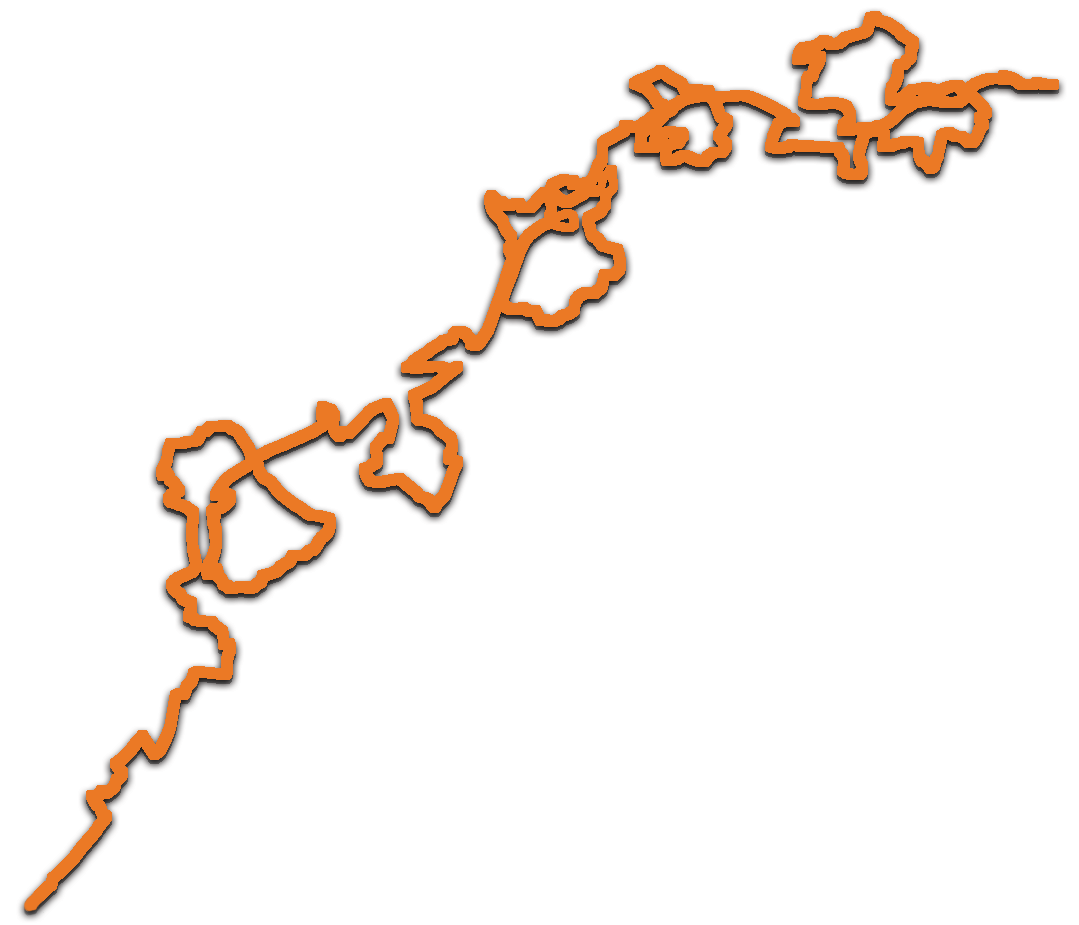
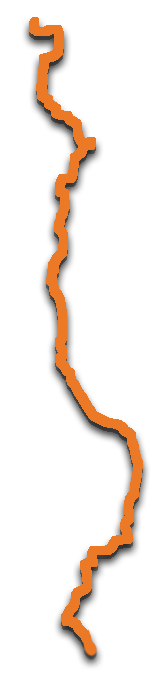












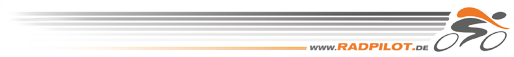







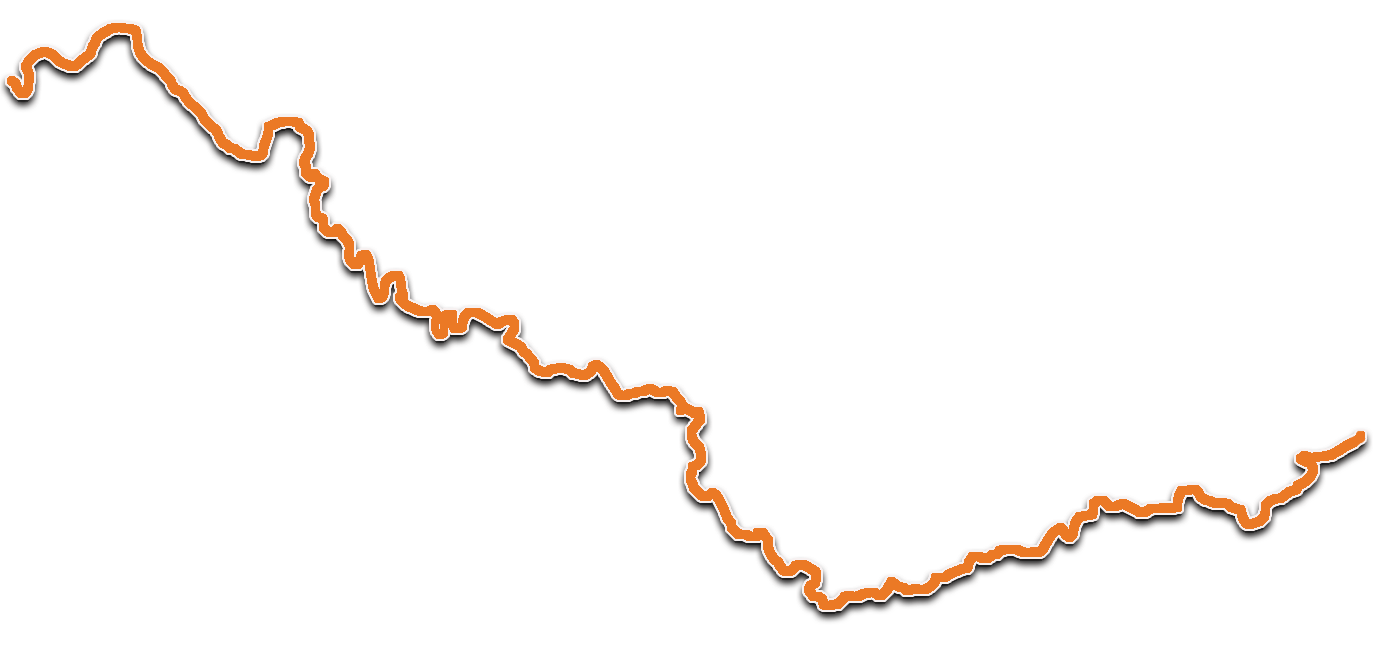

















































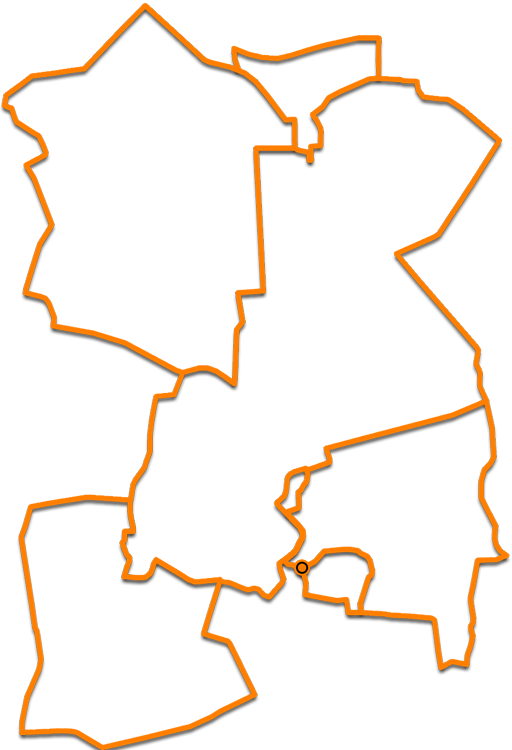





















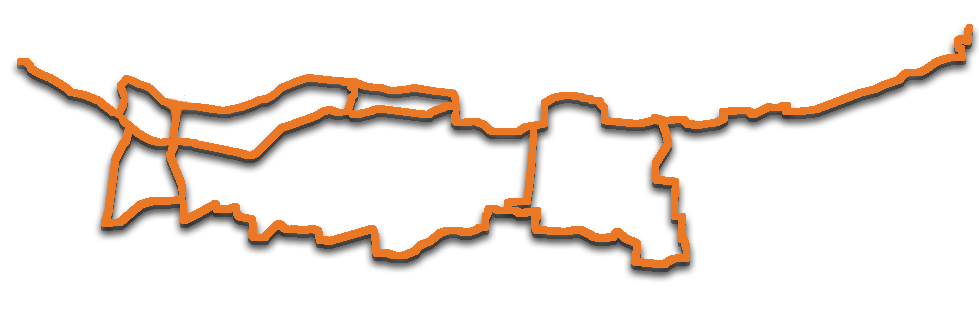











































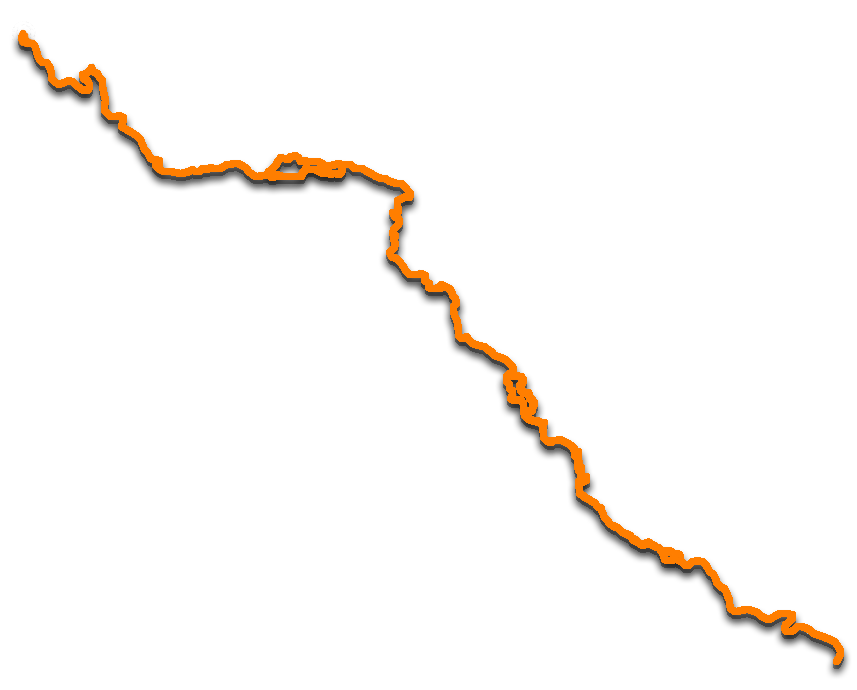










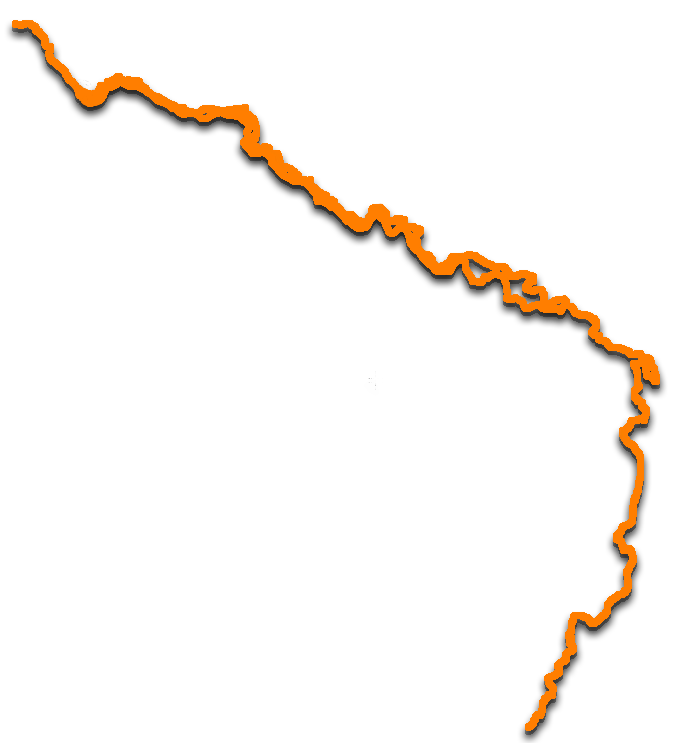











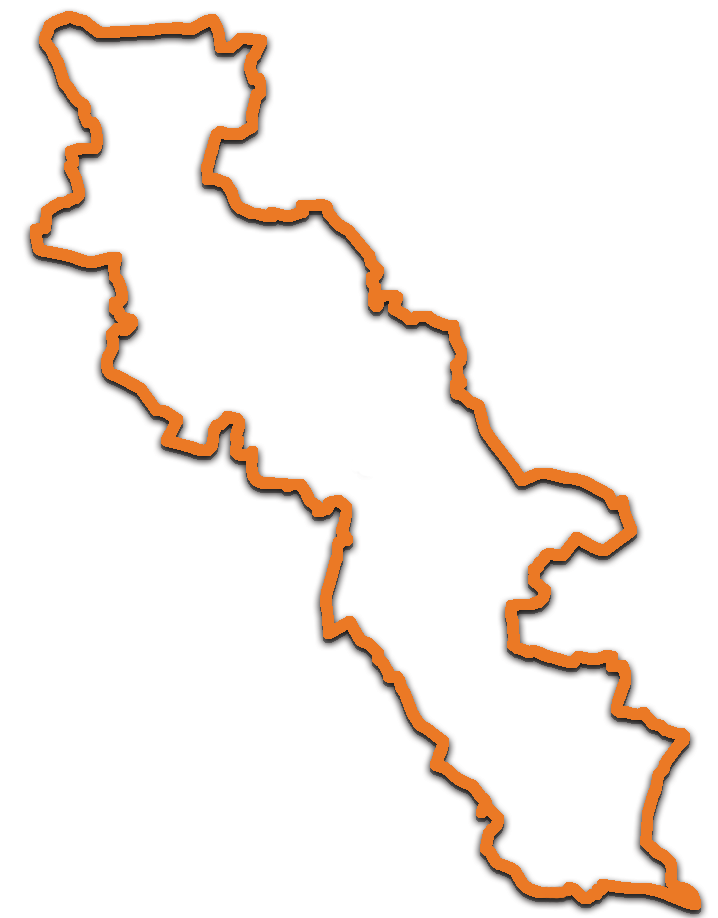

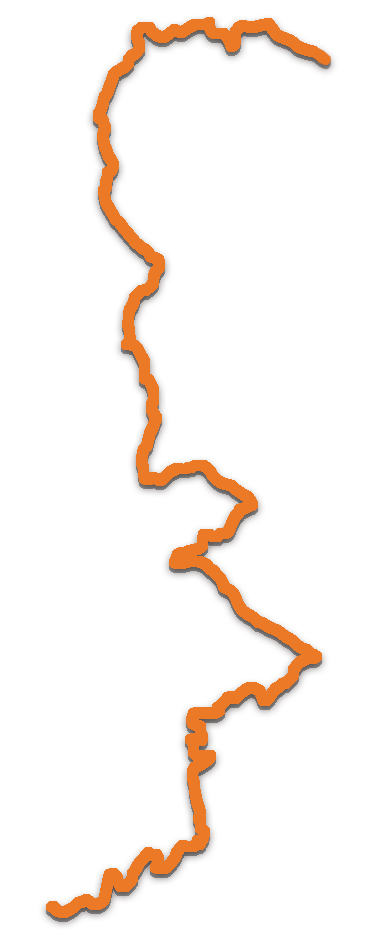














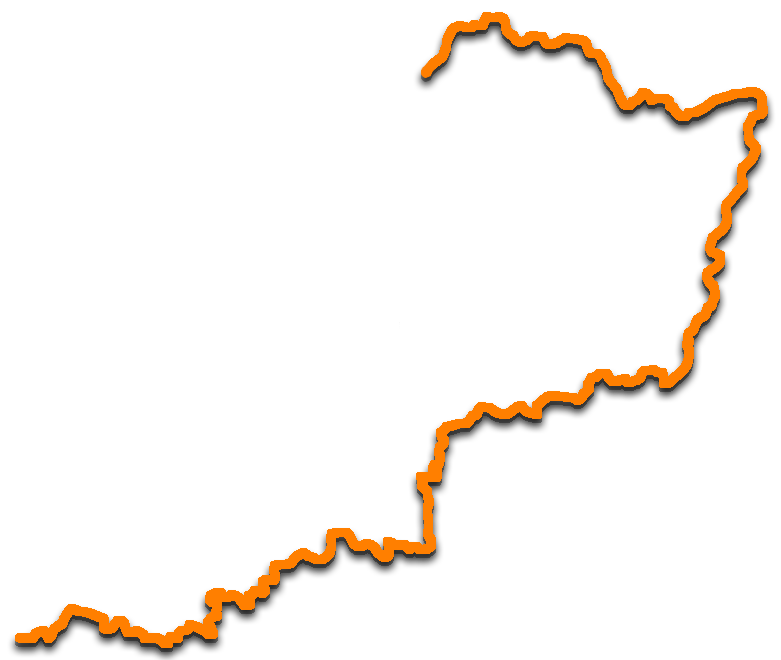
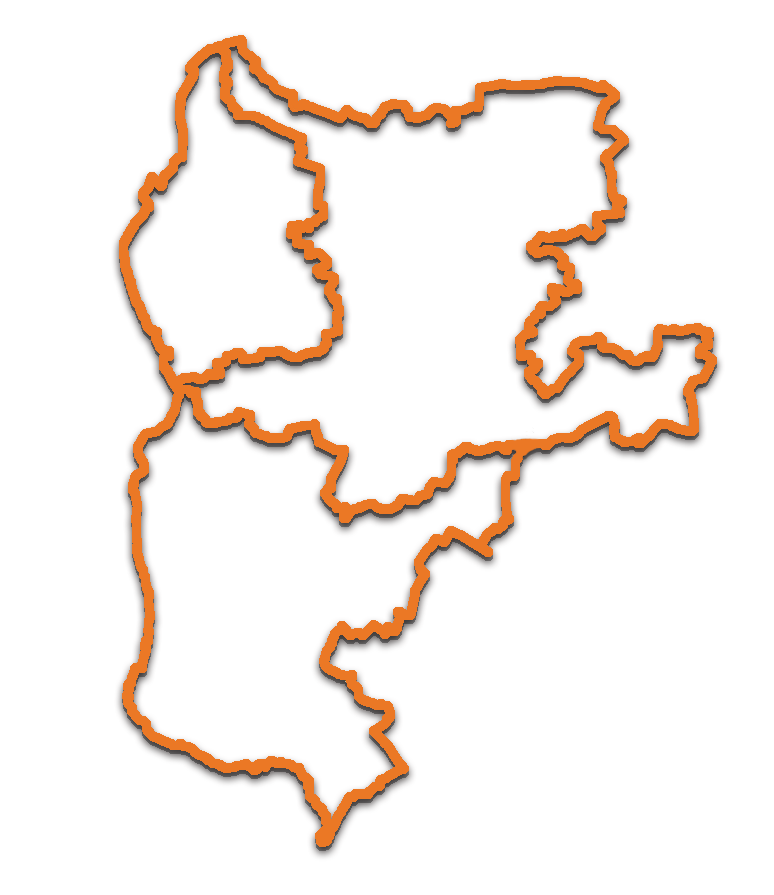
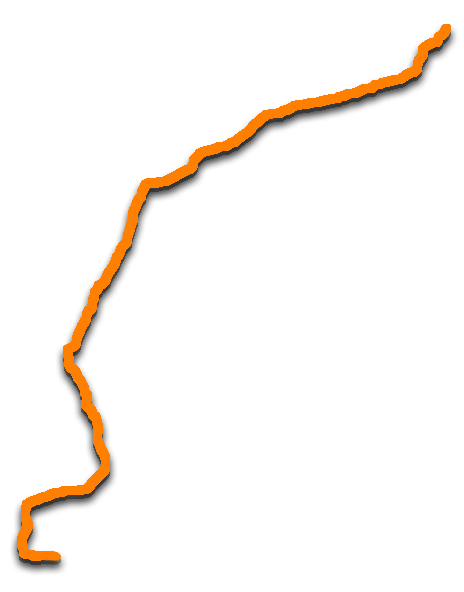
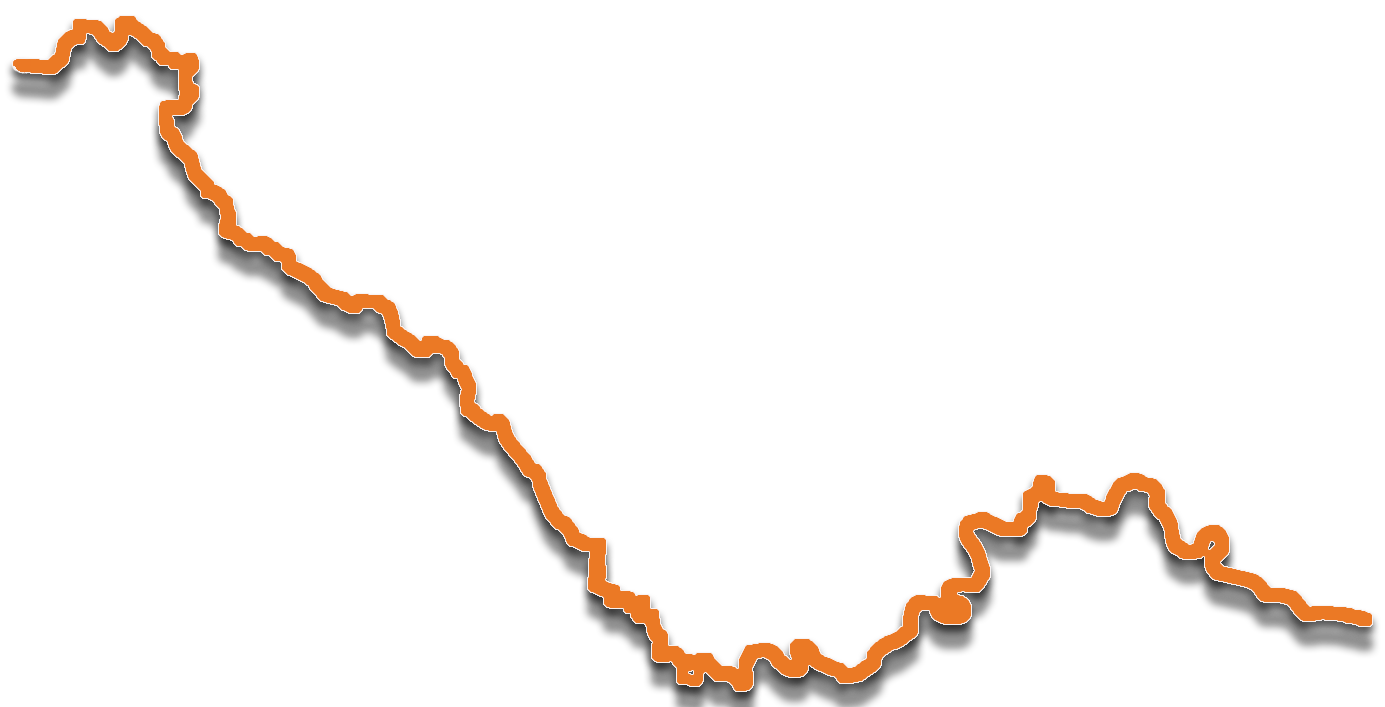
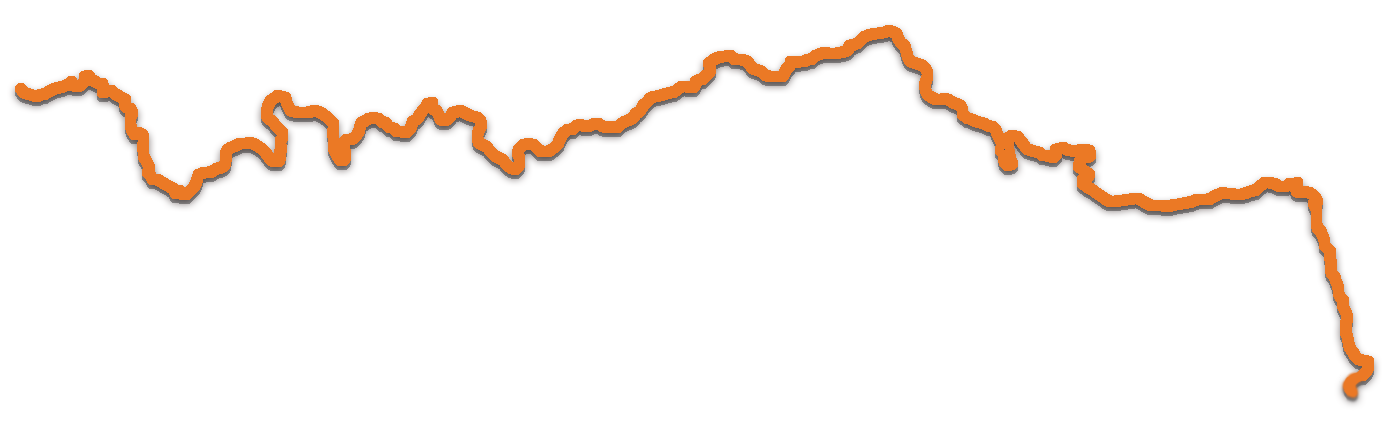
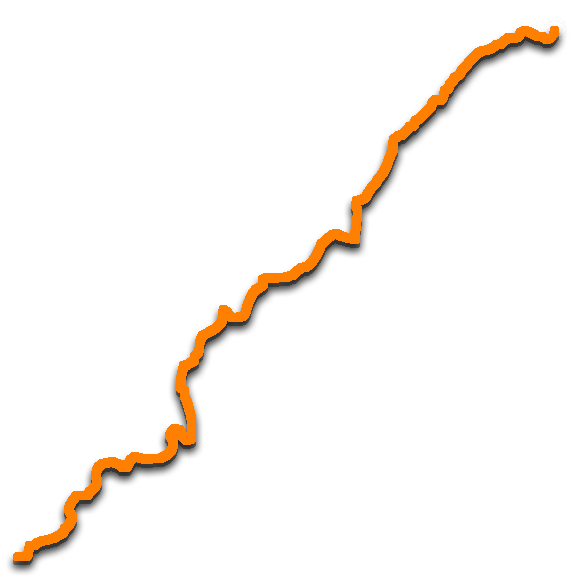




 e
e