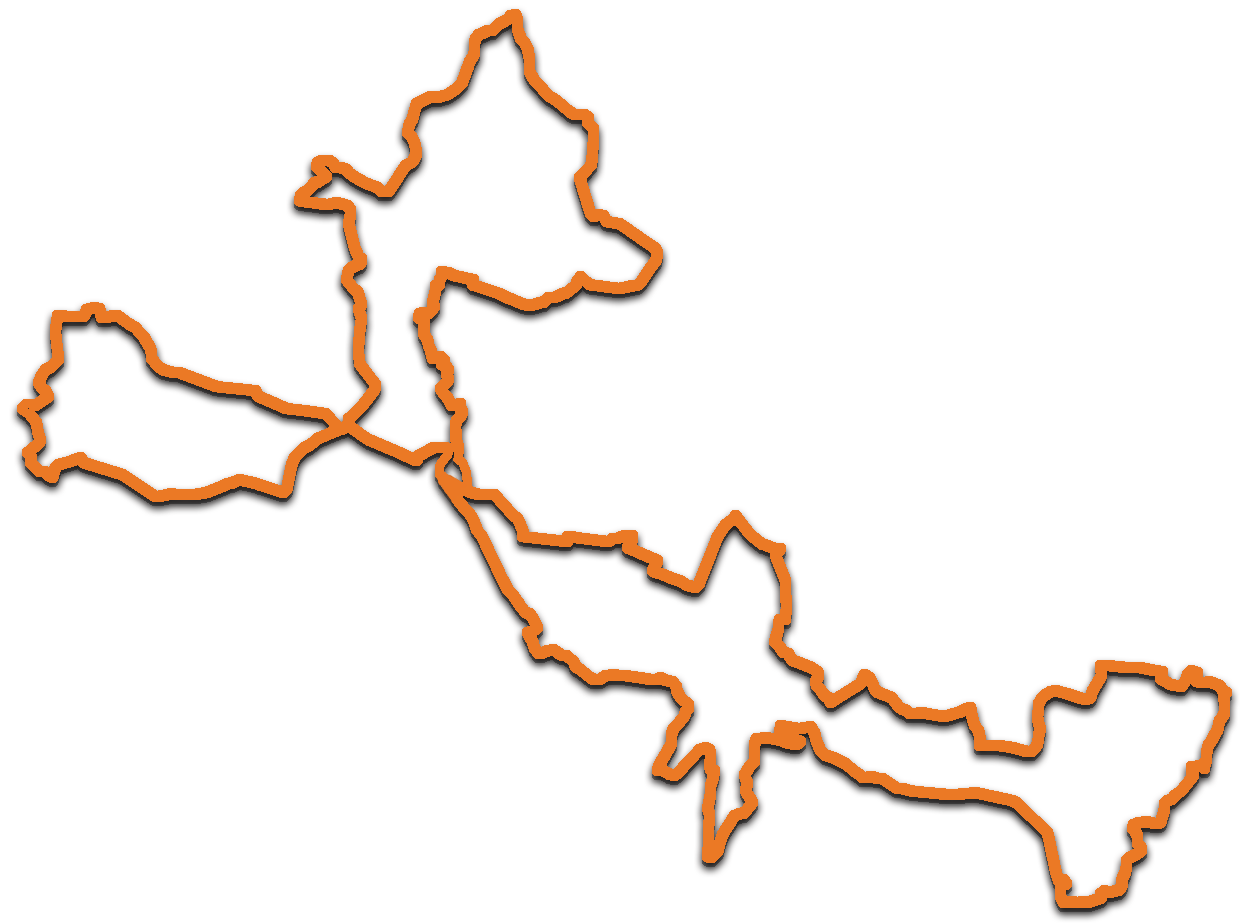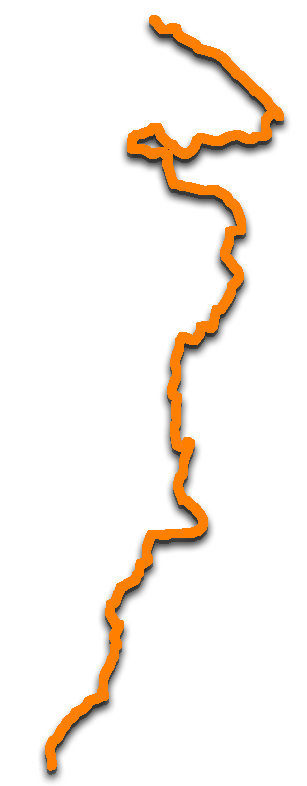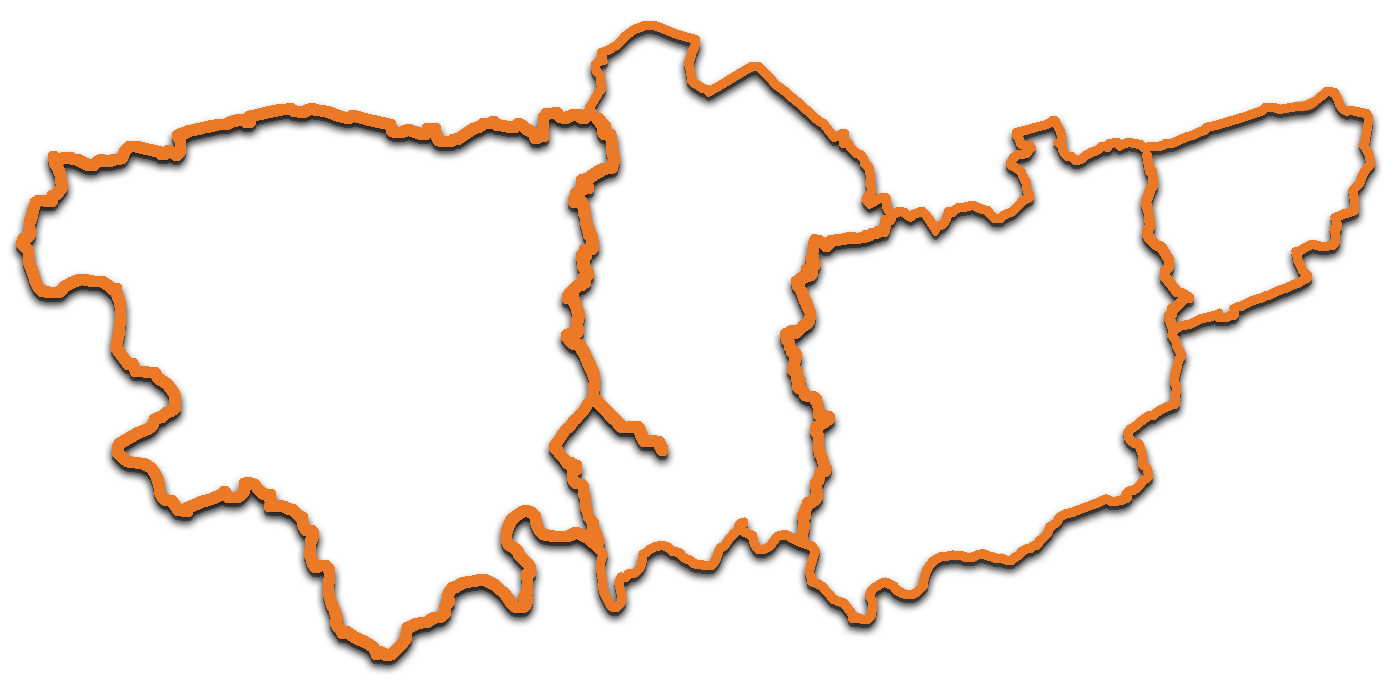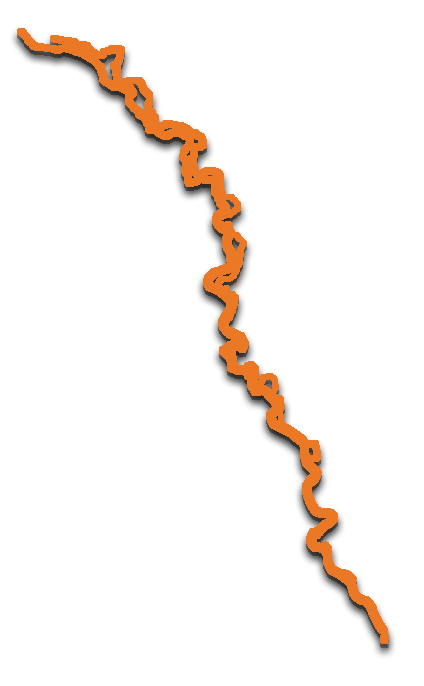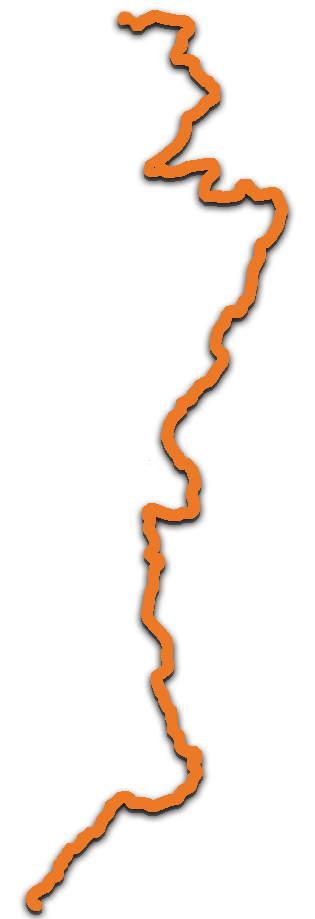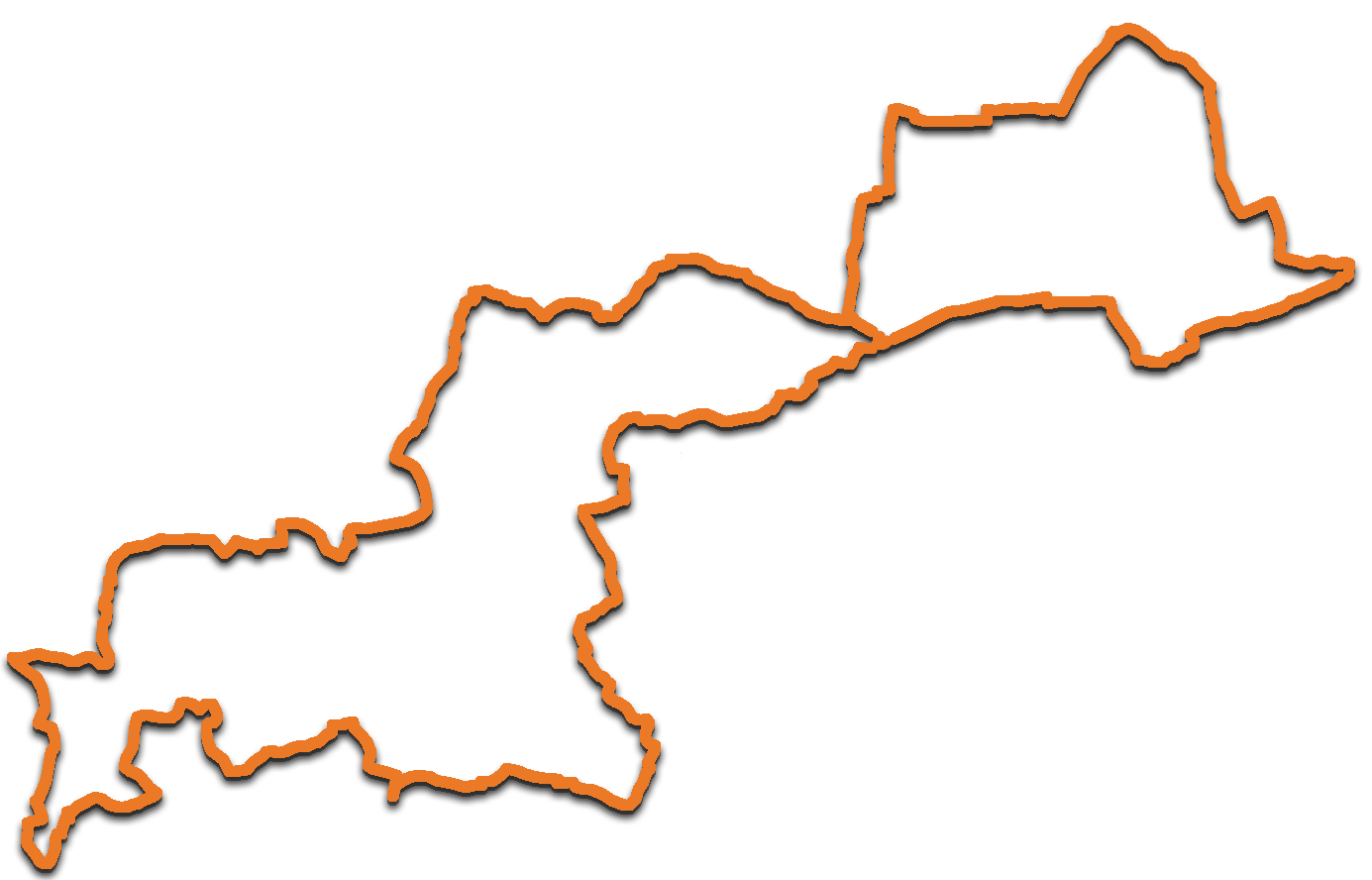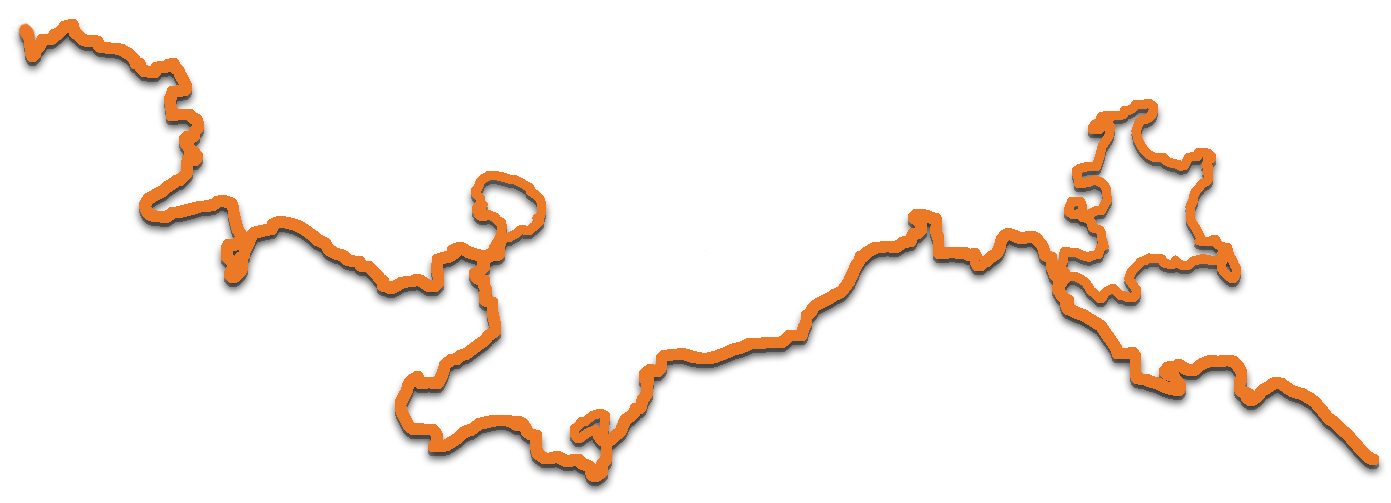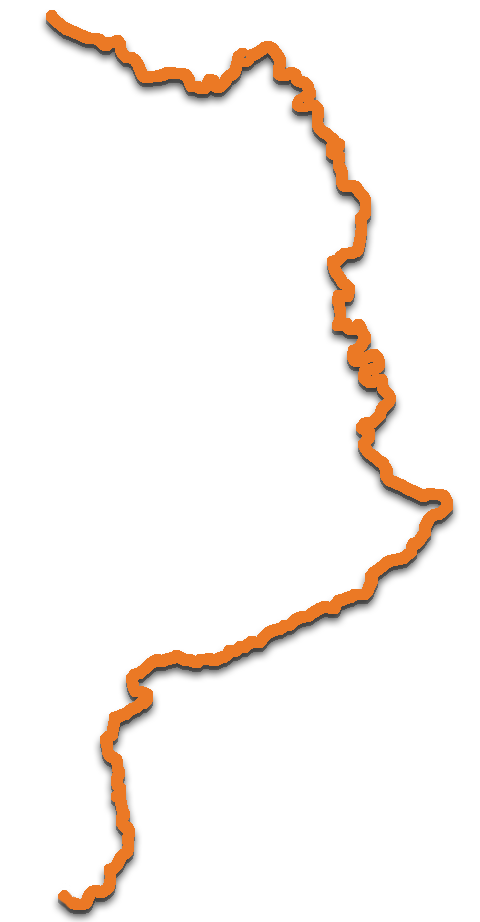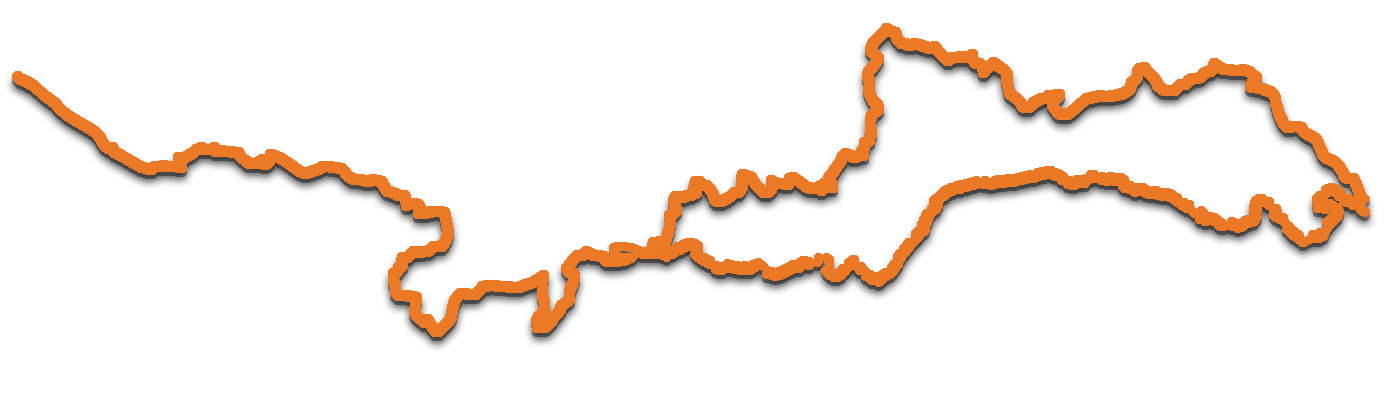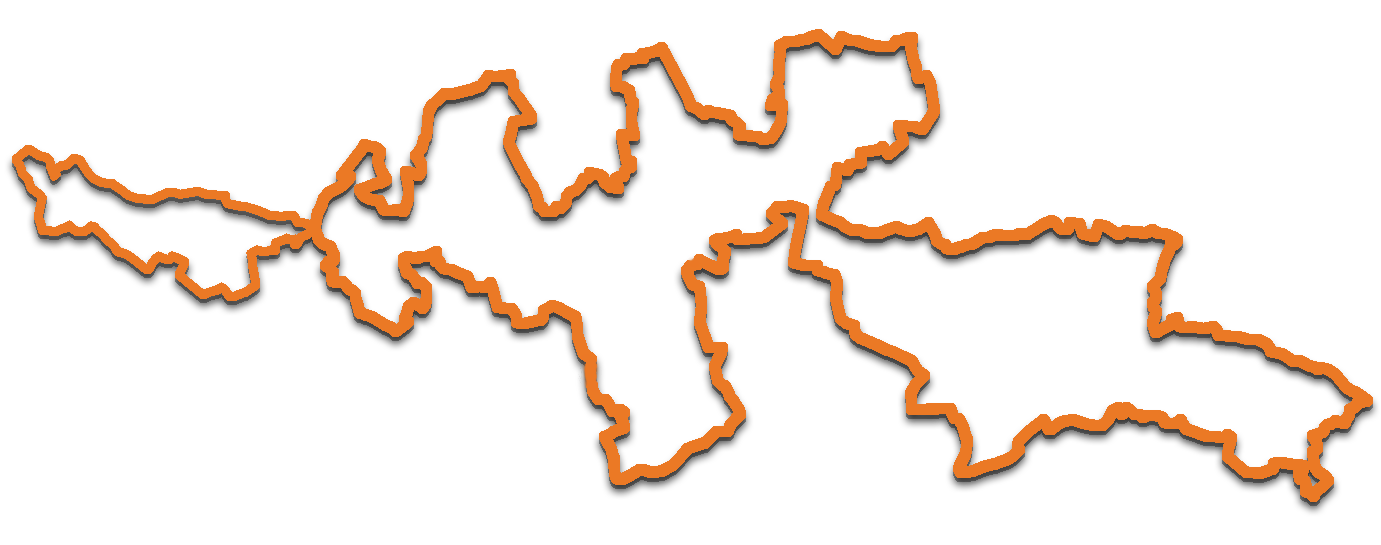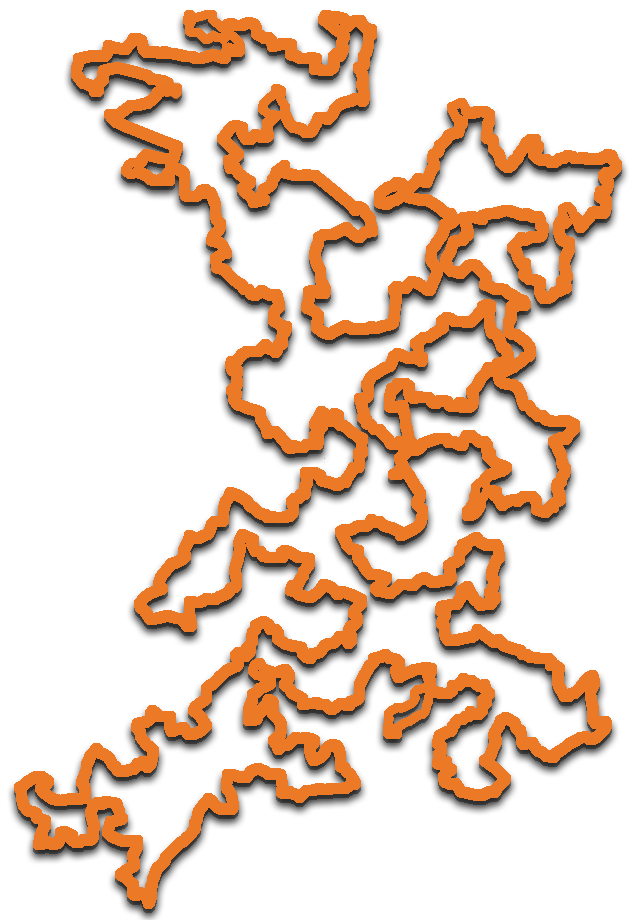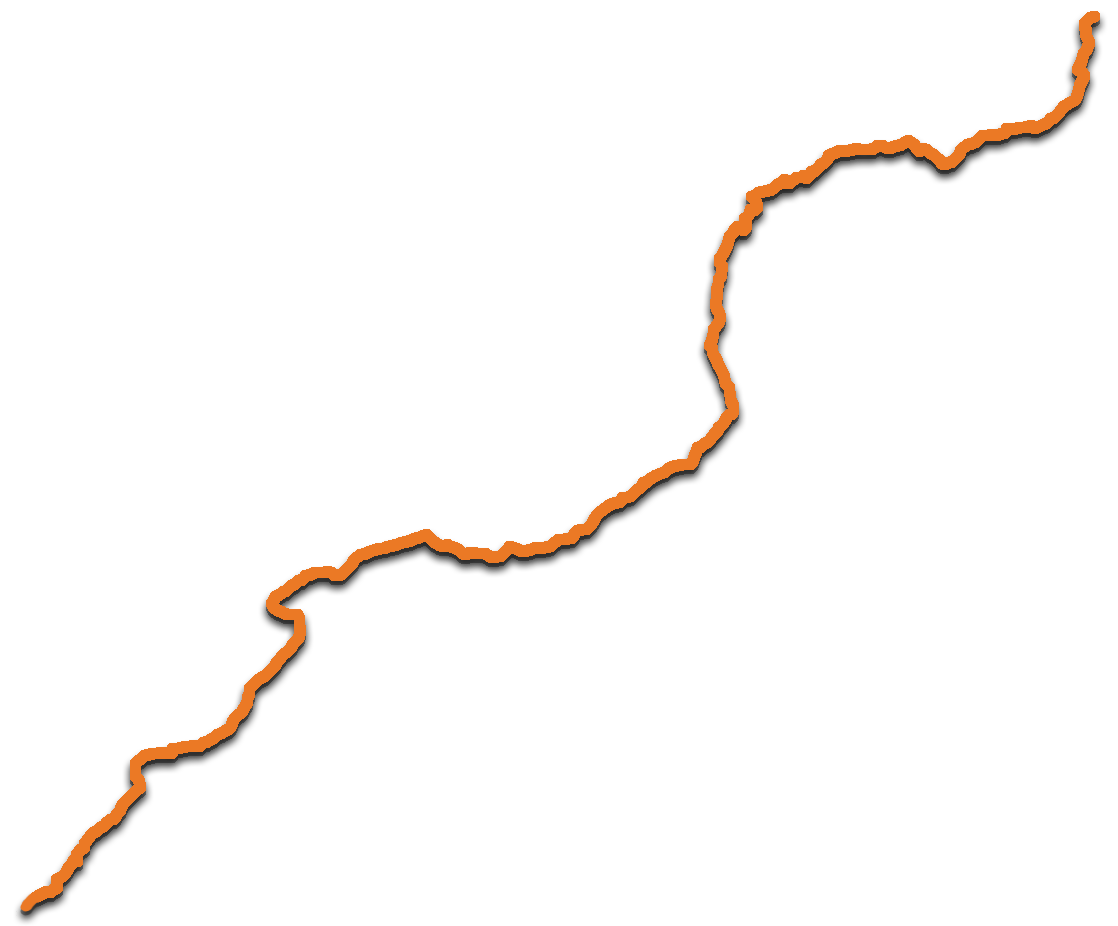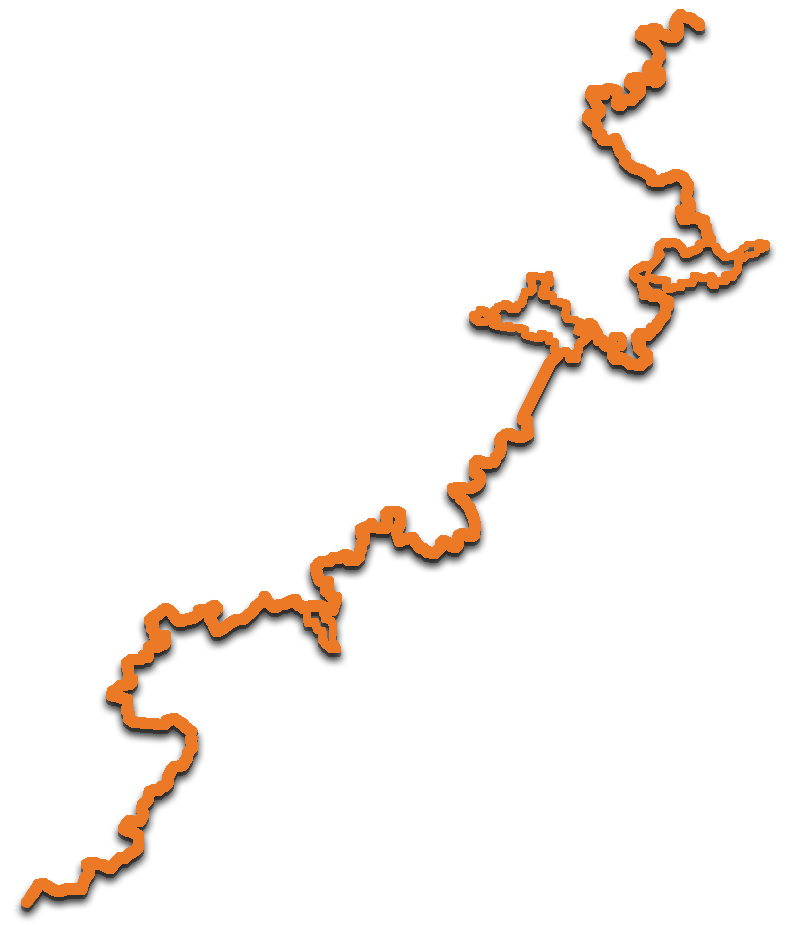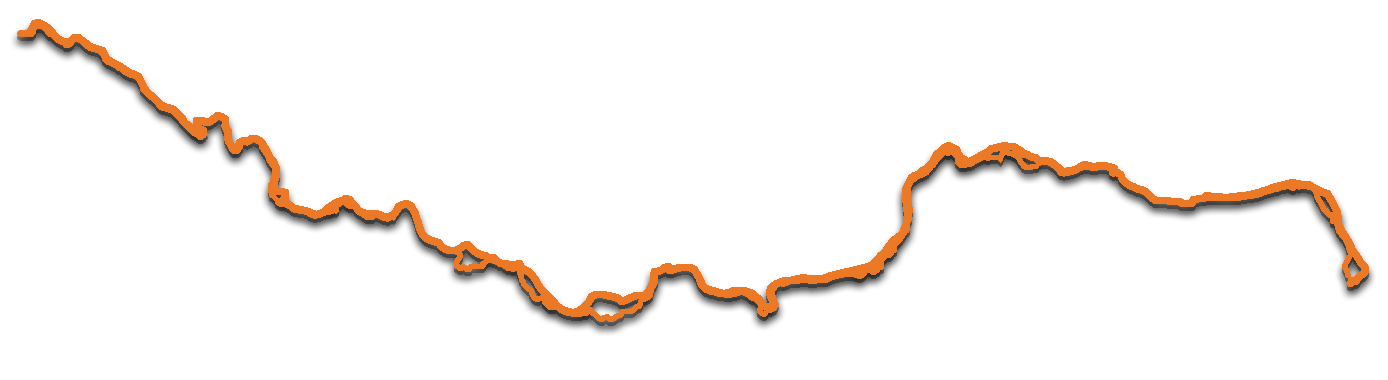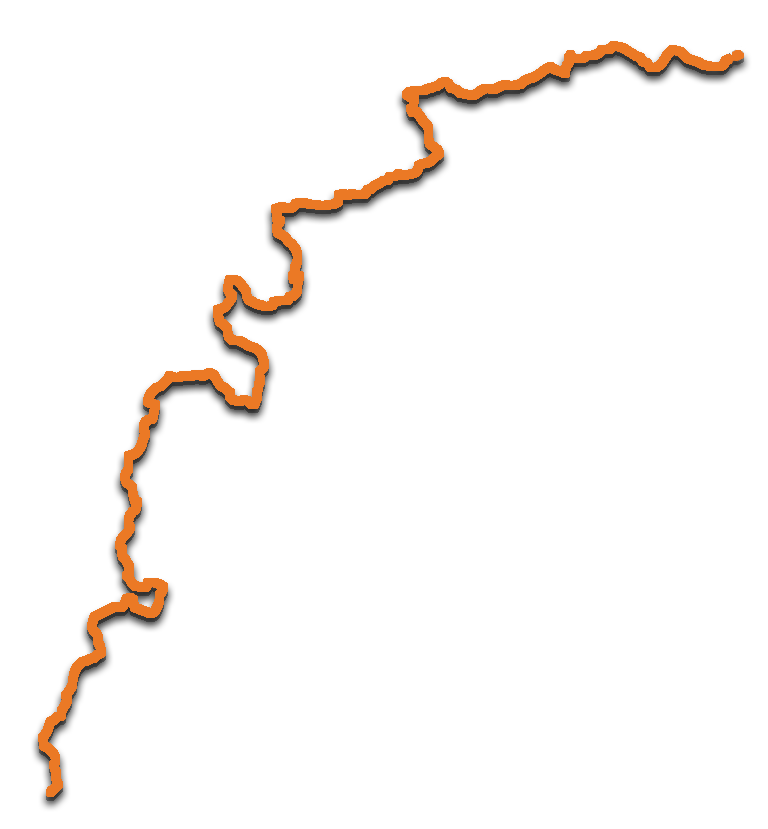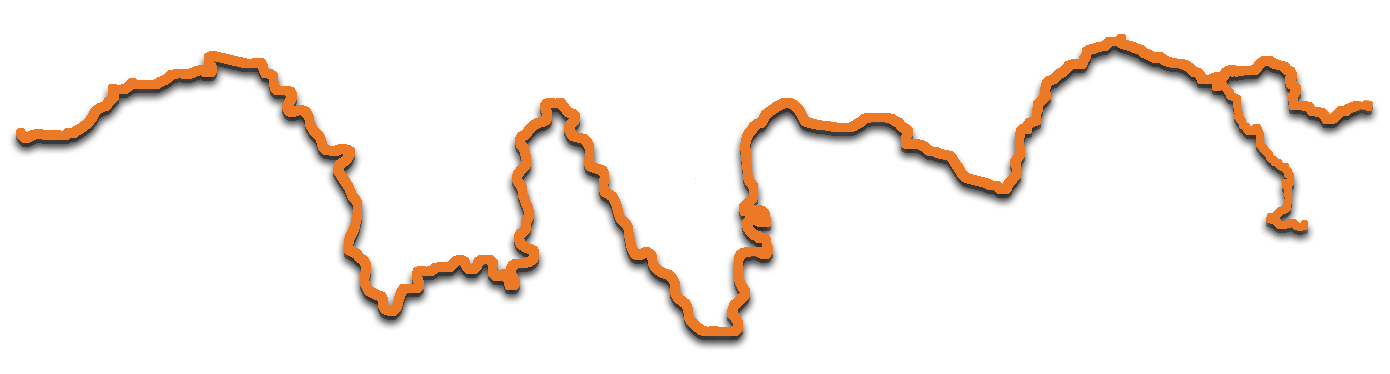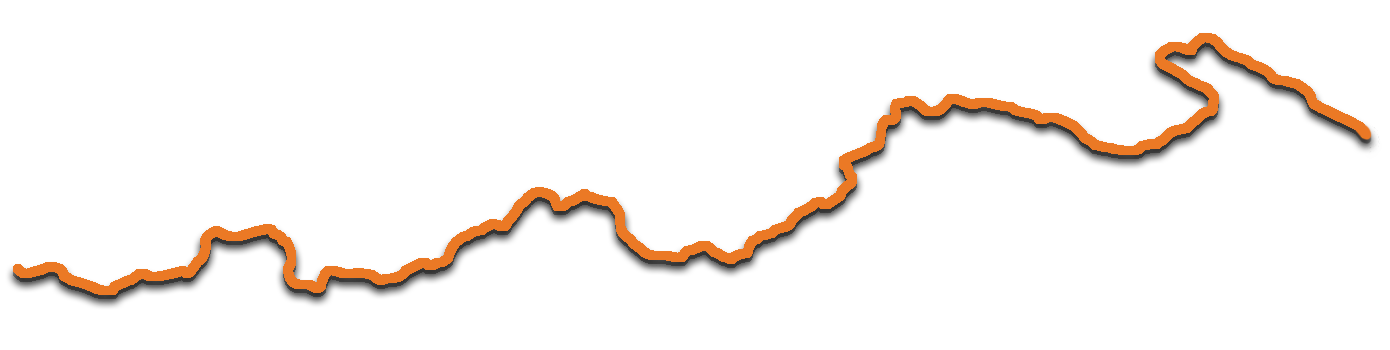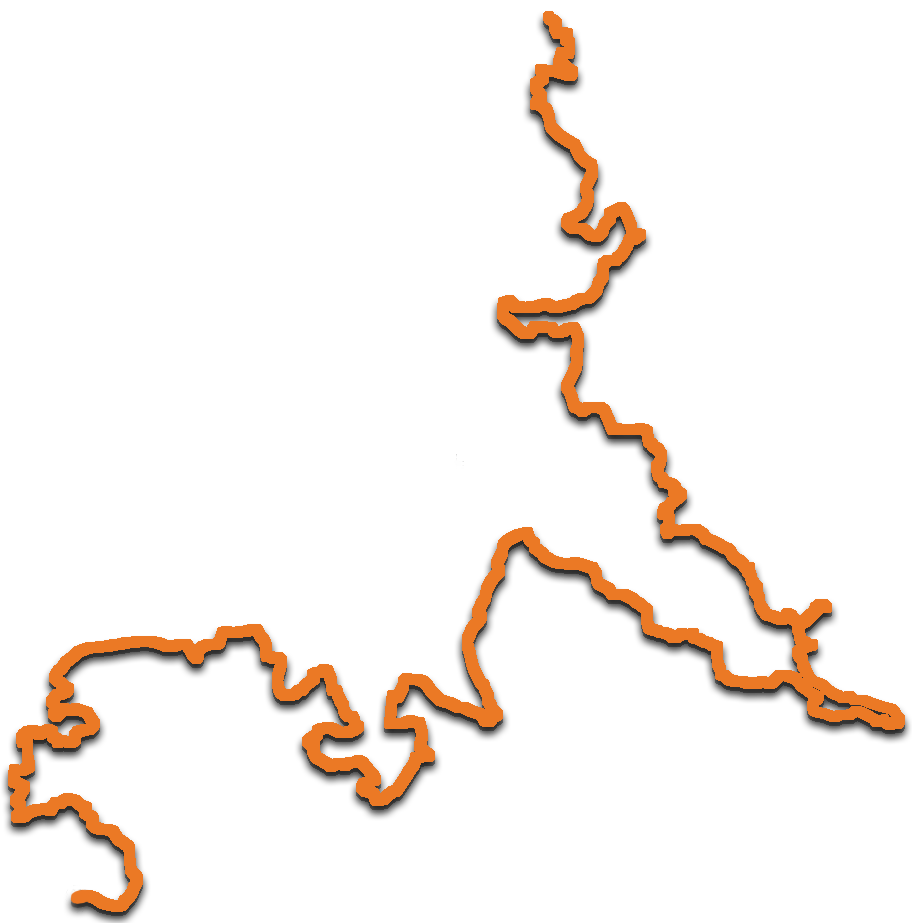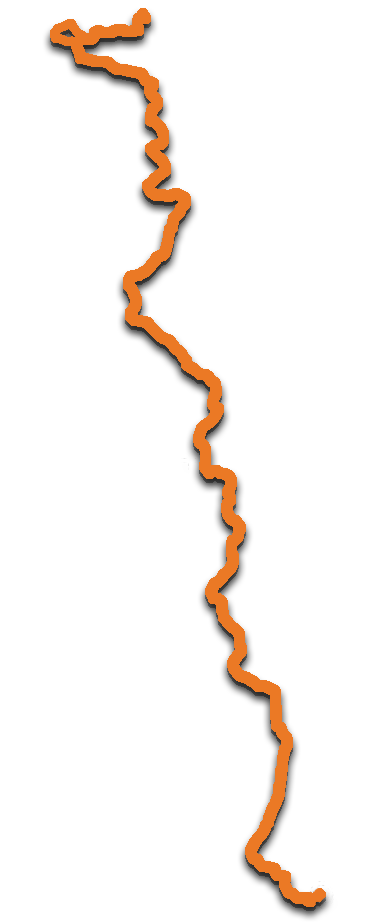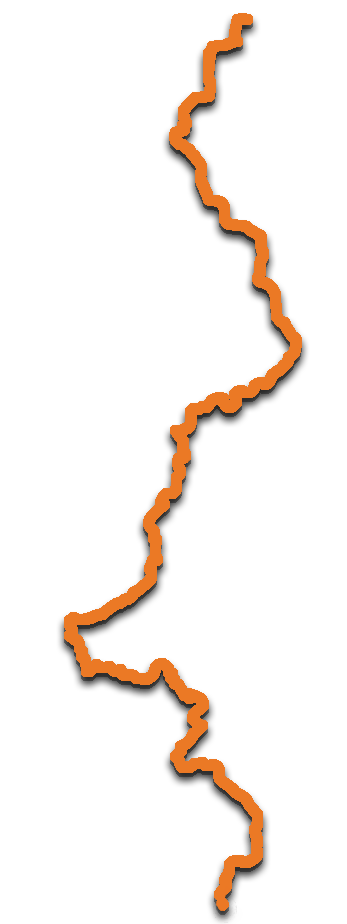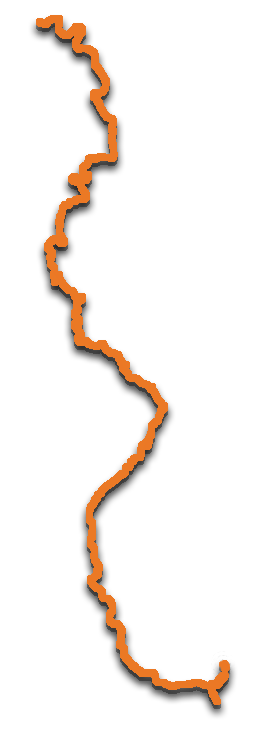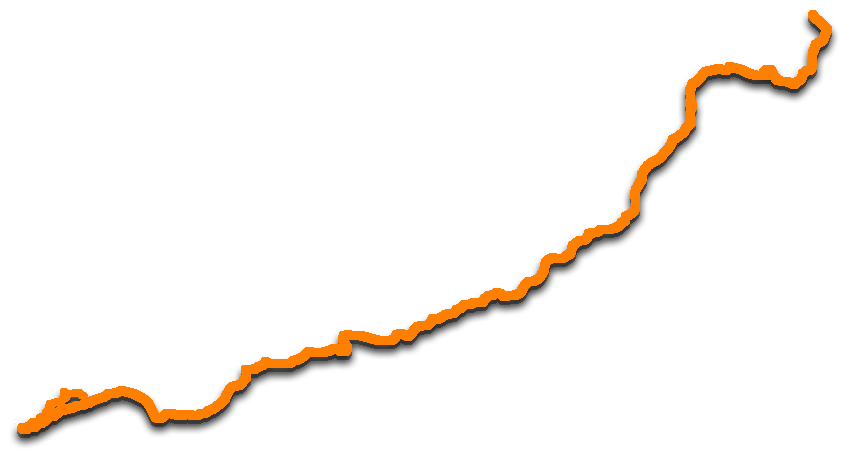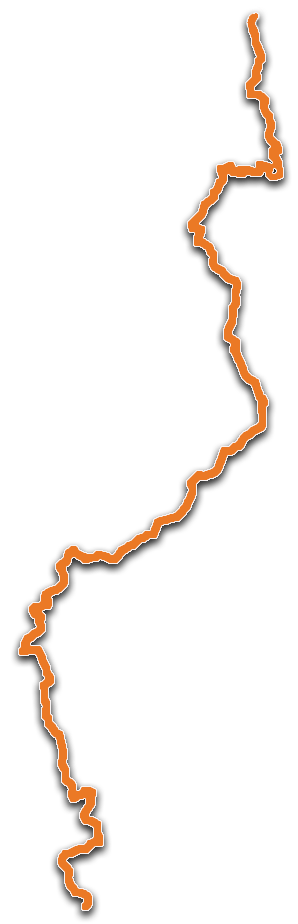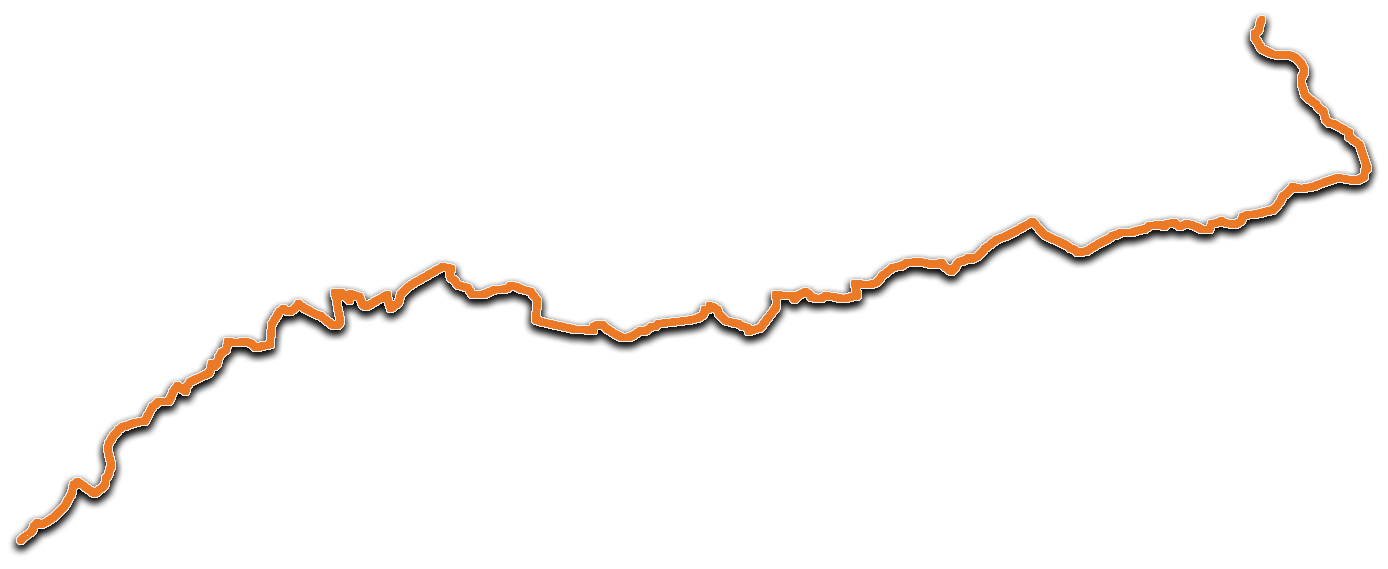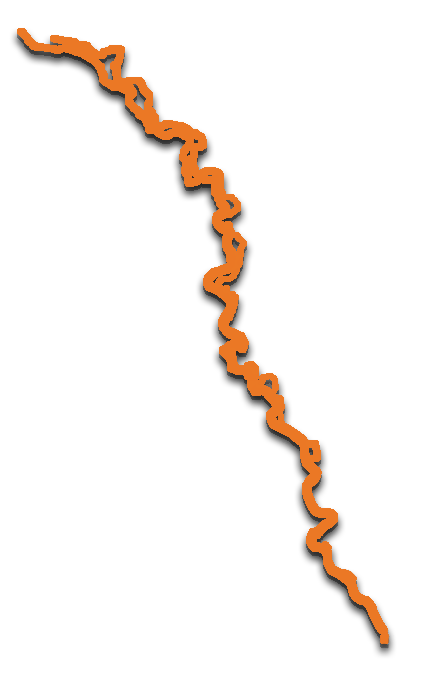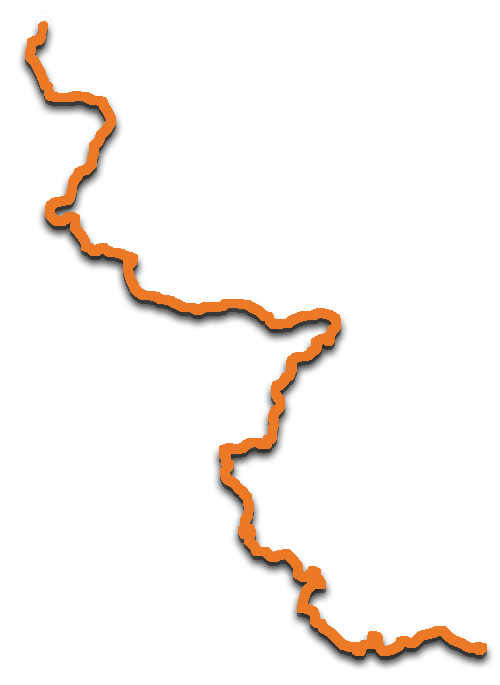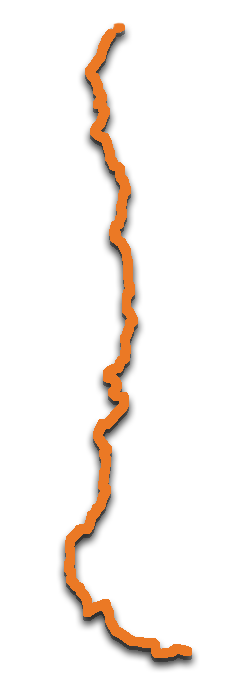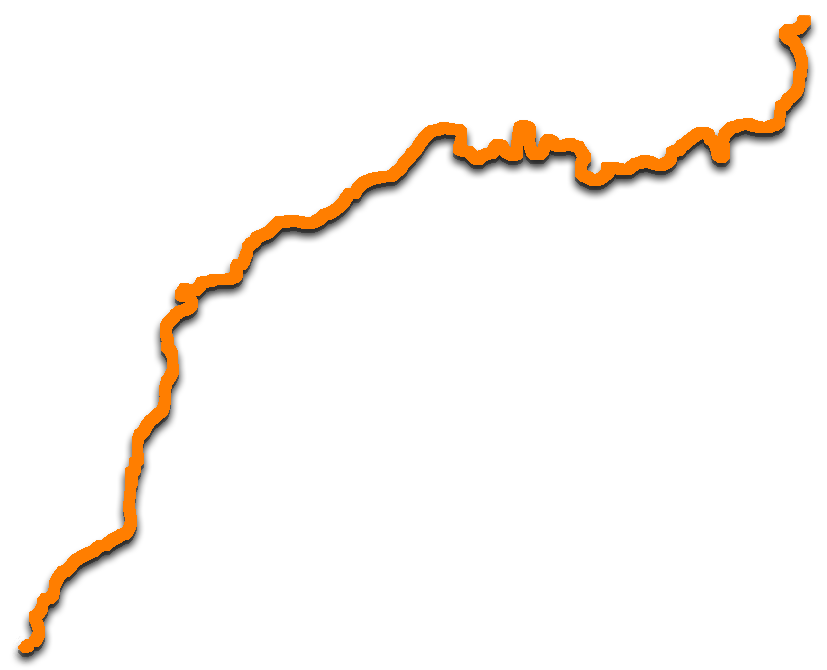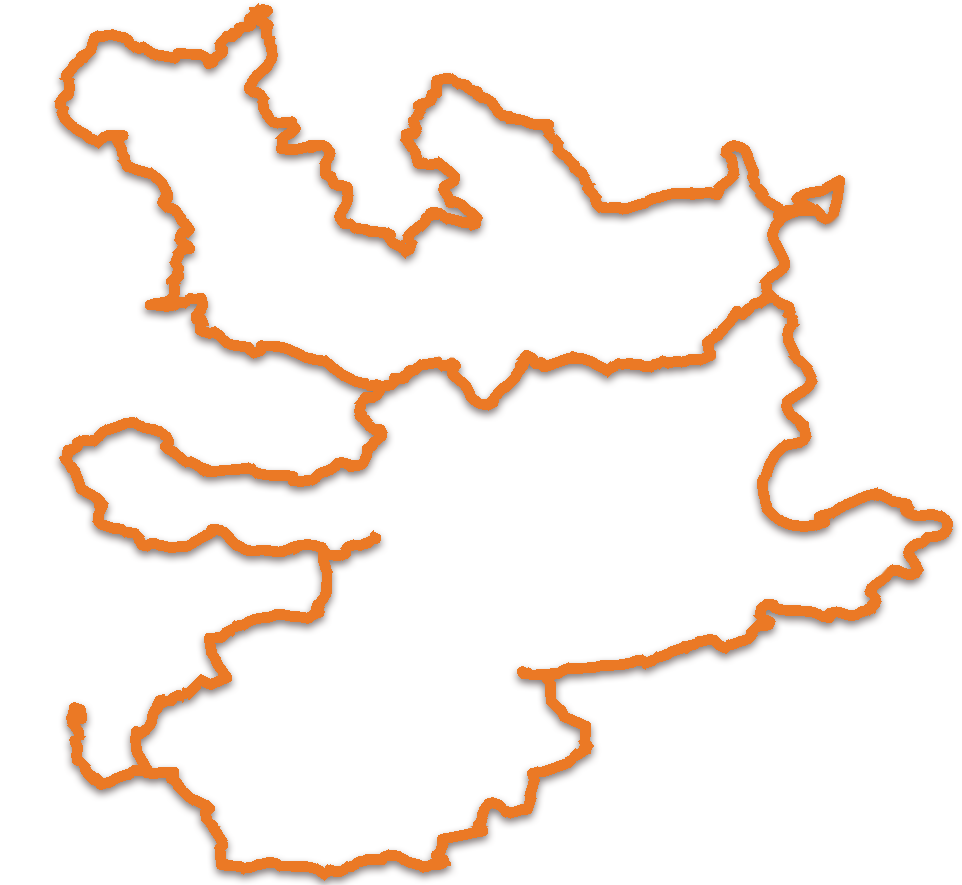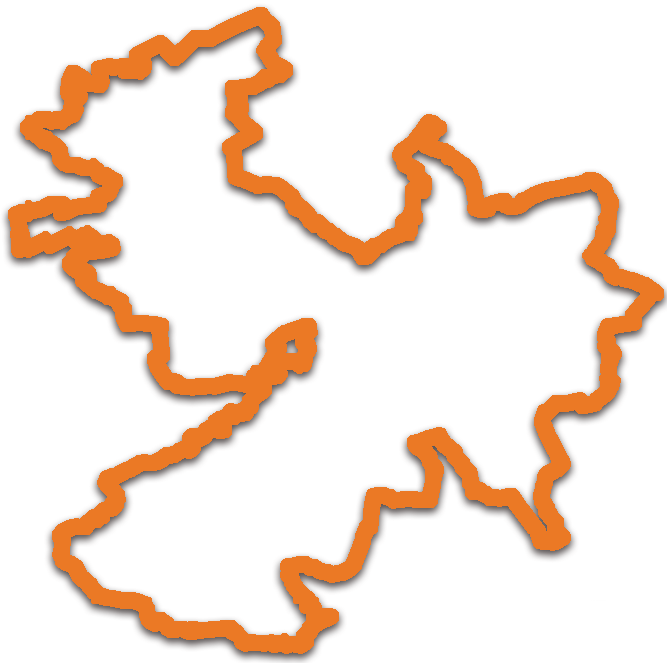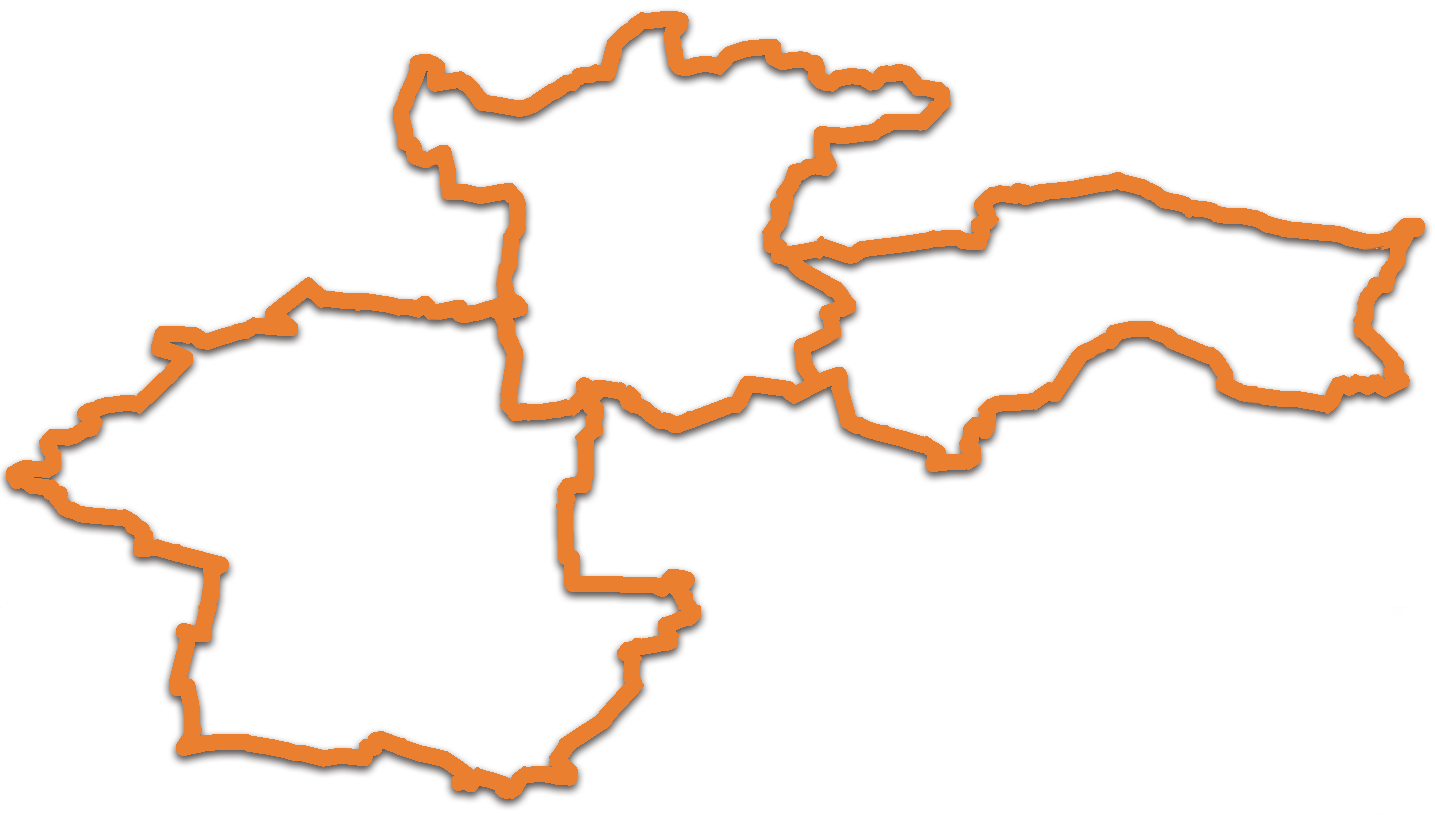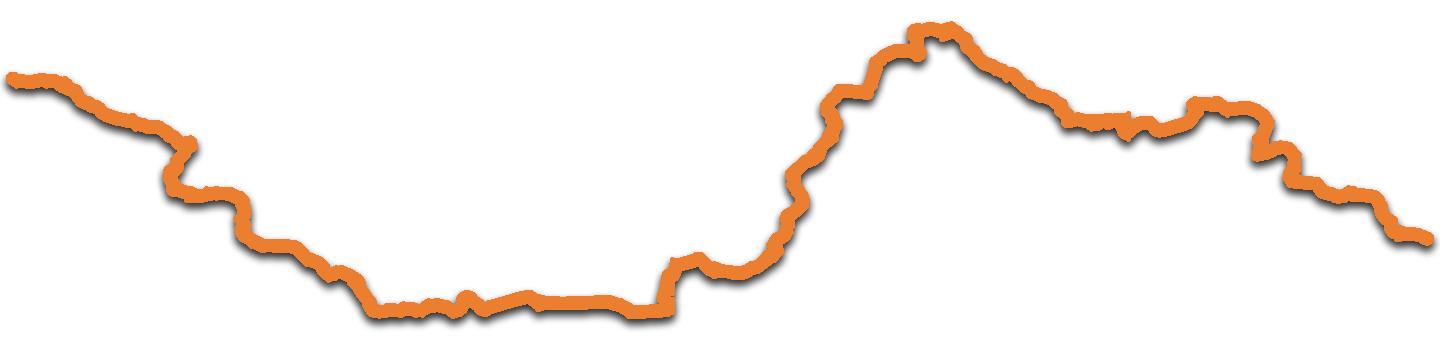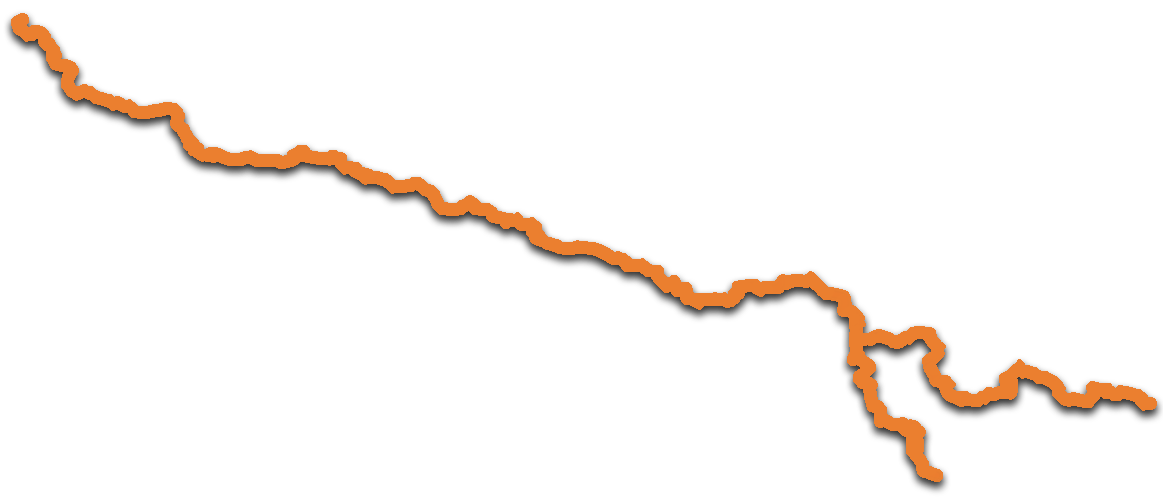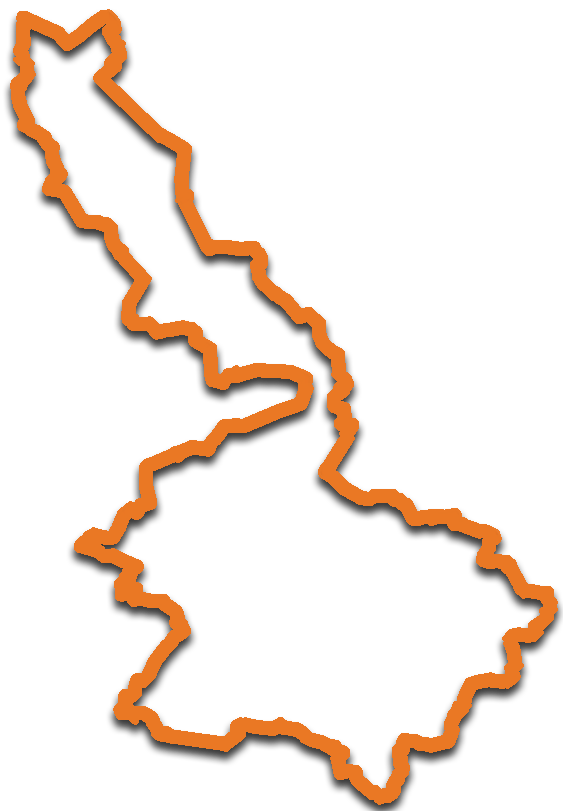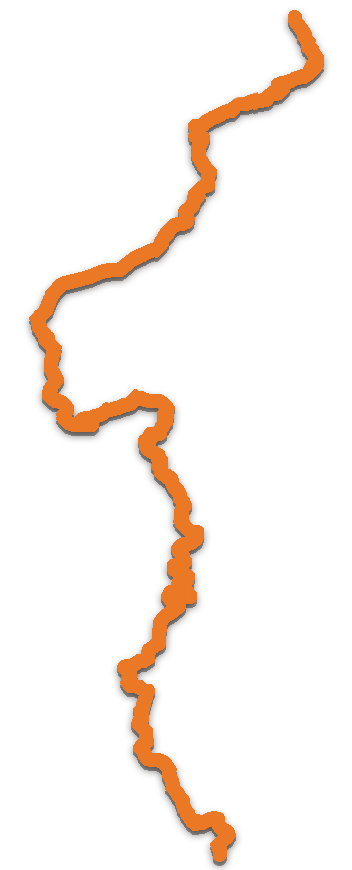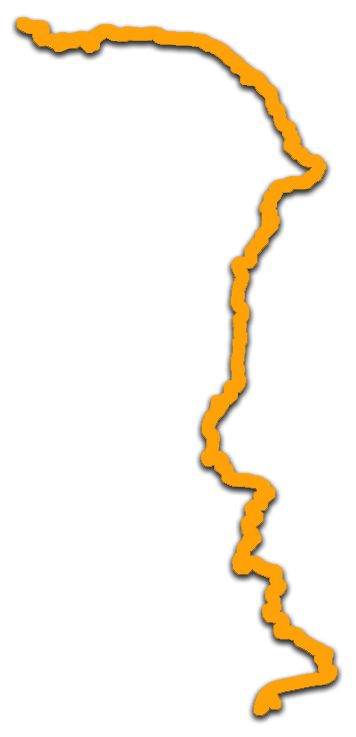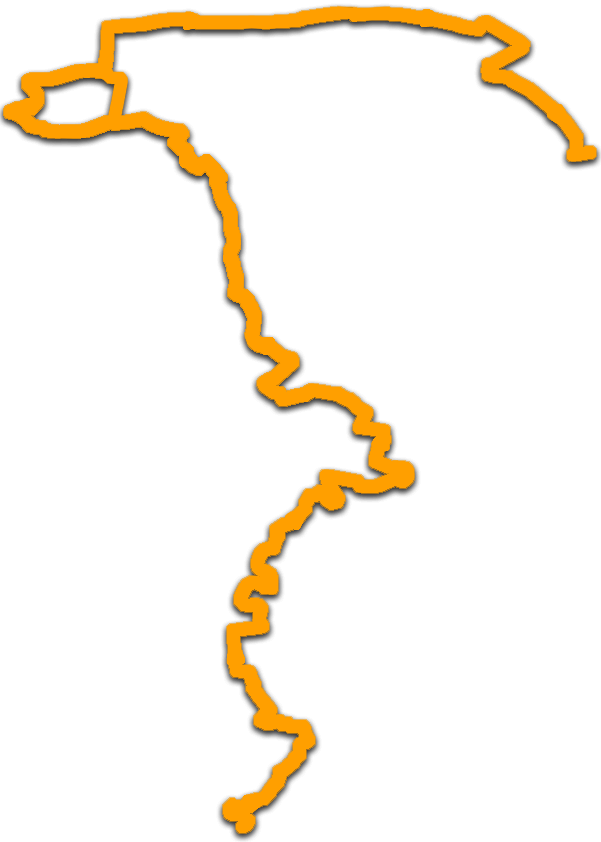Nordseeküstenradweg (North Sea Cycle Route)
er Nordseeküsten-Radweg ist der längste ausgeschilderte Radfernweg der Welt. Er führt über fast 6.000 Kilometer immer der Nordseeküste entlang durch mehrere europäische Länder: die Niederlande, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und Großbritannien. International heißt der Radweg, der im Jahr 2001 als EuroVelo-Radweg Nr. 12 eröffnet wurde, ‚North Sea Cycle Route‘. Gut 900 km verläuft die Mammut-Tour durch Deutschland, der norwegische Teil ist 1.130 Kilometer lang, und der britische Abschnitt ist mit 2.300 Kilometern am längsten. Um die gesamte Tour abzufahren, muss man schon etwas Zeit einplanen – dafür werden spektakuläre Landschaften und interessante Städte in verschiedenen europäischen Ländern durchfahren. In jedem Land besitzt die Route eine andere Charakteristik – überall weist sie andere typischen Merkmale auf. In Deutschland zeigt sich zwischen der Ems bis an die Elbe fast überall das gleiche Bild: das Ufer wird von Stränden oder Salzwiesen gesäumt und Buhnen ragen weit hinaus ins Wasser. ‚Vör’n Diek‘ und ‚achter’n Diek‘ (vor und hinter dem Deich) verlaufen Versorgungsstraßen und auch auf den 8,70 m hohen Deichen gibt es häufig Pfade, die zum Radfahren genutzt werden können. Ebbe und Flut wechseln sich stetig ab und so zieht sich das Meer, das eben noch mit seinen Wellen brausend ans Ufer schwappte in einem gut 12-stündigem Rhythmus kilometerweit auf die offene See zurück und erzeugt so eine bizarr-graue faszinierende und einzigartige Wattlandschaft.
Im Jahr 2003 wurde der 5942 km lange Radfernweg als die weltweit längste beschilderte Radroute in das Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Durchgängig befahrbar ist die Strecke natürlich nicht: ab und zu muss man auch einmal die Fähre nehmen! Der Radweg wurde ursprünglich 2001 als EuroVelo-Radweg Nr.12 eröffnet. In Deutschland ist er auch als D-Route 1 ausgeflaggt. Das in allen Ländern gebräuchliche Logo zeigt ein violettes Fahrrad in einem hellblauen, nach unten unterbrochenen Kreis und zwei grüne Linien. Das deutsche Teilstück führt über rund 905 km von der niederländischen Grenze bei Bunde über Leer, Emden, Norden, Jever zum
Jadebusen nach Wilhelmshaven, weiter über Varel, die Halbinsel Butjadingen, über die Weser nach Bremerhaven, Cuxhaven, der Elbe entlang bis Hamburg, Uetersen, Glückstadt, Brunsbüttel und Husum mit dem Eidersperrwerk bis an die dänische Grenze. Für einen Fahrradfahrer ist allein der deutsche Abschnitt eine Weltreise! An zig-tausenden von Schafen vorbei führt die Strecke durch die salzhaltige Luft der Marsch- und Küstenregion und lässt den Radler dabei die einzigartige Kulturregion mit dem von der UNESCO geschützten Nationalpark Wattenmeer erfahren. Die Weite des Meeres vermittelt tatsächlich so etwas wie Freiheit! Ab und zu geht es allerdings auch einmal etwas landeinwärts, um einen Abstecher in einen größeren Ort zu machen. Bei Cuxhaven folgt der Radfernweg der Elbe sogar bis nach Hamburg, um danach an der nördlichen Seite durch Schleswig-Holstein weiterzuführen.
Da die Nordseeküstenregion touristisch sehr gut erschlossen ist, finden sich auch fast in jedem Ort Fahrrad-Verleihstationen, so dass man auch als Urlauber Teilstücke dieser faszinierenden Route fahren kann.
Aber aufgepasst: Während der Sommerferien in der Hochsaison sind die Unterkünfte auch schon einmal ausgebucht und bei vielen Anbietern von Ferienwohnungen sind Radfahrer, die nur eine Nacht bleiben wollen, nicht unbedingt erwünscht. Aber ansonsten ist der Weltrekordhalter eine abwechslungsreiche Top-Strecke mit häufigem Blickkontakt auf das weite Meer!
Charakteristik:
Der deutsche Abschnitt des Nordseeküstenradweges ist ein ausgesprochen familienfreundlicher Strecke. Die höchsten Erhebungen sind die Dünen und Deiche, ansonsten ist der Radfernweg völlig flach. Er führt meist abseits des Autoverkehrs auf einem der Wege direkt vor oder hinter dem Deich. Die Radwege sind in aller Regel sehr gut ausgebaut. Der vorherrschenden Windrichtung zufolge ist allerdings der Routenverlauf von West nach Ost dringendst zu empfehlen!
Ortschaften entlang der Route
Bunde / Weener / Leer (Ostfriesland) / Jemgum / Emden / Krummhörn / Wirdum / Osteel / Norden (Ostfriesland) / Hagermarsch / Dornum / Holtgast / Esens / Neuharlingersiel / Wittmund / Jever / Wangerland / Wilhelmshaven / Sande (Friesland) / Bockhorn / Varel / Jade / Stadland / Butjadingen / Nordenham / Bremerhaven / Geestland / Wurster Nordseeküste / Cuxhaven / Otterndorf / Osterbruch / Bülkau / Cadenberge / Wingst / Hemmoor / Großenwörden / Engelschoff / Himmelpforten / Hammah / Stade / Hollern-Twielenfleth / Steinkirchen (Altes Land) / Grünendeich / Mittelnkirchen / Guderhandviertel / Jork / Hamburg-Harburg / Hamburg-Finkenwerder / Hamburg-Altona / Hamburg–Blankenese / Wedel / Hetlingen / Haselau / Haseldorf / Seestermühe / Neuendeich / Seester / Kollmar / Glückstadt / Brokdorf / Sankt Margarethen / Brunsbüttel / Ramhusen / Eddelak / Kuden / St. Michaelisdonn / Gudendorf / Windbergen / Meldorf / Nordermeldorf / Warwerort / Büsumer Deichhausen / Büsum / Westerdeichstrich / Hedwigenkoog / Hellschen-Heringsand-Unterschaar / Hillgroven / Wesselburenerkoog / Vollerwieck / Grothusenkoog / Sankt Peter-Ording / Tating / Garding / Katharinenheerd / Oldenswort / Norderfriedrichskoog / Uelvesbüll / Simonsberg / Husum / Wobbenbüll / Nordstrand / Elisabeth-Sophien-Koog / Reußenköge / Ockholm / Dagebüll / Galmsbüll / Niebüll / Uphusum / Neukirchen (Nordfriesland) / Aventoft
Butjadingen
ernab jeder Hektik endet die Wesermarsch im Norden auf einer geruhsamer Halbinsel, die auf der Karte so aussieht wie ein Robbenkopf: das Butjadinger Land. Es wird eingerahmt vom Jadebusen, der Innenjade und der Weser. Dementsprechend wird dieser gemütliche Landstrich geprägt durch saftig grünes Wiesenland sowie dem Nationalpark Wattenmeer, inzwischen von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Das Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel informiert ausführlich über diesen geschützten Lebensraum mit seinen regelmäßig wiederkehrenden Gezeiten. Die Form dieser Halbinsel hat sich übrigens erst in den letzten Jahrhunderten ausgeprägt, als man begann, das Land wirkungsvoll mit Deichen zu sichern. Davor war das Butjadinger Land ein Spielball der Sturmfluten und ständigen Veränderungen unterworfen war. Heute lädt das Butjadinger Land zu langen Spaziergängen auf dem Deich und am Strand ein oder zu ausgedehnten Fahrradtouren – aber nur, wenn kein starker Wind weht, denn der kann hier richtig weh tun!
Sehenswertes:
Am Fischereihafen von Fedderwardersiel befindet sich in einem denkmalgeschützen Gebäude aus dem Jahre 1846 das Nationalpark-Haus. Seit 2011 ist diese Einrichtung auch als offizielles Museum anerkannt. Schwerpunkte der interessanten und lehrreichen Ausstellung ist der Nationalpark und das UNESCO-Weltkulturerbe Wattenmeer mit seiner einzigartigen Flora und Fauna, die hiesige Fischerei, der Deichbau sowie die Siedlungsgeschichte Butjadingens. In einem Gezeitenmodell wird das Zusammenspiel von Sonne und Mond mit den Vorgängen in der Natur anschaulich verdeutlicht.
Die Küstenregion Butjadingens ist geprägt vom Wattenmeer und vom ewigen Rhythmus von Ebbe und Flut. Der Nationalpark Wattenmeer ist Refugium einer einzigartigen Flora und Fauna und inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe. In Burhave führt ein 200 m langer Holzsteg hinaus ins Watt und vermittelt dabei einmalige Ein- und Ausblicke in und über diese Naturlandschaft.
Gleich neben dem Wattensteg beginnt die Kunst Promenade. Der Bremer Professor Bernd Altenstein hatte 2007 zu einem Bildhauersymposium geladen. Sieben Künstler schufen dabei Skulpturen aus verschiedenen Materialien, die daraufhin zwischen Burhave und Fedderwardersiel an der Strandpromenade aufgestellt wurden.
In der platten Wesermarsch ist die Kirche von Langwarden kilometerweit zu sehen. Einst diente sie auch als Landmarke für die Seefahrt und als Vermessungspunkt. Der romanische Tuffsteinbau wurde im 12. Jahrhundert auf einer aufgeschütteten Wurt errichtet. Sehenswert ist die hervorragend erhaltene Orgel, deren Prospekt noch von 1650 stammt und wahrscheinlich von Hermann Kröger und seinem Gesellen Berendt Huss erbaut wurde.
Radrouten die durch Budjadingen führen:
Cuxhaven
on zwei Seiten von Wasser umgeben, liegt Cuxhaven auf einer vorgelagerten Halbinsel an der nördlichsten Spitze Niedersachsens. Hier mündet die Elbe in die Nordsee. Die Kugelbake markiert den Übergang zur offenen See. Das hölzerne Seezeichen ist das Wahrzeichen Cuxhavens und ziert auch das Wappen. Für viele Amerika-Auswanderer war sie das letzte, was sie von der alten Heimat gesehen haben. Historisch betrachtet gehört Cuxhaven zu Hamburg. Das Schloss Ritzebüttel war noch im letzten Jahrhundert Hamburger Amtssitz. Ansonsten haben sich zwei Wirtschaftsschwerpunkte entwickelt: die Schifffahrt und der Tourismus. Elf Kurteile reihen sich am 12 km langen Gras- und Sandstrand aneinander. Die bekanntesten Urlaubsorte sind Duhnen, Sahlenburg und Döse. Und überall grüßt die freundliche Zeichenfigur ‚Jan Cux‘, das Maskottchen dieser Urlaubsregion. Hier findet sich eines der größten Wattgebiete Deutschlands, inzwischen von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt. Eine Wanderung auf den abgesteckten Wattwegen ist ein faszinierendes und unvergessliches Erlebnis. Von Duhnen und Sahlenburg kann man bei Niedrigwasser sogar bis zur Insel Neuwerk laufen. Oder man fährt mit einem Wattwagen hinüber auf die Insel – eine Attraktion, die man als Cuxhaven-Urlauber erlebt haben muss! Aber auch eine Wanderung durch die ausgedehnte Küstenheide oder die Marschlandschaft hat ihren besonderen Reiz. Einzigartig ist die 20 km lange Maritime Meile, die vom Kurort Sahlenburg immer der Küste entlang bis zur beliebten Aussichtsplattform ‚Alte Liebe‘ führt. Hier kann man auf einem der weltweit meistbefahrensten Schifffahrtswege den Ozeanriesen auf ihrem Weg von oder nach Hamburg zusehen. Gleich neben der Alten Liebe steht mit dem Hamburger Leuchtturm ein weiteres Wahrzeichen der Stadt und hier beginnt auch der Hafen, das Herz der maritimen Weltstadt. Einen Bummel durch den alten Fischereihafen sollte man sich nicht entgehen lassen. Hier finden am Morgen Fischauktionen mit großem Getöse statt, schließlich gehört Cuxhaven noch immer zu den größten Fischumschlagplätzen Europas. Sehenswert ist der Amerika-Hafen mit den Hapag-Hallen, über den im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert ein großer Teil des deutschen Auswandererstroms nach Amerika abgewickelt wurde. Eine besondere Attraktion ist eine Hafenrundfahrt mit der Barkasse und mit dem Wrack- und Fischereimuseum ‚Windstärke 10‘ besitzt Cuxhaven ein modernes und herausragendes maritimes Museum.
Sehenswertes:
 Die Kugelbake ist das Wahrzeichen von Cuxhaven. Groß prangt sie auch auf dem gelben Wappen der Stadt. Sie markierte den Übergang der Elbe zur Nordsee und das Ende des Elbe- und des Weserradweges! Früher war das 29 m hohe Holzgestell ein Orientierungspunkt für die Schifffahrt und nachts brannte in ihr sogar ein Feuer. Für viele Auswanderer war sie das letzte, was sie in ihrem Leben von Europa sahen. Heute ist die Kugelbake ein beliebtes Ausflugsziel am nördlichsten Punkt von Niedersachsen.
Die Kugelbake ist das Wahrzeichen von Cuxhaven. Groß prangt sie auch auf dem gelben Wappen der Stadt. Sie markierte den Übergang der Elbe zur Nordsee und das Ende des Elbe- und des Weserradweges! Früher war das 29 m hohe Holzgestell ein Orientierungspunkt für die Schifffahrt und nachts brannte in ihr sogar ein Feuer. Für viele Auswanderer war sie das letzte, was sie in ihrem Leben von Europa sahen. Heute ist die Kugelbake ein beliebtes Ausflugsziel am nördlichsten Punkt von Niedersachsen.
 Wer die dicken Ozeandampfer beobachten will, der muss in Cuxhaven zur ‚Alten Liebe‘ gehen. Der Schiffsanleger ist zugleich eine beliebte Aussichtsplattform und trennt den Hafen der Stadt von der Elbe. Alle Schiffe, die von der Nordsee kommen und nach Hamburg fahren, müssen an der ‚Alten Liebe‘ vorbei. Über eine Lautsprecheranlage werden sie hier mit Herkunftsland und Größe angekündigt.
Wer die dicken Ozeandampfer beobachten will, der muss in Cuxhaven zur ‚Alten Liebe‘ gehen. Der Schiffsanleger ist zugleich eine beliebte Aussichtsplattform und trennt den Hafen der Stadt von der Elbe. Alle Schiffe, die von der Nordsee kommen und nach Hamburg fahren, müssen an der ‚Alten Liebe‘ vorbei. Über eine Lautsprecheranlage werden sie hier mit Herkunftsland und Größe angekündigt.
Erbaut wurde der Anleger bereits 1733. Dafür wurden an dieser Stelle drei Schiffe versenkt und fixiert. Darüber errichtete man ein zweistöckiges Holzbauwerk: unten zum Ein- und Aussteigen auf die Fahrgastschiffe, oben als Promenade. Im Jahr 2005 wurde das Fundament allerdings durch eine Stahlbetonkonstruktion ersetzt.
Eines der versenkten Schiffe hieß ‚Olivia‘, im Volksmund ‚Oliv‘ abgekürzt. Das klang dem niederdeutschen Begriff ‚Ole Liev‘ sehr ähnlich, der auf hochdeutsch übersetzt ‚Alte Liebe‘ bedeutet. So kam der Schiffssteg, von dem noch heute die Schiffe nach Helgoland, Neuwerk und zur Seehundbank ablegen, zu seinem ungewöhnlichen Namen.
Die spätmittelalterliche Burganlage wurde um 1340 durch die Herren von Sachsen-Lauenburg errichtet. Es handelte sich zunächst um eine von Wassergräben und Erdwällen gesicherte Turmburg. Bereits 1394 nahm Hamburg nach einer längeren Belagerung die Burg ein. Bis in das 20. Jahrhundert diente Schloss Ritzebüttel als Residenz für die von Hamburg eingesetzten Amtmänner. In dieser langen Zeit wurde die Anlage mehrfach um- und ausgebaut. Im 17. und 18. Jahrhundert verlor der Backsteinbau seinen wehrhaften Charakter und wurde zum Schloss umgestaltet. Nach einer umfangreichen Sanierung beherbergt Schloss Ritzebüttel heute ein Restaurant und ein Trauzimmer und wird häufig für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Ansonsten kann das historische Schlossgebäude besichtigt werden. Der Rundgang führt durch die Festsäle, den Wohnbereich der Amtmänner und in das noch erhaltene Backsteingewölbe des Burgturmes.
Das schmucke Schweizerhaus im Schlosspark ist ein Blickfang für alle Besucher. Es wurde 1847 als Teehaus erbaut.
 Gleich neben der beliebten Aussichtsplattform ‚Alte Liebe‘ steht der Hamburger Leuchtturm. Das 23 m hohe Rundgebäude wurde 1804 fertig gestellt und versah den Dienst als Leuchtfeuer noch bis 2001. Der Leuchtturm gilt als eines der Wahrzeichen Cuxhavens und steht bereits seit 1924 unter Denkmalschutz. Der vierstöckige Backsteinturm befindet sich inzwischen in privatem Besitz, da die Stadt Cuxhaven eine weitere Instandhaltung nicht finanzieren konnte.
Gleich neben der beliebten Aussichtsplattform ‚Alte Liebe‘ steht der Hamburger Leuchtturm. Das 23 m hohe Rundgebäude wurde 1804 fertig gestellt und versah den Dienst als Leuchtfeuer noch bis 2001. Der Leuchtturm gilt als eines der Wahrzeichen Cuxhavens und steht bereits seit 1924 unter Denkmalschutz. Der vierstöckige Backsteinturm befindet sich inzwischen in privatem Besitz, da die Stadt Cuxhaven eine weitere Instandhaltung nicht finanzieren konnte.
 Am äußersten nördlichen Eck von Niedersachsen, strategisch wichtig an der Elbmündung gelegen, befindet sich das Fort Kugelbake. Es wurde 1869 – 79 als preußische Befestigungsanlage gebaut, um den Schifffahrtsweg Elbe zu sichern. Das Großfort selber war mit einem Wall und doppeltem Graben geschützt und besaß Kanonen- und Flakgeschütze schweren Kalibers.
Am äußersten nördlichen Eck von Niedersachsen, strategisch wichtig an der Elbmündung gelegen, befindet sich das Fort Kugelbake. Es wurde 1869 – 79 als preußische Befestigungsanlage gebaut, um den Schifffahrtsweg Elbe zu sichern. Das Großfort selber war mit einem Wall und doppeltem Graben geschützt und besaß Kanonen- und Flakgeschütze schweren Kalibers.
Heute hat das Fort seine militärische Funktion verloren und kann im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Regelmäßig finden in der Bastion auch Open-Air-Veranstaltungen statt.
Piła, das ehemalige Schneidemühl, ist eine polnische Stadt in Hinterpommern, etwa 80 km nördlich von Posen (Poznań). Sie war Hauptstadt der Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen, bevor sie nach dem Zweiten Weltkrieg schwer zerstört an Polen fiel. Auch heute besitzt die Stadt überregionale Bedeutung. Hier befinden sich zahlreiche Industrieanlagen und Banken sowie ein großes Eisenbahnwerk.
Cuxhaven ist seit 1957 Patenstadt für Schneidemühl/Piła. In der Volkshochschule wurde ein kleines Museum eingerichtet, das über den heute polnischen Ort erzählt. Zu sehen gibt es viele Erinnerungsstücke und Fotos sowie Gemälde, die überwiegend erst nach 1945 entstanden.
Die Seestadt Cuxhaven, an der Mündung der Elbe und an der verlängerten Außenweser gelegen, wurde über Jahrhunderte von der Seefahrt geprägt. So liegt es nahe, dass sich das Stadtmuseum in erster Linie der umfangreichen Geschichte der Schiff- und Seefahrt widmet. Das Museum erzählt von der Fischerei, den Cuxhavener Werften, der Marine seit der Kaiserzeit bis heute, der Passagier- und Handelsschifffahrt und dem Lotsenwesen.
Mit dem Museum ‚Windstärke 10‘ wurde Ende 2013 eine große Ausstellung eröffnet, die aus den ehemaligen Sammlungen des Wrackmuseums und des Fischereimuseums besteht. Zwei alte Fischpackhallen wurden zu einem modernen Museumsgebäude mit einer Ausstellungsfläche von rund 4.000 m² umgerüstet. Die Hälfte dieser Fläche wird für die ständige Ausstellung genutzt, die von den verschiedenen Gefahren auf der hohen See, von Schiffbrüchen sowie von der harten und entbehrungsreichen Arbeit an Bord eines Hochseefischtrowlers erzählt.
Die restliche Fläche ist wechselnden Sonderausstellungen vorbehalten. Die Kombination aller Ausstellungsbereiche machen das maritime Museum zu einer spannenden und sehenswerten Einrichtung.
Joachim Ringelnatz (1883 – 1934) machte sich als Schriftsteller, Kabarettist und Maler im frühen 20. Jahrhundert einen Namen. Insbesondere seine humoristischen Gedichte und die von ihm geschaffene Kunstfigur ‚Kuttel Daddeldu‘ machten ihn einem breitem Publikum bekannt.
Obwohl er eher als Literat bekannt wurde, betätigte er sich auch recht erfolgreich als Maler, Zeichner und Fotograf. Diesem Teil seines kreativen Schaffens widmet sich das Ringelnatzmuseum in Cuxhaven. Es ist das einzige Museum in Deutschland, das sich ausschließlich dem Dichter widmet. Ringelnatz war während des Ersten Weltkrieges bei der Kaiserlichen Marine in Cuxhaven stationiert. Die Ausstellung stellt Ringelnatz‘ Leben in den Kontext der deutschen Geschichte im frühen 20. Jahrhundert und während des aufkommenden Nationalsozialismus. Es präsentiert auch einige originale Handschriften sowie Erstausgaben, die der Bücherverbrennung 1933 entgangen sind.
Die evangelisch-lutherische Kirche in Altenbruch wurde als Wehrkirche im romanischen Stil auf einer aufgeschütteten Wurth erbaut. Sie gehört zu den drei Bauerndomen im Hadelner Land. Ein genaues Entstehungsjahr ist nicht bekannt. Die älteste urkundliche Erwähnung findet sich 1280. Vermutungen zufolge ist die Feldsteinkirche aber bereits um einiges älter. Auffällig ist der massive Turm mit der Doppelspitze, die von der Schifffahrt als markantes Seezeichen genutzt wurde. Der Volksmund taufte die beiden Türme ‚Anna‘ und ‚Beate‘. Ein dritter hölzerner Turm steht etwas südlich des Doppelturmes. In diesem 1647 erbauten Turm befindet sich weiteres Geläut der Kirche. Der im Verhältnis sehr groß wirkende Chor wurde 1728 im barocken Stil erbaut und ersetzte einen zuvor baufällig gewordenen Anbau.
Die Inneneinrichtung birgt mehrere wertvolle Kunstschätze. Sehenswert sind der Flügelaltar aus dem 15. Jahrhundert, der Taufkessel aus dem 14. Jahrhundert, der Herlitz-Epitaph von 1697 und die mit geschnitzten Reliefs bestückte Kanzel aus dem frühen 18. Jahrhundert. Die später mehrfach erweiterte Orgel stammt ursprünglich bereits aus dem Jahr 1498. Weitere Besonderheiten im Inneren der St.-Nicolai-Kirche sind die Gefängniszelle und die hölzerne Beichtkammer. Beichten waren in dieser Gegend selbst in evangelischen Kirchen noch bis in das 19. Jahrhundert üblich.
Die evangelische St. Abunduskirche in Groden war vor dem Bau der Martinskirche lange Zeit die Hauptkirche Cuxhavens. Sie wurde aus Feldsteinen um 1200 errichtet. 1524 wurde sie im Zuge der Reformation protestantisch. Bemerkenswert ist die 1688 errichtete Kanzel mit fünf geschnitzten Holzfiguren.
Die Dorfkirche in Lüdingworth gehört zu den sogenannten Bauerndomen im Hadelner Land. Sie ist die am prächtigsten ausgestattete dieser drei Gotteshäuser. Die romanische Feldsteinkirche wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Bei einem größeren Umbau 1520 entstanden der Hallenchor und der erneuerte Backsteinturm.
Die Innenausstattung stammt überwiegend aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Besonders sehenswert sind der Barockaltar mit seinen filigranen Reliefdarstellungen, der dreiteilige Lüderskoper Altar, der bereits um 1440 entstand und ebenfalls mit mehreren prächtigen Holzreliefs ausgeschmückt ist, sowie die Orgel. Das Instrument wurde bereits 1599 erbaut, seitdem allerdings mehrfach ergänzt. So fügte im Jahre 1683 auch der berühmte Orgelbaumeister Arp Schnitger ein Rückpositiv ein, das noch heute erhalten ist.
 Neben Bremerhaven wurde Ende des 19. Jahrhunderts auch Cuxhaven zum wichtigen Auswandererhaven. Ab 1889 ließ die Hamburg-Amerika Linie der HAPAG ihre Schnelldampfer am Amerikahafen abfertigen. 1902 entstanden die Hapag-Hallen, in denen sich die Wartesäle für die verschiedenen Fahrklassen befanden. Das Kuppelgebäude wurde direkt an die Bahngleise gebaut. Zu Hochzeiten fuhr hier alle 15 Minuten ein Zug ein. 1913 wurde dann direkt an der Anlegestelle der Steubenhöft errichtet.
Neben Bremerhaven wurde Ende des 19. Jahrhunderts auch Cuxhaven zum wichtigen Auswandererhaven. Ab 1889 ließ die Hamburg-Amerika Linie der HAPAG ihre Schnelldampfer am Amerikahafen abfertigen. 1902 entstanden die Hapag-Hallen, in denen sich die Wartesäle für die verschiedenen Fahrklassen befanden. Das Kuppelgebäude wurde direkt an die Bahngleise gebaut. Zu Hochzeiten fuhr hier alle 15 Minuten ein Zug ein. 1913 wurde dann direkt an der Anlegestelle der Steubenhöft errichtet.
Die historischen Gebäude werden auch heute noch zur Abfertigung von Kreuzfahrtpassagieren genutzt, aber auf dem Bahnhof fahren nur noch selten Personensonderzüge ein. Die Gleise dienen heute vornehmlich dem Güterverkehr. In den Hapag-Hallen erinnert die Dauerausstellung ‚Abschied nach Amerika‘ mit alten Fotos an die Zeit, in der Tausende von Auswanderern am ‚Bahnhof der Tränen‘ die Heimat verließen, um im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ihr großes Glück zu finden.
 Am Hafen von Altenbruch steht der Leuchtturm ‚Dicke Berta‘. Er wurde 1897 erbaut und diente lange Zeit als Unterfeuer. Das dazugehörige Unterfeuer, die ‚Schlanke Anna‘, stand in Osterende Groden und wurde inzwischen abgebaut. Auch die Dicke Berta, die bis 1983 als Quermarkenfeuer eingesetzt wurde, sollte in den 1980er Jahren abgerissen werden. Doch erheblicher Widerstand aus der Bevölkerung verhinderte die Verschrottung. Heute steht das alte Leuchtfeuer unter Denkmalschutz. Lange thronte der 13 m hohe Leuchtturm auf dem Kamm des Elbdeiches. Seit aber der Deich 1999 etwas erhöht wurde, steht die Dicke Berta etwas landeinwärts versetzt knapp hinter der Deichkrone. Zwischen Ostern und September steht sie zur Besichtigung offen.
Am Hafen von Altenbruch steht der Leuchtturm ‚Dicke Berta‘. Er wurde 1897 erbaut und diente lange Zeit als Unterfeuer. Das dazugehörige Unterfeuer, die ‚Schlanke Anna‘, stand in Osterende Groden und wurde inzwischen abgebaut. Auch die Dicke Berta, die bis 1983 als Quermarkenfeuer eingesetzt wurde, sollte in den 1980er Jahren abgerissen werden. Doch erheblicher Widerstand aus der Bevölkerung verhinderte die Verschrottung. Heute steht das alte Leuchtfeuer unter Denkmalschutz. Lange thronte der 13 m hohe Leuchtturm auf dem Kamm des Elbdeiches. Seit aber der Deich 1999 etwas erhöht wurde, steht die Dicke Berta etwas landeinwärts versetzt knapp hinter der Deichkrone. Zwischen Ostern und September steht sie zur Besichtigung offen.
Nordwestlich von Cuxhaven liegt die Inselgruppe Neuwerk. Neben der Hauptinsel gehören auch die dahinter liegenden Inseln Scharnhörn und Nigehörn, die allerdings als Vogelschutzgebiete ausgewiesen sind. Trotz der Nähe zu Cuxhaven gehören die Inseln politisch zu Hamburg, und das mit kurzen Unterbrechungen bereits seit 700 Jahren – obwohl das eigentliche Stadtgebiet 100 km entfernt liegt. In den Jahren 1367 – 69 bauten die Hansestädter hier eine Festung als Vorposten gegen See- und Strandräuber. Der klobig wirkende Leuchtturm wurde bereits 1310 erbaut und gilt damit als ältestes Gebäude Hamburgs. Lange Jahrhunderte diente der Backsteinbau schon als Seezeichen. Das 1814 aufgesetzte Leuchtfeuer ist noch immer funktionstüchtig.
Die Insel Neuwerk wird von ungefähr 40 Personen bewohnt, die heute fast ausschließlich vom Tourismus leben. Die Insel wird bei Flut regelmäßig mit einem Passagierschiff bedient. Bei Niedrigwasser kann Neuwerk von Dunen und Sahlenburg aus zu Fuß erreicht werden. Die meisten Besucher kommen aber mit dem Wattwagen. Die Fahrt mit den Pferdekutschen ist eine besondere Attraktion. Im Nationalpark-Haus kann man eine Ausstellung über den Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer besuchen und eine weitere Besonderheit bietet das Heuhotel: eine Übernachtung im Stroh! Hinter der Szenerie: Der Friedhof der Namenlosen Das Leben auf der Insel Neuwerk war hart und entbehrungsreich. Den ständigen Gezeiten ausgesetzt und von heftigen Sturmfluten geplagt, hatten es die Menschen hier nicht einfach. Und dann gab es immer wieder grausige Funde, wenn das Meer mit der Flut wieder einmal eine ertrunkene Seele freigab und hier an Land spülte. Verwest und vom Meerwasser aufgedunsen, war es im Allgemeinen nicht mehr nachvollziehbar, um welchen Matrosen es sich gehandelt hat, bei welchem Schiffsuntergang er sein Leben verlor oder warum er über Bord gegangen war. Aber in der christlichen Seefahrt hat jeder Seemann Anspruch auf ein christliches Begräbnis. So entstanden im 18. und 19. Jahrhundert die Friedhöfe der Namenlosen, manchenorts auch Heimatlosenfriedhof genannt. Hier wurden diese unglücklichen Seeleute beigesetzt. Solch eine Begräbnisstätte gab es auch auf der Insel Neuwerk. Es werden immer noch ab und zu Leichen angespült, doch werden sie heute zum Festland überführt und dort begraben. Doch die namenlosen Gräber auf dem Inselfriedhof könnten aufregende und dramatische Geschichten erzählen, wenn sie nur reden könnten…
 Die meist leuchtend rot bemalten Feuerschiffe haben die Aufgabe von schwimmenden Leuchttürmen. Auf bestimmten festgelegten Positionen dienen sie so als Navigationshilfe für die Schifffahrt. An der Bordwand prangt gut lesbar der Positionsname, wie beispielsweise ‚Elbe 1‘. Das letzte bemannte Feuerschiff auf dieser Position war die ‚Bürgermeister O’Swald II‘. Sie wurde auf der Meyerwerft in Papenburg gebaut und lief 1943 vom Stapel. Zwischen 1948 und 1988 versah sie ihren Dienst vor der deutschen Küste. 1970 wurde das Schiff sogar einmal durch den argentinischen Frachter ‚Rio Carcarano‘ gerammt, konnte aber bald danach wieder flott gemacht werden. Später wurde die ‚Bürgermeister O’Swald II‘ durch ein unbemanntes Fauerschiff ersetzt, seit 2000 kennzeichnet eine Leuchttonne die Position. Das Feuerschiff liegt seit der Außerdienststellung an der Alten Liebe und ist seit 1990 als Museumsschiff zu besichtigen. Das die ‚Bürgermeister O’Swald II‘ aber noch seetüchtig ist, liegt sie nicht immer an ihrem angestammten Hafenplatz. Häufig befindet sie sich auf Fahrt zu verschiedenen Festen an der Nordseeküste. Wenn man das Feuerschiff besichtigen möchte, sollte man daher vorher beim ‚Feuerschiff-Verein ELBE 1 von 2001 e.V.‘ nachfragen, ob ein Besuch möglich ist.
Die meist leuchtend rot bemalten Feuerschiffe haben die Aufgabe von schwimmenden Leuchttürmen. Auf bestimmten festgelegten Positionen dienen sie so als Navigationshilfe für die Schifffahrt. An der Bordwand prangt gut lesbar der Positionsname, wie beispielsweise ‚Elbe 1‘. Das letzte bemannte Feuerschiff auf dieser Position war die ‚Bürgermeister O’Swald II‘. Sie wurde auf der Meyerwerft in Papenburg gebaut und lief 1943 vom Stapel. Zwischen 1948 und 1988 versah sie ihren Dienst vor der deutschen Küste. 1970 wurde das Schiff sogar einmal durch den argentinischen Frachter ‚Rio Carcarano‘ gerammt, konnte aber bald danach wieder flott gemacht werden. Später wurde die ‚Bürgermeister O’Swald II‘ durch ein unbemanntes Fauerschiff ersetzt, seit 2000 kennzeichnet eine Leuchttonne die Position. Das Feuerschiff liegt seit der Außerdienststellung an der Alten Liebe und ist seit 1990 als Museumsschiff zu besichtigen. Das die ‚Bürgermeister O’Swald II‘ aber noch seetüchtig ist, liegt sie nicht immer an ihrem angestammten Hafenplatz. Häufig befindet sie sich auf Fahrt zu verschiedenen Festen an der Nordseeküste. Wenn man das Feuerschiff besichtigen möchte, sollte man daher vorher beim ‚Feuerschiff-Verein ELBE 1 von 2001 e.V.‘ nachfragen, ob ein Besuch möglich ist.
Radrouten die durch Cuxhaven führen:
Weser-Radweg
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer
Nordseeküstenradweg
Nordenham
ie ehemals ländlich geprägte Gemeinde ist heute die größte und bedeutendste Stadt in der Wesermarsch. Sie liegt am linken Ufer der Weser direkt an deren Mündung in die Nordsee. Erste Siedlungen gab es hier wohl bereits vor 2.700 Jahren. Diese wurden aber wegen der ständigen Bedrohung durch Sturmfluten wieder aufgegeben. Seit dem 1. Jhd. v. Chr. sind Siedlungen auf aufgeschütteten Wurten nachweisbar. Nordenham ist als Stadt noch relativ jung. Erst 1908 wurden die Stadtrechte verliehen. Mit der Moorseer Mühle, dem Museum Nordenham und dem historischen Kaufhaus in Abbehausen besitzt Nordenham drei sehenswerte Museen.
Sehenswertes:
Die heimatkundliche Ausstellung des Museums beschreibt die Menschheitsgeschichte in der nördlichen Wesermarsch sowie die Stadt- und Industriegeschichte Nordenhams. Sie basiert auf die Sammlung des Rüstringer Heimatbundes, hebt aber auch die Verbundenheit der Region mit der Schifffahrt hervor.
Das Museum Nordenham bewahrt zwei Versionen des ‚Bruderkussbildes‘. Die vom Künstler Hugo Ziegler geschaffenen Gemälde zeigen eine Enthauptungsszene, die auf besondere Weise den Stolz der Friesen darstellt.
Die Windmühle vom Typ Galerie-Holländer wurde 1840 erbaut und ist auch heute noch voll funktionsfähig. Sie besitzt einen hölzernen Oberbau und zwei Windrosen. Zu dem Mühlengebäudenensemble gehört das ehemalige Wohnhaus des Müllers, die Stallungen und mehrere landwirtschaftliche Nebengebäude. Der Komplex ist als Museum eingerichtet, in dem man die gesamte historische Mühlentechnik besichtigen kann und wissenswertes über die regionale Mühlengeschichte erfährt. Im Sommer ist am Dienstag und Mittwoch Backtag. Hier darf ein jeder in der alten Schaubäckerei eigenes Brot herstellen.
Neben der großen Holländermühle steht noch eine seltene Pluttermühle. Solche Mühlen waren klein und leicht. Sie wurden von Hand in den Wind gedreht und dienten meist der Be- und Entwässerung von Gräben und Feldern.
Im Jahre 1853 eröffnete Johann Hermann Büsig in Abbehausen einen Gemischtwarenladen – und dieses kleine Kaufhaus gibt es heute immer noch! Während das Obergeschoss als Museum eingerichtet ist, kann man im unteren Bereich immer noch Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens – von Süßwaren bis hin zu Fahrradersatzteilen – käuflich erwerben.
Aber interessanter ist das obere Stockwerk, in der noch eine alte Ladenzeile erhalten ist und wo es mehr als 4.000 Originalwaren aus der 150jährigen Geschichte des Geschäftes zu bestaunen gibt. Im Archiv werden sämtliche Geschäftspapiere und alte Herstellerkataloge bewahrt und in der Bibliothek stehen neben kaufmännischer Fachliteratur viele interessante heimatgeschichtliche Bücher.
In der Wesermarsch stehen neben dem in Grebswarden noch drei sogenannte Jedutenhügel: in Volkers und Schmalenfleth. Diese künstlich aufgeworfenen Hügel besitzen eine Höhe von bis zu 6 Metern und einen Durchmesser von 30 Metern. Sonst ist über diese Bodenerhebungen kaum etwas bekannt. Auch das Alter ist noch nicht erforscht, man schätzt die Entstehung auf die Wikingerzeit. Über den Grund dieser Erdaufschüttung kann bislang nur gerätselt werden. Vielleicht diente er als Wachhügel, Gerichtsstätte, Begräbnisort, Seezeichen, Alarmplatz oder Landmarke – man weiß es nicht!
Die evangelisch-lutherische Kirche in Blexen gehört zu den wenigen Gotteshäusern, die den Kirchenvater und Märtyrer Hyppolyt von Rom als Namenspatron verehren. Die Kirche, im Kern ein Saalbau im romanischen Stil, entstand im 11. Jahrhundert, wurde aber bis zum 14. Jahrhundert mehrfach aus- und umgebaut. Wesentliche Veränderungen stammen auch noch aus dem späten 19. Jahrhundert. So wirkt das Kirchengebäude, das zum Teil aus Backstein und zum Teil aus Sandstein besteht, recht uneinheitlich.
Die Inneneinrichtung entstammt noch aus dem frühen Barock. Bemerkenswert sind die Kanzel, der Orgelprospekt von 1685, die Emporen- und Deckenbemalung sowie der reich verzierte Altaraufsatz. Dieser wurde vom berühmten Holzschnitzer Ludwig Münstermann geschaffen, der in vielen Kirchen der Wesermarsch seine beeindruckenden Spuren hinterlassen hat.
Radrouten die durch Nordenham führen:
Stadland
wischen Weser und Jadebusen liegt in der norddeutschen Wesermarsch die Gemeinde Stadland. Es wird vermutet, dass der Begriff ‚Stadland‘ auf die Stedinger zurückgeht, die nach der verheerenden Niederlage in der Schlacht von Altenesch im Jahre 1234 hierher in das sumpfige und schwer zugängliche Marschland geflohen waren. Unumstritten ist diese These jedoch nicht. Ein dichtes Netz von Kanälen und Gräben durchzieht heute diesen Landstrich. Pump- und Schöpfwerke regulieren den Wasserstand. Sitz der Gemeindeverwaltung ist Rodenkirchen, die größte der ehemals vier selbstständigen Gemeinden, zu denen auch Schwei, Seefeld und Kleinsiel gehören. Stadland besitzt ein ausgedehntes Radwandernetz, auf dem man die weite und beschauliche grüne Moor- und Marschlandschaft am besten erfahren und entdecken kann.
Sehenswertes:
Die evangelische St.-Matthäus-Kirche wurde bereits im späten 12. Jahrhundert auf einer aufgeschütteten Wurt erbaut, noch bevor der Ort Rodenkirchen erstmals urkundlich erwähnt wurde. Der ursprüngliche Kirchenbau war eine einfache Saalkirche aus Sandstein. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde das Querschiff angefügt, im 15. Jahrhundert erfolgte der Ausbau zu der heutigen äußeren Form. Der bekannte Holzschnitzer Ludwig Münstermann schuf 1629 den figurenreichen Altar, der allerdings in den folgenden Jahrhunderten noch mehrfach überarbeitet wurde.
In der Mitte des Dorfes Schwei steht die 1615 bis 1617 erbaute St.-Secundus-Kirche, die weit über Grenzen hinaus bekannt ist für ihre wertvollen Kunstschätze. Der berühmte Holzschnitzer Ludwig Münstermann schuf gleich drei beeindruckende Werke für das Gotteshaus: die Kanzel, den Altar, von dem allerdings nur noch Reste erhalten sind und der Taufsteindeckel von 1618. Beeindruckend sind auch die 25 Gemälde an der Empore, die nach erfolgter Restaurierung wieder in voller Farbigkeit erstrahlen sowie der landesherrliche Kirchenstuhl mit dem Wappen des Grafen Anton Günther von Oldenburg.
Die Siedlung Seefeld entstand Mitte des 17. Jahrhunderts, als man durch das Eindeichen größere Flächen Land gewinnen konnte, welche vorher nicht urbar waren. 1675 errichtete man am Rande des Deiches die Dorfkirche im Stil des norddeutschen Barock. Von der alten Inneneinrichtung haben sich noch die Kanzel (1702), der Altaraufsatz (1691) sowie der Taufstein (1695) erhalten.
Das Wahrzeichen Seefelds ist die Windmühle. Sie wurde im frühen 19. Jahrhundert als Galerieholländer erbaut. Nach der Stilllegung verfiel das Gebäude zusehends, wurde aber in den 1980er Jahren aufwendig saniert und beherbergt heute ein Mühlencafé. Darüber hinaus dient sie häufig als Kultur- und Veranstaltungsort und bietet für Paare die Möglichkeit einer standesamtlichen Trauung.
Im Jahr 2004 wurde nach sechsjähriger Bauzeit der Wesertunnel zwischen Kleinensiel (Kreis Wesermarsch) und Dedesdorf (Kreis Cuxhaven) eröffnet. Er ist 1,6 km lang und liegt an seiner tiefsten Stelle 40 m unter NN. Da es nördlich von Bremen keine Brücke mehr über die Weser gibt, ist der Tunnel die einzige Möglichkeit, um die Weser zu queren, ohne eine Fähre zu benutzen. Der Wesertunnel besitzt zwei Röhren mit jeweils zwei Fahrspuren und ist Teil der geplanten Küstenautobahn A20. Täglich passieren rund 20.000 Fahrzeuge die Unterführung. Für Radfahrer und Fußgänger ist die Nutzung des Tunnels zwar verboten, aber es gibt einen Bus, mit dem auch Fahrräder auf die andere Seite der Weser transportiert werden können.
Das im Abser Sielhafen in Rodenkirchen beheimatete Segelschiff ‚Hanni‘ ist der originale Nachbau eines historischen Dielenschiffes. Diese Schiffsgattung, auch Butterschiff genannt, war früher in der Weserregion sehr verbreitet. Durch ihren geringen Tiefgang waren sie in der Lage, auch kleinere Kanäle zu befahren. So konnten auch abgelegene Bauernhöfe mit Gütern und Lebensmitteln beliefert werden.
Das historische Dielenschiff ‚Hanni‘ ist das einzige ihrer Art in Deutschland und daher eine besondere Attraktion. In den Sommermonaten zwischen Mai und September werden auf dem Segelschiff Törns rund um die Strohauser Plate, nach Bremerhaven, zu den Sielen und zu den Braker Pieranlagen angeboten.
Auf der Höhe von Rodenkirchen liegt auf der linken Weserseite die Insel Strohauser Plate. Sie ist 6 km lang und misst an ihrer breitesten Stelle 1,3 km. Die im 16. und 17. Jahrhundert entstandene Insel steht inzwischen vollständig unter Naturschutz, wird aber noch immer landwirtschaftlich genutzt. Die beiden verbliebenen Höfe stehen erhöht auf Wurten, um gegen Hochwasser bei Sturmfluten geschützt zu sein. Ansonsten ist die Strohauser Plate ein Vogelschutzgebiet und darf von Besuchern nur während einer geführten Exkursion betreten werden.
Im Jahr 1971 entdeckten Forscher in Hohnenknoop die älteste Moorsiedlung an der deutschen Nordseeküste. Nach Abschluss der archäologischen Untersuchung wurde 2005 ein rekonstruierter Nachbau des Haupthauses erstellt, der inzwischen zu einem beliebten Ausflugsziel geworden ist. Hier kann man nachvollziehen, wie die Menschen vor rund 3.000 Jahren in der Marsch gelebt haben.
Radrouten die durch Stadland führen:
Bremerhaven
ie Seestadt Bremerhaven liegt direkt an der Wesermündung und nennt sich die ‚einzige deutsche Großstadt an der Nordsee‘. Obwohl die Geschichte Bremerhavens noch recht jung ist, hat sich hier ein Welthafen und eines der bedeutendsten deutschen Exportzentren entwickelt. Das Überseehafengebiet und der Fischereihafen gehören zu den größten in Europa. Das Container-Terminal ist das größte zusammenhängende Container-Terminal der Welt. Bei einer Tour mit dem HafenBus oder eine Weserrundfahrt bekommt man einen Einblick in diese einzigartige maritime Welt. Im Stadtteil Mitte entstanden als neues touristisches Zentrum die Havenwelten. Zu den Attraktionen gehören das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost, das Deutsche Schiffahrtsmuseum mit dem Museumshafen, das Historische Museum, das Deutsche Auswanderhaus, der Zoo am Meer, das Lloyd Mariana und das futuristisch anmutende ATLANTIC Hotel SAIL City. Das ‚Schaufenster Fischereihafen‘ im Süden der Stadt wartet mit einer Vielzahl von maritimen Geschäften und Restaurants, dem Museumsschiff FMS Gera und dem beeindruckenden Meerwasseraquarium im ‚Atlanticum‘ auf.
Gegründet wurde Bremerhaven allerdings erst 1827. Durch die zunehmende Versandung der Weser war die Schifffahrt nach Bremen schwierig geworden. So kaufte der damalige Bürgermeister Johan Schmid vom damaligen Staat Hannover das Gelände, auf dem sich heute Bremerhaven-Mitte befindet, um dort einen neuen Bremer Hafen anzulegen. Dieser wurde 1830 fertig gestellt. 1851 erhielt Bremerhaven das Stadtrecht. Zeitgleich entwickelte sich Geestemünde als preußische Konkurrenz im Süden Bremerhavens. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich Bremerhaven zum größten Auswandererhafen entwickelt und in den 1920er Jahren entstand die rund 1000 m lange Columbuskaje, der ‚Bahnhof am Meer‘. Hier legten fortan die großen Linienschiffe in die USA, nach Südamerika und Australien ab. Und hier betrat der junge Elvis Presley als amerikanischer G.I. deutschen Boden, umjubelt von Tausenden von begeisterten, vornehmlich weiblichen Anhängern. Die Städte Geestemünde und Lehe, die zuvor als Stadt ‚Wesermünde‘ zusammengefasst wurden, wurden Mitte des 20. Jahrhunderts nach Bremerhaven eingemeindet.
Sehenswertes:
 Das Deutsche Schiffahrtsmuseum (wird als Eigenname mit nur zwei ‚f‘ geschrieben) ist eine vielbesuchte Attraktion in der Seestadt. Es wurde 1975 eröffnet und dient als Forschungsmuseum auch wissenschaftlichen Arbeiten. Die Ausstellung gibt einen umfangreichen Überblick über die Geschichte der Schifffahrt sowie die Seefahrt in der heutigen Zeit. Zahlreiche Modelle verschiedenster Schiffsgattungen, technische Geräte und Ausrüstungsgegenstände vervollständigen den sehenswerten Rundgang. Besondere Attraktionen des Museums sind eine im Bremer Hafen gefundene Hansekogge von 1380 sowie der Fahrstand des früheren Seebäderschiffes ‚Wappen von Hamburg‘.
Das Deutsche Schiffahrtsmuseum (wird als Eigenname mit nur zwei ‚f‘ geschrieben) ist eine vielbesuchte Attraktion in der Seestadt. Es wurde 1975 eröffnet und dient als Forschungsmuseum auch wissenschaftlichen Arbeiten. Die Ausstellung gibt einen umfangreichen Überblick über die Geschichte der Schifffahrt sowie die Seefahrt in der heutigen Zeit. Zahlreiche Modelle verschiedenster Schiffsgattungen, technische Geräte und Ausrüstungsgegenstände vervollständigen den sehenswerten Rundgang. Besondere Attraktionen des Museums sind eine im Bremer Hafen gefundene Hansekogge von 1380 sowie der Fahrstand des früheren Seebäderschiffes ‚Wappen von Hamburg‘.
 Zu dem Museum gehört auch der Museumshafen mit mehreren stolzen und betagten Wasserfahrzeugen. Hier liegen die ‚Seute Deern‘, auf der großen Dreimastbark von 1919 befindet sich heute ein Restaurant, der Bergungs- und Hochseeschlepper ‚Seefalke‘, der Binnenschlepper ‚Helmut‘, das Feuerschiff ‚Elbe 3‘, der Walfangdampfer ‚RAU IX‘, der Fracht- und Haffkahn ‚Emma‘ sowie das begehbare U-Boot vom Typ XXI ‚Wilhelm Bauer‘, das allerdings zum Technikmuseum gehört. An Land stehen neben dem Hafenbecken noch der Hafenschlepper ‚Stier‘, das Betonschiff ‚Paul Kossel‘, die Yacht ‚Diva‘ und das Tragflügelboot ‚WSS 10‘.
Zu dem Museum gehört auch der Museumshafen mit mehreren stolzen und betagten Wasserfahrzeugen. Hier liegen die ‚Seute Deern‘, auf der großen Dreimastbark von 1919 befindet sich heute ein Restaurant, der Bergungs- und Hochseeschlepper ‚Seefalke‘, der Binnenschlepper ‚Helmut‘, das Feuerschiff ‚Elbe 3‘, der Walfangdampfer ‚RAU IX‘, der Fracht- und Haffkahn ‚Emma‘ sowie das begehbare U-Boot vom Typ XXI ‚Wilhelm Bauer‘, das allerdings zum Technikmuseum gehört. An Land stehen neben dem Hafenbecken noch der Hafenschlepper ‚Stier‘, das Betonschiff ‚Paul Kossel‘, die Yacht ‚Diva‘ und das Tragflügelboot ‚WSS 10‘.
Der Museumshafen ist der letzte erhaltene Teilbereich des Alten Hafens. Dieser wurde 1827 – 30 zur Gründungszeit Bremerhavens als erster künstlicher Hafen der Stadt angelegt. Er besaß eine zu dieser Zeit stattliche Länge von 750 Metern und eine eigene Schleuse. Seit den 1890er Jahren wurde der Alte Hafen jedoch nur noch als Fischereihafen genutzt, ehe er 1935 zugunsten des Neuen Hafens ganz geschlossen wurde. Bereits 1926 war mit der Verfüllung begonnen worden, die zwischen 1960 und 1975 fortgesetzt wurde. Nur ein kleines Becken blieb für das Deutsche Schiffahrtsmuseum erhalten.
Als Anfang des letzten Jahrhunderts die Linienschifffahrt zunahm und die Passagierschiffe immer größer wurden, fehlte in Bremerhaven eine geeignete Anlegestelle für diese Ozeanriesen. So entstand an der Außenweser bis 1927 die rund 1000 m lange Columbuskaje, auch Columbusbahnhof genannt. Die Kaje wurde nach der ‚Columbus‘ benannt, dem damalige Flaggschiff des Norddeutschen Lloyds. Die Columbus steuerte Bremerhaven regelmäßig an und hatte bis dahin keinen geeigneten Liegeplatz.
An der Columbuskaje legten nun auch viele der Dampfschiffe an, die die immer noch zahlreichen Auswanderer in die USA und nach Australien brachten. Auf dem neu erbauten Bahnhof konnten die Passagiere direkt von der Bahn auf das Schiff umsteigen.
Nachdem die Anlage im Zweiten Weltkrieg weitgehend niedergebrannt war, wurde sie bis 1952 wieder neu aufgebaut. 1958 stieg Elvis Presley als amerikanischer G.I. an der Columbuskaje aus, umjubelt von Tausenden von Fans.
In der Zwischenzeit hat die Bedeutung der Linienschifffahrt über die Ozeane fast vollständig abgenommen. Der Einsatz von Flugzeugen machte die lange und beschwerliche Reise ungleich schneller und angenehmer. So legen heute an der langen und geschichtsträchtigen Columbuskaje fast nur noch Kreuzfahrtschiffe an und der Bahnhof wird nur noch von wenigen Sonderzügen bedient.

Auf dem Areal des Überseehafens befindet sich die historische Kaiserschleuse. Als Ende des 19. Jahrhunderts die Schiffe immer riesiger wurden, musste man diesen erhöhten Abmessungen auch bei den Hafenschleusen Rechnung tragen. So entstand zwischen 1892 und 1896 die Kaiserschleuse, die mit 223 m Länge, 45 m Kammerbreite und einer Tiefe von 7 m zum Zeitpunkt ihrer Einweihung die mit Abstand größte Schleuse der Welt war.
Gemeinsam mit der Nordschleuse sorgt sie dafür, dass die Dockhäfen als Teil des Überseehafens tideunabhängig sind. In diesem Hafenbereich wird der wesentlichste Teil des gesamten deutschen Automobilumschlags abgewickelt. Außerdem befinden sich hier zwei Schiffswerften.
Die Kaiserschleuse wurde zwischen 2007 und 2011 auf eine Länge von 305 m und eine Durchfahrtsbreite von 55 m vergrößert und gehört damit immer noch zu den größten Schleusenbauwerken der Welt.
 Die 1931 eingeweihte Nordschleuse verbindet die Häfen der Seestadt Bremerhaven mit der Weser. Gemeinsam mit der Kaiserschleuse sorgt sie dafür, dass die Dockhäfen als Teil des Überseehafengebietes tideunabhängig sind. In diesem Bereich des Hafens wird der wesentlichste Teil des gesamten deutschen Automobilumschlags abgewickelt. Außerdem befinden sich hier zwei Schiffswerften.
Die 1931 eingeweihte Nordschleuse verbindet die Häfen der Seestadt Bremerhaven mit der Weser. Gemeinsam mit der Kaiserschleuse sorgt sie dafür, dass die Dockhäfen als Teil des Überseehafengebietes tideunabhängig sind. In diesem Bereich des Hafens wird der wesentlichste Teil des gesamten deutschen Automobilumschlags abgewickelt. Außerdem befinden sich hier zwei Schiffswerften.
Schon lange war der Bau einer neuen Schleuse dringlich gewesen, da die Ozeandampfer immer riesiger wurden und insbesondere der Norddeutsche Lloyd darauf drängte, seine beiden Fahrgastschiffe ‚Bremen‘ und ‚Europa‘ zu den Dockanlagen durchschleusen zu können. Mit einer Länge von 375 m, einer Kammerbreite von 60 m und einer Fahrwassertiefe von 14,5 m gehört die Nordschleuse noch heute zu den größten Schleusenanlagen der Welt.
Neben der Schleuse befindet sich eine Drehbrücke für Eisenbahnen und Autoverkehr. Auch sie entstand 1931 und führt über den Verbindungskanal zwischen dem Wendebecken und den Kaiserhäfen. Sie ist zurzeit noch die größte Eisenbahn-Drehbrücke Deutschlands. Im Zuge der zukünftigen Umgestaltung der Columbuskaje gilt aber ein Rückbau der Bahnanlagen als wahrscheinlich. Das benachbarte Bahn-Stellwerk und die beiden Maschinenhäuser der Nordschleuse stehen unter Denkmalschutz.
Aus übereinander gestapelten Containern entstand in unmittelbarer Nähe der Schleuse eine Aussichtsplattform, von der aus der Schleusenbetrieb und das Treiben auf dem benachbarten Containerterminals gut beobachtet werden kann.
 Das ausgedehnte Containainer-Terminal im Norden der Seestadt Bremerhaven gehört zu den größten und wichtigsten Containerumschlagplätzen der Welt. Er wurde zwischen 1968 und 1971 gebaut und besaß zunächst eine 700 m lange Kaje an der Mündung der Weser. Bereits nach wenigen Jahren reichte die Kapazität nicht mehr aus und das Terminal wurde sowohl nach Süden als auch nach Norden erheblich erweitert, so dass 1983 das größte Container-Terminal Europas entstanden war. Dennoch blieben die Kapazitäten für den stark wachsenden Bedarf zu klein. Zwischen 1994 und 1996 erfolgte ein weiterer Ausbau zum Container-Terminal III. Zwischen 2004 und 2008 entstand dann das Container-Terminal IV. Die Fahrrinne der Außenweser wurde auf 14 m vertieft, damit auch die größten Containerschiffe tideunabhängig die Kaje anfahren können.
Das ausgedehnte Containainer-Terminal im Norden der Seestadt Bremerhaven gehört zu den größten und wichtigsten Containerumschlagplätzen der Welt. Er wurde zwischen 1968 und 1971 gebaut und besaß zunächst eine 700 m lange Kaje an der Mündung der Weser. Bereits nach wenigen Jahren reichte die Kapazität nicht mehr aus und das Terminal wurde sowohl nach Süden als auch nach Norden erheblich erweitert, so dass 1983 das größte Container-Terminal Europas entstanden war. Dennoch blieben die Kapazitäten für den stark wachsenden Bedarf zu klein. Zwischen 1994 und 1996 erfolgte ein weiterer Ausbau zum Container-Terminal III. Zwischen 2004 und 2008 entstand dann das Container-Terminal IV. Die Fahrrinne der Außenweser wurde auf 14 m vertieft, damit auch die größten Containerschiffe tideunabhängig die Kaje anfahren können.
Die gigantische Fläche des jetzigen Container-Terminals erstreckt sich nunmehr auf 3 Mio m², was einer Fläche von rund 360 Fußballfeldern entspricht. Die Stromkaje besitzt inzwischen eine Länge von 4930 m und bietet damit 14 Containerschiffen gleichzeitig einen Liegeplatz. Seit dem letzten Ausbau ist das Container-Terminal Bremerhaven das größte zusammenhängende Container-Terminal der Welt.
 Der Alte Leuchtturm am Neuen Hafen ist das Wahrzeichen der Seestadt Bremerhaven. Der 40 m hohe Turm wurde 1853 – 1855 im Stil der norddeutschen Backsteingotik erbaut. Zunächst wurde das Leuchtfeuer mit Gas betrieben. 1925 erhielt er dann elektrisches Licht, seit 1951 blinkt es automatisch im Gleichtakt: zwei Sekunden an, zwei Sekunden aus. Der Leuchtturm, der auch Simon-Loschen-Turm oder kurz Loschenturm genannt wird, ist noch heute in Betrieb.
Der Alte Leuchtturm am Neuen Hafen ist das Wahrzeichen der Seestadt Bremerhaven. Der 40 m hohe Turm wurde 1853 – 1855 im Stil der norddeutschen Backsteingotik erbaut. Zunächst wurde das Leuchtfeuer mit Gas betrieben. 1925 erhielt er dann elektrisches Licht, seit 1951 blinkt es automatisch im Gleichtakt: zwei Sekunden an, zwei Sekunden aus. Der Leuchtturm, der auch Simon-Loschen-Turm oder kurz Loschenturm genannt wird, ist noch heute in Betrieb.
 Als Bestandteil der ‚Havenwelten‘ eröffnete 2009 am Alten Hafen das ‚Klimahaus Bremerhaven 8° Ost‘. Auf der riesigen Ausstellungsfläche von 11.500 m² wird in vier Bereichen das Thema ‚Klima und Klimawandel‘ behandelt. Die vier Abteilungen heißen ‚Reise‘, ‚Elemente‘, ‚Perspektiven‘ und ‚Chancen‘.
Als Bestandteil der ‚Havenwelten‘ eröffnete 2009 am Alten Hafen das ‚Klimahaus Bremerhaven 8° Ost‘. Auf der riesigen Ausstellungsfläche von 11.500 m² wird in vier Bereichen das Thema ‚Klima und Klimawandel‘ behandelt. Die vier Abteilungen heißen ‚Reise‘, ‚Elemente‘, ‚Perspektiven‘ und ‚Chancen‘.
Der von der Fläche her größte Bereich ist die Reise. Der Besucher kann dabei virtuell auf dem östlichen 8. Längengrad, auf dem Bremerhaven liegt, rund um die Erde reisen. Dabei schreitet er durch neun verschiedene Stationen, bei denen Temperatur und Feuchtigkeit den jeweiligen Originalorten angepasst sind. In der Antarktis und in Alaska friert man bei Minustemperaturen, im Niger und in Kamerun schwitzt man bei bis zu 35°C.
In den anderen Ausstellungsbereichen werden beispielsweise die Fragen behandelt, wodurch das Klima und das Wetter beeinflusst werden, wie das Klima in der Vergangenheit aussah und in Zukunft aussehen wird und welche Handlungsmöglichkeiten es für den Menschen noch gibt. Dabei werden auch aktuelle Erkenntnisse der Klimaforschung präsentiert.
Bereits bei der Konzeption des Klimahauses hatte man versucht, den Energiebedarf so gering wie möglich zu halten. So werden beispielsweise die natürliche Sonneneinstrahlung und die Zirkulation der Innenluft für die Belüftung und die Klimatisierung genutzt.
Das Historische Museum Bremerhaven geht auf die Sammlung eines Heimatbundes zurück, die es bereits im 19. Jahrhundert gab. Lange nannte sich das Museum in Anlehnung an den Vereinsnamen ‚Morgenstern-Museum‘. Zu der Sammlung gehörten vor allem archäologische und volkskundliche Objekte.
Am Ufer der Geeste entstand 1991 ein neues Museumsgebäude, das seitdem ein völlig neues Museumskonzept verfolgte. Auf einer Fläche von fast 5000 m2 beschreiben sieben Unterabteilungen die Geschichte Bremerhavens von den ersten menschlichen Siedlungsspuren vor etwa 120.000 Jahren bis zu den 1960er Jahren unserer Zeit und geht dabei auch auf die Hochseefischerei und den Schiffbau ein. Teil der Ausstellung ist auch die Gemäldegalerie.
Neben der ständigen Ausstellung werden auch regelmäßig Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen gezeigt. Darüber hinaus werden hier auch häufig Vorträge und Konzerte veranstaltet.
Über viele Jahrzehnte hinweg war Bremerhaven der größte europäische Auswandererhafen. Mehr als 7 Mio. Menschen verließen zwischen 1830 und 1974 die alte Heimat, um im fernen Amerika ihr Glück zu suchen. Vom Tellerwäscher zum Millionär – dieses geflügelte Wort lockte viele in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Das Historische Museum Bremerhaven hat als dezentrales Projekt der EXPO 2000 die Deutsche Auswanderer-Datenbank geschaffen. Auf der Grundlage der Passagierlisten, die zum größten Teil noch existieren, wird versucht, möglichst viele Informationen über die Auswanderer zu sammeln. Etwa 5 Millionen Menschen, die vor 1939 Europa verlassen haben, sind auf diese Weise bereits erfasst worden. An zwei Terminals können Besucher des Historischen Museums selber kostenfrei nach diesen Personen recherchieren.
Das ‚Schaufenster Fischereihafen‘ ist eine maritime Erlebniswelt rund um die Themen ‚Fisch‘ und ‚Meer‘. Der älteste Bremerhavener Fischereihafen entstand Ende des 19. Jahrhundert auf Anordnung der preußischen Regierung. Heute liegt hier das Museumsschiff FMS Gera, Deutschlands einziges schwimmendes Hochseefischerei-Museum. 1907 entstand am Hafenbecken die Packhalle IV. Nach einer umfassenden Sanierung siedelten sich hier gehobene Fischrestaurants, urgemütliche Hafenkneipen, Geschäfte mit Fischfeinkost und maritimer Zubehör und ein Theater an.
Ein besonderer Anziehungspunkt mit seinem 150.000 l fassenden Meerwasseraquarium ist das Atlanticum. Es wurde Mitte der 1990er Jahre als informatives Erlebniszentrum eingerichtet. Hier kann man die in der Nordsee und im Nordatlantik beheimateten Meerestiere beobachten, wie beispielsweise den Katzenhai, Kabeljau und Scholle oder den Hummer. Ein Tunnel führt quer durch das Aquarium und vermittelt so auch einen Blick von unten in die faszinierende Welt des Meeres.
1960 lief auf der Penewerft in Wolgast der Trawler ‚Gera‘ vom Stapel. Bis 1990 wurde er vom ‚Fischkombinat Rostock‘ in der damaligen DDR betrieben. Alle anderen Seitentrawler sind inzwischen verschrottet. Das Fischereimotorschiff ‚FMS Gera‘ blieb als einziges Schiff ihrer Art erhalten und befindet sich nun als Außenstelle des Historischen Museums Bremerhaven im Fischereihafen I. Sie misst eine Länge von 65,5 m und besitzt 942,9 BRT. Seitentrawler werden so genannt, weil ihre Netze nur über die Steuerbordseite ausgesetzt wurden. Die ‚Gera‘ ist noch in der Originalausstattung erhalten und bietet daher ein sehr anschauliches Bild von der Arbeit der Fischer auf hoher See. Von den Fangnetzen auf Deck über die Maschinenanlage und die Kapitänskammer bis zur Kombüse sieht noch alles so aus, als würde der Trawler bald wieder in See stechen.
Die ‚Gera‘ ist Deutschlands einziges schwimmendes Hochseefischerei-Museum. Eine Ausstellung mit Fotos und Dokumentarfilmen verdeutlicht den beschwerlichen und körperbetonten Arbeitsalltag an Bord.
Die gezeigten Gegenstände im Museum der 50er Jahre gehen auf eine Sammlung der Historikerin und Psychologin Kerstin von Freytag Löringhoff zurück. In einer ehemaligen Garnisonskirche auf dem Gelände der ehemaligen Carl-Schurz-Kaserne fand die Sammlung seit 2005 eine neue feste Bleibe. Inzwischen werden auf einer Ausstellungsfläche von 500 m2 über 1000 große und kleine Utensilien, Geräte, Güter und Gebrauchsgegenstände gezeigt, die die Lebensverhältnisse in dieser Zeit dokumentieren und verdeutlichen.
Über viele Jahrzehnte hinweg war Bremerhaven der größte europäische Auswandererhafen. Mehr als 7 Mio. Menschen verließen zwischen 1830 und 1974 die alte Heimat, um im fernen Amerika ihr Glück zu suchen. Vom Tellerwäscher zum Millionär – dieses geflügelte Wort lockte viele in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Das Deutsche Auswandererhaus am Neuen Hafen behandelt als Museum die Auswanderung Deutscher in die USA. Ein Rundgang führt den Besucher zu den verschiedenen Stationen einer Auswanderung. Dabei hat er kostenlosen Zugang zu verschiedenen Datenbanken, um selber nach bestimmten ausgewanderten Personen recherchieren zu können.
Seit 2012 behandelt das Museum in einer neuen Abteilung auch die Einwanderung nach Deutschland seit dem 18. Jahrhundert bis heute.
Das europäische Museumsforum zeichnete das Deutsche Auswandererhaus im Jahre 2007 mit dem Preis ‚Europäisches Museum des Jahres‘ aus.
Der kleinste öffentliche Zoo Deutschlands geht auf die ehemaligen ‚Tiergrotten‘ zurück, die in Bremerhaven seit 1928 bis 2000 ein beliebtes Ausflugsziel waren. Der Zoo am Meer wurde als Themenzoo vollständig neu konzeptioniert und befindet sich direkt am Weserdeich nahe dem Großen Leuchtturm. Den Schwerpunkt bilden weiterhin die Meerestiere sowie im und am Wasser lebende Tiere, wie Eisbären, Robben und Pinguine. Unter den fast 50 verschiedenen Arten befinden sich aber auch Schimpansen und Pumas. Eine Aussichtsplattform innerhalb des Zoogeländes bietet darüber hinaus einen Blick auf die Wesermündung und die hier vorbeifahrenden Schiffe.
 Direkt am Weserdeich, mitten im Hafengebiet der Seestadt Bremerhaven, steht seit 2008 das markante Vier-Sterne-Hotel ‚ATLANTIC Hotel SAIL City‘. Das moderne, 147 m hohe Gebäude wurde in Form eines riesigen Segels gestaltet. Es besitzt insgesamt 23 Etagen, wobei die oberen Stockwerke als Büroflächen vermietet sind. In der 20. Etage besitzt das Bauwerk eine eintrittspflichtige Besucherterrasse, die auch von außen zugänglich ist.
Direkt am Weserdeich, mitten im Hafengebiet der Seestadt Bremerhaven, steht seit 2008 das markante Vier-Sterne-Hotel ‚ATLANTIC Hotel SAIL City‘. Das moderne, 147 m hohe Gebäude wurde in Form eines riesigen Segels gestaltet. Es besitzt insgesamt 23 Etagen, wobei die oberen Stockwerke als Büroflächen vermietet sind. In der 20. Etage besitzt das Bauwerk eine eintrittspflichtige Besucherterrasse, die auch von außen zugänglich ist.
In Bremerhaven heißt sie eigentlich nur ‚Große Kirche‘. Immerhin ist der Turm mit der spitzen Haube 86 m hoch und damit schon von Weitem zu sehen. Der Kirchturm ist auch der einzige Gebäudeteil, der den Zweiten Weltkrieg halbwegs unbeschadet überstand. Ein Bombentreffer zerstörte 1944 den alten dreischiffigen Bau. Dieser war zwischen 1853 und 1855 im neugotischen Stil entstanden. Der Wiederaufbau war dann 1960 vollendet worden. Schon zuvor war die Seefahrerkirche zu Ehren des Stadtgründers, Bürgermeisters und Pastors in ‚Bürgermeister Schmid Gedächtniskirche‘ umbenannt worden. Johann Smid (1733 – 1857) war es auch, der die Kirche 1855 eingeweiht hatte.
Die historische Innenausrüstung ging im Krieg verloren. Beachtenswert sind dennoch die Glasfenster im Chor, die Ende der 1950er Jahre von Gottfried von Stockhausen entworfen wurden. Das Kirchengebäude wird heute von einer Vereinigten Protestantischen Gemeinde, bestehend aus Lutheranern und Reformierten Gemeindegliedern, genutzt.
 Ein markantes Bauwerk Bremerhavens ist der 107 m hohe Richtfunkfurm, oftmals fälschlich auch als Radarturm bezeichnet. Er wurde zwischen 1962 und 1965 erbaut und dient dem Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven unter anderem als Sende- und Empfangsanlage für den Seefunk, den Pegeldatenfunk und für Richtfunkverbindungen.
Ein markantes Bauwerk Bremerhavens ist der 107 m hohe Richtfunkfurm, oftmals fälschlich auch als Radarturm bezeichnet. Er wurde zwischen 1962 und 1965 erbaut und dient dem Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven unter anderem als Sende- und Empfangsanlage für den Seefunk, den Pegeldatenfunk und für Richtfunkverbindungen.
Der Stahlbetonturm besitzt auf 59 Metern Höhe eine öffentlich zugängliche Aussichtsplattform, von der man einen großartigen Überblick über die gesamte Seestadt und die Wesermündung hat.
Lehe war einst eine selbständige Stadt, ehe sie 1947 nach Bremerhaven eingemeindet wurde. Das heute unter Denkmalschutz stehende alte Rathaus Lehes wurde 1865 im klassizistischen Stil gebaut, diente zunächst jedoch als Armen- und Waisenhaus. Im Zuge des Historismus wurde das Gebäude 1887 neugotisch verziert. Im Jahre 1907 folgten ein dreistöckiger Anbau und der Aufsatz des kleinen Türmchens. Zwischenzeitlich hatte das Rathaus auch einer Artilleriekaserne als Quartier gedient.
Nach dem Verlust der Selbstständigkeit wurde das historische Gebäude durch die Justiz genutzt. Einige Räume dienen auch dem Jugendamt sowie dem Betreuungsverein Bremerhaven.
Im 19. Jahrhundert entstand im Leher Stadtteil Speckenbüttel ein hübscher Park mit reichem Eichenbestand. Mit seinem Reitplatz und der Rennbahn wurde der 75 ha große Speckenbütteler Park ein beliebtes Ausflugsziel. Den Eingang zum Park markiert auch heute noch ein markantes Tor, welches 1896 im Stil des Historismus erbaut wurde. Das massiv wirkende Gebäude mit dem großen Torbogen erinnert mit seinen Türmchen an eine romantische mittelalterliche Burganlage.
 Als Bremerhaven im 19. Jahrhundert gegründet wurde, war das benachbarte Geestemünde noch eine selbstständige, zu Hannover gehörende Stadt. Als Konkurrenz zu Bremerhaven wurde in den 1850er Jahren ein eigener Seehafen angelegt. Über den Hauptkanal wurde 1861 eine Drehbrücke erbaut, die heute Bremerhavens älteste noch bestehende bewegliche Brücke ist. Die mit 45 m relativ lange Stahlbrücke besteht aus zwei Flügeln, die ihren Drehpunkt in der Mitte haben. Sie steht inzwischen unter Denkmalschutz und wird immer noch für die Durchfahrt von Sportbooten betrieben.
Als Bremerhaven im 19. Jahrhundert gegründet wurde, war das benachbarte Geestemünde noch eine selbstständige, zu Hannover gehörende Stadt. Als Konkurrenz zu Bremerhaven wurde in den 1850er Jahren ein eigener Seehafen angelegt. Über den Hauptkanal wurde 1861 eine Drehbrücke erbaut, die heute Bremerhavens älteste noch bestehende bewegliche Brücke ist. Die mit 45 m relativ lange Stahlbrücke besteht aus zwei Flügeln, die ihren Drehpunkt in der Mitte haben. Sie steht inzwischen unter Denkmalschutz und wird immer noch für die Durchfahrt von Sportbooten betrieben.
Der Kunstverein Bremerhaven von 1886 e.V. besitzt mit dem Kunstmuseum und der Kunsthalle gleich zwei große Häuser. In der Kunsthalle werden wechselnde Ausstellungen gezeigt. Im Erdgeschoss gibt es zudem ein Kabinett für zeitgenössische Kunst. Im Jahre 2007 eröffnete das Kunstmuseum neu. Auf drei Stockwerken wird hier die Sammlung des Kunstvereins gezeigt. In einzelnen Künstlerräumen werden dabei Werke eines Künstlers oder einer Künstlergruppe separat beleuchtet. Teilweise wurde diese Räume auch durch die jeweiligen Künstler mitgestaltet.
Bei der Ausstellung im PHÄNOMENTA Science Center kann man sich auf insgesamt 80 Experimentierstationen mit den Geheimnissen aus Naturwissenschaft und Technik auseinandersetzen. Das Forschen und das Entdecken stehen im Mittelpunkt. Groß und klein sollen mit Spaß und Freude interessanten Phänomenen auf die Spur kommen. Man kann sich beispielsweise seine eigene Handcreme herstellen oder sich ein Cent-Stück vergolden lassen.
Eine besondere Attraktion ist der Fahrstuhl-Simulator, der die Besucher 5.500 m tief in die Erde in einen Salzstock weit unter der Weser bringt.
Verbrechen lohnt sich nicht – ein Besuch im Polizeimuseum schon! So wird im ehemaligen Polizeigefängnis mit verschiedenen Exponaten, Schautafeln und Fotografien auf rund 100 m2 eine interessante Ausstellung gezeigt, die die Rolle der Polizei bei der Verbrechensbekämpfung verdeutlichen soll. Das Anschauungsmaterial beinhaltet auch eine Waffensammlung aus bekannten Kriminalfällen. Ziel des Museums ist es, aufzuklären, zu informieren und das Verhältnis zwischen Polizei und Bürgern zu verbessern. Und vielleicht hilft die Atmosphäre der Ausstellung ja auch, den einen oder anderen von einer kriminellen Karriere abzuhalten…
Das Museum richtet sich an alle interessierten Bürger ab 14 Jahren. Führungen werden für 8 – 15 Personen angeboten. Eine Anmeldung vor dem Besuch ist erforderlich.
Am Speckenbütteler Park betreibt der Bauernhausverein bereits seit 1908 ein liebevoll gepflegtes Freilichtmuseum. Das Gelände besteht aus einer Geesthof-Anlage, dem Marschenhaus sowie eine Bockwindmühle.
Der Geesthof wurde ursprünglich 1629 erbaut und 1910 an seine jetzige Position umgesetzt. Nach und nach wurde der Hof mit Altenteilerhaus, Scheune, Schafstall, Backhaus, Güpelhaus und Moorkate ergänzt. Das Marschenhaus ist ein rekonstruierter Nachbau des Originalgebäudes von 1731, dass bei einem Feuer vernichtet wurde. Auch die Bockwindmühle ist nicht das erste Mühlengebäude auf dem Museumsgelände, die beiden Vorgängerbauten fielen ebenfalls einem Brand zum Opfer.
Radrouten die durch Bremerhaven führen:
Weser-Radweg
Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer
Nordseeküstenradweg
Otterndorf
ie Kleinstadt an der Elbemündung gehört zur im Jahr 2011 neugegliederten Samtgemeinde ‚Land Hadeln‘. Die historische Landschaft Land Hadeln ist ein geschlossener Kulturraum im Elbe-Weser-Dreieck. Otterndorf war auch schon zuvor der Hauptort. Das Nordseebad besitzt einen kleinen Hafen an der Elbe, doch das Ortszentrum mit seiner hübschen Fachwerk-Altstadt liegt jedoch etwas zurückgesetzt im Landesinneren.
Im 1585 errichteten Kranichhaus mit seinem hübschen barocken Giebel ist heute das Museum des alten Landes Hadeln untergebracht. Das Torhaus der ehemaligen Burg beherbergt das Heimatmuseum. Sehenswert sind das Rathaus von 1683 und die Lateinschule von 1614 und die Speicherstadt, deren alte Speichergebäude heute mehrheitlich als Wohn- oder Geschäftshäuser genutzt werden. Das Hadler Haus von 1792, das einst einen Kornspeicher und ein Kaufmannshaus beherbergte, dient heute als Veranstaltungsort. Im Schloss, das 1773 neu errichtet wurde, sitzt heute das Amtsgericht.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Otterndorf führen:
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer
Nordseeküstenradweg
Stade
ie alte Hansestadt an der Unterelbe besitzt einen der ältesten Häfen im Norden. Lange Zeit war der Handelsplatz an der Schwinge wichtiger als Hamburg. Bereits im frühen 12. Jahrhundert gab es hier auf einem Geesthügel einen Königshof, um den sich ein Hafenplatz entwickelte. Damit gilt Stade als eine der ältesten Städte Europas. Das malerische Stadtbild rund um den Hansehafen aus dem 12. Jahrhundert, dem einstigen wirtschaftlichen Herzen der Hansestadt, zeugt noch von dieser Zeit. Der Hansehafen ist mit seinen historischen Kaimauern ist bis heute fast unverändert erhalten geblieben.
Um den Hafen gruppieren sich der Schwedenspeicher von 1705, in dem sich heute ein interaktives Museum befindet, das die Geschichte der Hanse erzählt, das Bürgermeister-Hintze-Haus mit seiner prachtvollen Renaissance-Fassade, das Goeben-Haus und die 1753 erbaute Stadtwaage, der alte Holzdrehkran, die Hudebrücke und mehrere alte Handelshäuser. Die gesamte Altstadt, die auf einer Insel liegt, wird geprägt von zahlreichen verwinkelten Gassen, hübschen Fassaden und altertümlichem Kopfsteinpflaster. Viele alte Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert sind noch erhalten und zeugen von den wechselnden Stilepochen Gotik, Renaissance, Barock und Klassizismus. Sehenswert sind die Löwenapotheke (ein typisch mittelalterliches Gildehaus), das gotische Kellergewölbe des Rathauses, das zu den ältesten in ganz Deutschland zählt, die St. Cosmae et Damiani-Kirche mit seiner Hus/Schnitger-Orgel sowie die St. Wilhadikirche, die eine Orgel von Erasmus Bielefeldt beherbergt.
Neben dem alten Hansehafen besitzt Stade noch den um 1880 angelegten Stadthafen, der heute Liegeplatz für Sportboote und historische Schiffe ist, den Holzhafen, von dem aus Fleetkahn-, Kanu- und Tretbootfahrten starten sowie der Elbe-Seehafen bei Bützfleeth, der noch immer zu den wichtigsten Umschlagplätzen in Niedersachsen zählt.
Am Stadthafen liegt das Küstenmotorschiff ‚Greundik‘, das heute als Museumsschiff zu besichtigen ist. Das vielfältige und umfangreiche museale Angebot umfasst das Kunsthaus, das Freilichtmuseum mit einer alten Bockwindmühle und mehreren historischen Hofbauten, das Baumhausmuseum, das Heimatmuseum sowie das Patenschaftsmuseum Goldap mit seinen Zeugnissen aus dem ehemaligen gleichnamigen ostpreußischen Landkreis.
Abseits der Stadt, aber noch zur Gemarkung Stade gehörend, befindet sich direkt an der Elbe die alte Festung ‚Grauerort‘. Sie wurde als preußisches Bollwerk gegen zwischen 1869 und 1879 bei Abbenfleth erbaut, um den Hamburger Hafen vor feindlichen Schiffen – vornehmlich vom damaligen Erzfeind Frankreich – zu schützen. Die Festung wurde allerdings nie in Kampfhandlungen verwickelt.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Stade führen:
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer
Mönchsweg (Munkevejen)
Nordseeküstenradweg
Hollern-Twielenfleth
m Alten Land, dem Obstgarten an der Niederelbe, liegt inmitten von Apfel-, Birn- und Kirschbaumplantagen, liegt Hollern-Twielenfleth. Neben den beiden Ortsteilen Hollern und Twielenfleth gehört auch Bassenfleth zur Gemeinde. Am Elbdeich steht der Alte Twielenflether Leuchtturm Er war von 1893 bis 1984 in Betrieb und beherbergt heute ein kleines Schifffahrtsmuseum mit einer stattlichen Anzahl von Schiffsmodellen, Plänen und Schifffahrtskarten. Weithin sichtbar steht die Windmühle ‚Venti Amica‘ zwischen Twielenflether und Hollern. Die ‚Freundin des Windes‘, so die Übersetzung aus dem lateinischen, ist eine typische Mühle vom Typ Galerieholländer. Die St.-Mauritius-Kirche in Hollern wurde in ihrer Form wohl bereits im 13. Jahrhundert erbaut. Der Turm stammt noch von einem Vorgängerbau. Zur Inneneinrichtung gehört eine originale Arp-Schnitger-Orgel. Die St. Georg/St. Marienkirche in Twielenfleth ist dagegen deutlich jünger und entstand erst 1819. Auch sie hatte vermutlich mehrere Vorgängerkirchen und beherbergt einen Flügelaltar mit den 12 Aposteln, der aus dem späten 15. Jahrhundert stammt sowie eine Orgel von Philipp Furtwängler.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Hollern-Twielenfleth führen:
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Mönchsweg (Munkevejen)
Nordseeküstenradweg
Steinkirchen (Altes Land)
Der Ort Steinkirchen hieß früher einmal schlicht ‚Lu‘, was sich wahrscheinlich auf eine steinerne Kirche bezog. Später finden sich die Bezeichnungen ‚Steenlu‘ und ‚Steenkarken‘. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich der Ortsname Steinkirchen durch. Im Niederdeutschen heißt der Ort bis heute ‚Steenkark‘. Offensichtlich hatte hier bereits zu Zeiten, als Kirchen üblicherweise aus Holz errichtet wurden, bereits eine erste Feldsteinkirche gestanden. Die ältesten Teile der heutigen St.-Martini et Nicolai-Kirche stammen noch aus dem 14. Jahrhundert. Allerdings hatte man das Gotteshaus im Laufe der Geschichte vielfach umgebaut. Stolz ist man auf die Arp-Schnittger-Orgel. Der berühmte Orgelbaumeister schuf das Instrument zwischen 1685 und 1687, das damit zu seinen frühesten Werken zählt. Die wertvolle Orgel ist noch außergewöhnlich gut erhalten.
Steinkirchen ist Verwaltungssitz der Samtgemeinde Lühe, die nach dem gleichnamigen Fluss benannt ist, und liegt inmitten des Alten Landes, einem der größten Obstanbaugebiete Europas. Beeindruckend sind die riesigen Strommasten der ‚Elbekreuzung 2‘ auf der vorgelagerten Elbinsel Lühesand. Sie sind die höchsten Freiluftmassen Europas – schließlich müssen die großen Containerschiffe und die Kreuzfahrtgiganten unten hindurch passen, wenn sie auf dem Weg nach Hamburg die Stelle passieren.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Steinkirchen (Altes Land) führen:
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Mönchsweg (Munkevejen)
Nordseeküstenradweg
Grünendeich
erträumt im Alten Land, umgeben von Obstplantagen, liegt an der Unterelbe das Dorf Grünendeich. Schmucke, historische Altländer Höfe mit ihrem typischen Giebelschmuck stehen am Wegesrand und die Deiche schützen nicht nur vor der Elbe, sondern auch vor der Lühe, die hier in den Elbestrom mündet. Das gesamte Gebiet wurde in seiner Geschichte durch Sturmfluten arg gebeutelt. Eine erste Kirche fiel den Wassermassen im 16. Jahrhundert zum Opfer, so dass ein neues Gotteshaus erbaut werden musste. Der hölzerne Glockenturm der St. Marienkirche stammt noch aus dem Jahre 1625. Das Lühesperrwerk an der Mündung des linken Elbenebenflusses wurde in den 1960er Jahren für den Schutz der Ortschaften im Alten Land gegen die Hochwassermassen erbaut. Über eine Klappbrücke, gleich neben dem alten rot-weiß gestreiften Leuchtturm, führt eine Straße über den Fluss.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Grünendeich führen:
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Mönchsweg (Munkevejen)
Nordseeküstenradweg
Jork
ork ist das Zentrum des Alten Landes, eines der größten Obstanbaugebiete Europas. Hier werden überwiegend Äpfel, aber auch Birnen, Kirschen und andere Obstarten angebaut. Einige Apfelsorten, wie Jamba, Gloster 69, Richared oder der Glockenapfel haben hier ihren Ursprung. Der Begriff ‚Altes Land‘ hat aber nichts mit ‚alt‘ zu tun, sondern bezieht sich auf holländische Kolonisten im 12 und 13. Jahrhundert. Im Niederdeutschen wird das Gebiet ‚Olland‘ bezeichnet. Aus der hochdeutschen Form ‚Altland‘ entwickelte sich ‚Altes Land‘. Der Obstanbau geht nachweislich bis in das 13. Jahrhundert zurück. Das Museum Altes Land erzählt alles Wissenswerte über diese Region. Überall sieht man hier noch alte Fachwerkhöfe, ausgestattet mit auffälligen und prunkvollen Toren. Das heutige Rathaus befindet sich im Gräfenhof, einem ehemaligen Adelssitz von 1651. In Moorende befindet sich die Esteburg, die auf eine alte Wasserburg zurückgeht. Das Herrenhaus stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert und besitzt einige typische Elemente der Weserrenaissance – und das in unmittelbarer Nähe der Elbe! Sehenswert ist auch die alte Borsteler Windmühle, deren eigentlicher Name ‚Aurora‘ ist. Die Mühle vom Typ eines Galerieholländers wurde 1856 erbaut. Im Jahre 1907 wurde allerdings vollständig auf Motorbetrieb umgestellt, um vom Wind unabhängig zu sein. Drei Stockwerke des Gebäudes werden heute als Restaurant genutzt. Die St. Nikolaikirche wurde 1412 nach der verheerenden Cecilienflut erbaut – wobei der Glockenturm erst 1695 entstand. Eine Besonderheit bietet das Unterfeuer Mielstach. Der viereckige weiße Leuchtturm nahe der Lunemündung wurde 1905 zusammen mit einem Wohnhaus erbaut. Obwohl bereits Pläne für den Abriss bestanden, ist das Leuchtfeuer noch immer im Betrieb.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Jork führen:
Hamburg-Finkenwerder
chon in den 1930er Jahren hatte sich mit der ‚Hamburger Flugzeugbau GmbH‘ ein erstes Luftfahrtunternehmen auf der Insel Finkenwerder angesiedelt. Bald darauf entstand ein erster Flugplatz, der heute von der EADS betrieben wird. Hier findet die Endmontage der Airbus A320er Familie (A318 – A321), die Teilmontage der A330 sowie der Innenausbau und die Auslieferung des doppelstöckigen A380, dem größten Passagierflugzeug der Welt, statt. Eine Besucherplattform bietet einen Überblick über das riesige Gelände, das in den 1990er Jahren noch einmal erheblich ausgebaut worden war.
Die Insel Finkenwerder war ursprünglich durch mehrere Sturmfluten im 12. und 13. Jahrhundert entstanden, wurde inzwischen aber durch Eindeichungen und den Bau eines Dammes zur Halbinsel. Eine Zeitlang war Finkenwerder bis 1937 zweigeteilt. Während das nördliche Gebiet schon damals Teil von Hamburg war, gehörte das südliche Areal zunächst zum Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, später dann zum Königreich Hannover und danach zum Staat Preußen.
Neben dem Finkenwerder Trachten- und Heimatmuseum wurde auch das Geburtshaus von Gorch Fock (1880-1916) als Museum eingerichtet. Gorch Fock, der mit bürgerlichem Namen Johann Wilhelm Kinau hieß, war Anfang des letzten Jahrhunderts ein bekannter Schriftsteller. Er starb während des Ersten Weltkrieges in der Schlacht am Skagerrak. Die deutsche Marine hat zwei Segelschulschiffe nach ihm benannt.
Am Köhlfleet-Hauptdeich gibt es für Schiffsinteressierte einen Museumshafen, in dem mehrere historische Kutter, Segelboote, Motorschiffe und das Fährschiff ‚Altenwerder‘ liegen. Das älteste Boot ist der Besan Ewer ‚Eule‘. Das kleine Segelschiff lief 1896 vom Stapel. Einst war im Museumshafen die Fischereiflotte beheimatet.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Hamburg-Finkenwerder führen:
Brunsbüttel
runsbüttel besitzt einen einzigartigen maritimen Charakter. Hier, wo die Elbe bereits drei Kilometer breit ist und einen Tidenhub von bis zu drei Metern besitzt, beginnt der Nord-Ostsee-Kanal. Der 1895 fertig gestellte Kanal, der bei Kiel an der Föhrde endet, ist die meistbefahrenste künstliche Wasserstraße der Welt und bringt den großen Ozeandampfern eine Zeitersparnis von bis zu zwei Tagen, um auf direktem Wege in die Ostsee zu gelangen. So kann man hier Containerschiffe, Tanker und Kreuzfahrtschiffe beobachten, die an den alten Leuchttürmen vorbei in die Schleuse zum Kanal einbiegen. Jeweils Dienstags um 14:00 Uhr finden Schleusenführungen für interessierte Besucher statt. Direkt am Wasser ist mit der Schleusenmeile eine attraktive Erlebniswelt mit Geschäften, Cafés und Galerien entstanden. Das eigentliche historische Zentrum der Stadt liegt weiter nördlich mit der 1726 neu errichteten Jakobuskirche als Mittelpunkt. Das 1779 erbaute Matthias-Boie-Haus gilt als eines der schönsten Fachwerkhäuser in Dithmarschen. Mit der Stadtgalerie besitzt Brunsbüttel ein interessantes Museum für zeitgenössische Kunst mit regelmäßig wechselnden Ausstellungen. Daneben gibt es hier ein Heimatmuseum und ein Kanalmuseum, dass die Entwicklungsgeschichte des Nord-Ostsee-Kanals mit vielen historischen Exponaten beschreibt.
In Brunsbüttel findet alljährlich das vielbeachtete Schleswig-Holstein-Musik Festival statt.
Das Kernkraftwerk an der Unterelbe ist inzwischen abgeschaltet.
Neben den Radfernwegen Elbe Radweg, Nordseeküsten-Radweg und Nord-Ostseekanal-Route führen auch die Deutsche Fährstraße und die Grüne-Küsten-Straße durch den Ort.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Brunsbüttel führen:
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Nord-Ostsee-Kanal-Route
Nordseeküstenradweg
Deutsche Fährstraße (nördlicher Abschnitt)
Sankt Margarethen
inst hieß das Dorf Elredefleth und befand sich direkt an der Elbe. Doch die ständigen Fluten bedrohten den Ort, so dass er schließlich an seine heutige Stelle zurückverlegt wurde. Am 13. Juli, dem Margarethentag, weihte man das neue Dorf mit neuem Namen ein.
Die lutherische Kirche ist eine barocke Backsteinkirche, deren Innenraum reich mit Marmormalereien und Blattgold verziert ist. Der schieferbedeckte hölzerne Glockentturm steht frei neben dem Kirchengebäude, da ansonsten der feuchte Marschenboden die Last nicht tragen würde.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Sankt Margarethen führen:
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Nordseeküstenradweg
Deutsche Fährstraße (nördlicher Abschnitt)
Brokdorf
erühmt geworden ist die kleine Gemeinde am nördlichen Elbufer durch sein Kernkraftwerk und die Großdemonstrationen, in den 1970er und 1980er Jahren, mit denen der Bau verhindert werden sollte. Seit 1986 ist das Kernkraftwerk in Betrieb. Eine Abschaltung muss nach dem gegenwärtigen Atomgesetz bis 2021 erfolgen. Interessierte können das Informationszentrum des KKW besuchen. Das Dorf in der Wilstermarsch besitzt einen eigenen Sandstrand an der Elbe und liegt direkt am ElbeRadWeg, dem Nordseeküsten-Radweg (der längsten Radroute der Welt), der Deutschen Fährstraße und der Grünen Küstenstraße. Die St. Nikolauskirche wurde 1763 als Ersatz für eine wegen Baufälligkeit abgetragenen Kirche aus dem 14. Jahrhundert errichtet. Der freistehende Glockenturmturm war bereits 20 Jahre zuvor entstanden.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Brokdorf führen:
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Nordseeküstenradweg
Deutsche Fährstraße (nördlicher Abschnitt)
Glückstadt
ie ehemalige Festungsstadt besitzt ein geradezu malerisches Ambiente mit einem Außen- und einen Binnenhafen. Beide Hafenanlagen werden durch ein Sperrwerk voneinander getrennt, das tideabhängig nur zu bestimmten Zeiten geöffnet wird. Dementsprechend können auch nur zu diesen Zeiten die Boote zwischen den beiden Häfen wechseln. Der Hafen war der Anlass für die Gründung Glückstadts im Jahre 1617. Der dänische König Christian IV. wollte auf dem damals noch zu Dänemark gehörenden Areal einen prachtvollen und mächtigen Gegenpol zum aufstrebenden Hamburg und einen strategischen Platz für die dänische Flotte schaffen. Von ihm wurde der Satz ‚Dat schall glücken un dat mutt glücken, un dann schall se ok Glückstadt heten‘ (Das soll glücken und das muss glücken, und so soll sie auch Glückstadt heißen) überliefert. Auf sechseckigem Grundriss entstand am rechten Elbufer auf freiem Felde eine völlig neue Stadt. Doch des Königs ehrgeiziges Ziel wurde letztendlich verfehlt, denn im 18. Jahrhundert bildete sich direkt vor der Stadt eine große Sandbank, die den Schiffsverkehr in den Hafen stark behinderte, während die Fahrrinne nach Hamburg frei blieb. Der gewerbliche Betrieb auf dem Gelände der Docks wurde immer spärlicher und im Jahre 2002 schließlich vollständig eingestellt. Danach entwickelte sich hier ein gemütliches parkähnliches Quartier mit dem thematischen Schwerpunkt ‚Elbe als Lebensraum‘. Die historisch erhaltene Innenstadt mit ihren zahlreichen Cafés, Restaurants, Galerien, Ateliers und Geschäften lädt zum gemütlichen Bummeln ein. Im Palais für aktuelle Kunst, einem restaurierten Adelspalais aus dem 17. Jahrhundert, werden regelmäßig wechselnde Ausstellungen präsentiert. Das Detlefsen-Museum im 1632 erbauten Brockdorff-Palais ergänzt das kulturelle Angebot. Die interessante Ausstellung thematisiert die historische Entwicklung Glückstadts und geht besonders auf die Gründungsgeschichte unter dem dänischen König Christian IV. ein. Das Palais wurde im Stil der Renaissance errichtet und spiegelt den Glanz der königlich-dänischen Ära wieder. In der Altstadt finden sich noch viele weitere historische Gebäude und Adelshöfe, wie das barocke Wasmer-Palais, das im Stil der Spätrenaissance erbaute Rathaus und das Palais Quasi non Possidentes. Am Hafen stand einst der Königshof, in dem Christian IV. eine Zeit lang residierte. Doch nach einem Großbrandt im 19. Jahrhundert blieb nur der Wiebke-Kruse-Turm erhalten. Die Straße ‚Am Hafen gilt mit seinen historischen Fassaden als die bedeutendste Uferstraße Norddeutschlands. Der Marktplatz im Zentrum Glückstadts wird neben dem Rathaus vor allem durch die Stadtkirche dominiert. Das noch aus der Gründungszeit stammende Gotteshaus gilt als das bedeutendste erhaltene Bauwerk der Stadt.
Als kulinarische Spezialität muss natürlich der berühmte Glückstädter Matjes hervorgehoben werden. Dem Fisch zu Ehren werden alljährlich im Juni die Matjeswochen mit Live-Musik, verschiedenen Märkten und der Open-Ship-Meile veranstaltet – schließlich hatte der Herings- und Walfischfang die Stadt über Jahrhunderte wirtschaftlich geprägt!
Sehenswertes:
Radrouten die durch Glückstadt führen:
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Nordseeküstenradweg
Deutsche Fährstraße (nördlicher Abschnitt)
Kollmar
as Marschendorf am rechten Elbufer ist ein beliebtes Ausflugsziel für Naherholungssuchende. Vom Deich aus kann man den geschäftigen Schiffsverkehr auf der Elbe beobachten, die vielen reetgedeckten Häuser belegen den dörflichen Charakter des landwirtschaftlich geprägten Ortes in der Kremper Marsch. Obwohl Kollmar im 30jährigen Krieg fast vollständig zerstört wurde, hat die Kirche den Feuersturm überstanden. Der einschiffige Backsteinbau stammt noch aus dem 15. Jahrhundert.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Kollmar führen:
Seester
ie ländliche Gemeinde in der Seestermüher Marsch besitzt im Dorfzentrum rund um die St.-Johanneskirche ein sehenswertes historisches Gebäudeensemble. Die bereits 1428 erbaute Kirche, eine Patronatskirche des damaligen Klosters und heutigen Damenstiftes Uetersen, besitzt einen schmucken Barockaltar, eine hölzerne Lazarusfigur aus dem 17. Jahrhundert sowie eine Kanzel von 1631. Ihr heutiges äußerliches Aussehen erhielt sie allerdings erst durch eine Ummantelung im späten 19. Jahrhundert. Auch der Dachreiter wurde bei diesem letzten Umbau aufgesetzt. Zu dem Ensemble gehört neben der Kirche das Pastorat, eine ehemalige Gastwirtschaft, die heute einen Kindergarten und das Kirchenbüro beherbergt, das Saalgebäude und das ehemalige Küsterwohnhaus.
Die Fähre Kronsnest gehört zu den kleinsten Personenfähren Deutschlands und verbindet auf der Krückau die Gemeinde Seester mit Neuendorf Das handbetriebene Holzboot kann bis zu sieben Personen mit ihren Rädern transportieren. Die Breite der Krückau variiert übrigens tideabhängig zwischen rund 16 m bei Ebbe und 40 m bei Flut. Einst gehörte die Fähre zu den wichtigsten Verkehrsmitteln in der Marsch – heute ist sie nur noch eine touristische Attraktion.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Seester führen:
Haseldorf
aseldorf liegt in der nach dem Ort benannten Haseldorfer Marsch. Schon 1190 wurde ein ‚Ritter de Haselthorpe‘ mit seiner Burg urkundlich erwähnt. Der Gutshof prägt die landwirtschaftlich strukturierte Gemeinde, deren Wappen auch heute noch identisch ist mit dem Siegelmotiv des Ritters Friedrich von Haseldorf aus dem Jahre 1255. Im ehemaligen Rinderstall des Gutshofes finden alljährlich vielbeachtete Konzerte des Schleswig-Holstein Musikfestivals statt. Das eingeschossige Herrenhaus entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts im klassizistischen Stil. Gemeinsam mit dem Kavaliershaus (Ende 18. Jhd.) und dem 1821 erbauten Marstall bildet das Hauptgebäude eine hufeisenförmige Anlage, die von dem frei zugänglichen Gutspark umgeben wird. Das Gut wird von der Prinzenfamilie von Schoenaich-Carolath-Schilden bewohnt. In dem Park mit seinem alten und vielfältigen Baumbestand sind noch der alte Graben und ein Wall der alten Burganlage zu sehen, auf die das heutige Anwesen zurückgeht. Die einstige Ritterburg war im Dreißigjährigen Krieg durch die Truppen Wallensteins zerstört worden. Am westlichen Eingang des Gutsparkes steht die Kirche St. Gabriel. Das Gotteshaus, das in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstand und noch im ursprünglichen Zustand erhalten blieb, gilt als bedeutendster spätromanischer Backsteinbau in den Elbmarschen. Der ältesten Einrichtungsgegenstände sind ein frühgotisches Triumphkreuz aus dem frühen 14. Jahrhundert und die bronzene Taufe von 1445. Auffällig ist die 1599 angebaute Gruftkapelle, die dem Gutherren Detlef von Ahlefeldt gewidmet ist. Dieser war im Verlauf einer Familienfede ermordet worden.
Gleich neben dem Schlosspark befindet sich das Elbmarschenhaus mit einer Ausstellung über die Natur- und Kulturlandschaft der Marschen. Am Hafen wurde vom Elbmarschenhaus ein 2 ha großer, frei zugänglicher Obstgarten mit insgesamt 180 verschiedenen Sorten angelegt. Zur Erntezeit können die Früchte hier auch gleich verkostet werden.
Von der alten Deichmühle ist nur noch ein Stumpf erhalten. Schon seit 1540 ist an dieser Stelle eine Windmühle nachweisbar. Das heutige Gebäude entstand Mitte des 19. Jahrhundert, diente seit dem Zweiten Weltkrieg aber nur noch zu Wohnzwecken. Gleich daneben war 1870 eine windunabhängige Dampfmühle erbaut worden, die 1929 mit einem Elektromotor ausgerüstet wurde. Diese Mühle ist auch heute noch im Betrieb.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Haseldorf führen:
Haselau
as bei Weitem älteste Gebäude des kleinen Dorfes in der Haseldorfer Marsch ist die Heilig-Dreikönigskirche. Der rote Backsteinbau wurde im frühen 13. Jahrhundert auf einer hochgelegenen Wurth erbaut, um gegen die drohenden Sturmfluten geschützt zu sein. Den 42 m hohen hölzernen Kirchturm kann man schon von Weitem erkennen. Die spätromanische Kirche besitzt mit einer so genannten Zuckerhutglocke die älteste Kirchenglocke im südlichen Schleswig-Holstein. Auf dem das Gotteshaus umgebenen Friedhof steht zudem die älteste Grabplatte des Kreises Pinneberg.
Der Gemeinde vorgelagert liegen zwischen der Haseldorfer Binnenelbe und dem Hauptstrom drei Elbinseln, wobei Auberg und Bishorster Sand im letzten Jahrhundert zu einem Eiland zusammengewachsen sind. Auch der südliche Teil der Insel Pagensand gehört zur Gemeinde Haselau. Die Elbinseln sind ein wichtiges und geschütztes Refugium für die Vogelwelt.
Im alten Feuerwehrgerätehaus und in der ehemaligen Durchfahrt der Gaststätte Wüstenberg befindet sich ein liebevoll eingerichtetes Heimatmuseum mit allerlei alten Gegenständen, Werkzeugen und landwirtschaftliches Geräten. Überregionale Bedeutung besitzt die Haselauer Hengststation, aus der eine Reihe von international berühmten Spitzenhengsten hervorgegangen sind.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Haselau führen:
Hetlingen
ls erstes Dorf hinter Hamburg liegt Hetlingen elbabwärts unmittelbar am Deich in den Elbmarschen. Hier queren zwei Stromleitungen (Elbekreuzung 1 und 2) den Strom. Da die Kabel wegen der enormen Länge stark durchhängen und die großen Schiffe genügend Platz zum Passieren haben müssen, sind die Masten mit einer Höhe von 227 m die höchsten in Europa. Das Wahrzeichen der im Jahre 1239 erstmals urkundlich erwähnten Dorfes ist die Schachblume, auch Kiebitzei oder Schachbrettblume genannt. Sie fand sogar Eingang im Gemeindewappen. 1672 hatte der dänische König Christian V. auf der damaligen Elbinsel Hetlinger Sand eine stark befestigte Verteidigungsanlage, die Hetlinger Schanze, errichten lassen – schließlich gehörte das Land vor den Toren Hamburgs einst zu Dänemark. Die Schanze wurde jedoch 100 Jahre später auf königlichen Befehl wieder abgetragen. Hetlingens Geschichte wurde sehr stark von Sturmfluten geprägt, die den Ort in unregelmäßigen Abständen immer wieder heimsuchten. Die letzte Naturkatastrophe hatte sich 1976 ereignet, als der alte Deich brach. Glücklicherweise waren keine Menschenopfer zu beklagen, aber die Natur brauchte Jahrzehnte, um sich wieder vollständig von der Überflutung zu erholen.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Hetlingen führen:
Wedel
ie maritim geprägte Rolandstadt an der Elbe gehört bereits dem Großraum Hamburg an. Hier dreht sich vieles ums Wasser. Die wohl bekannteste Attraktion ist die Begrüßungszeremonie für die dicken Ozeandampfer am Schulauer Fährhaus, dem ‚Willkomm Höft‘. Für jedes große Schiff über 1.000 BRT wird die Nationalflagge gehisst, die Nationalhymne gespielt und eine Begrüßung in der jeweiligen Landessprache ausgesprochen. Hier fährt zwischen Frühjahr und Herbst täglich der Hochgeschwindigkeitskatamaran ‚Holunder Jet‘ nach Helgoland ab. Darüber hinaus bestehen Verbindungen nach Blankenese, St. Pauli Landungsbrücken, Stadersand und nach Lühe auf der gegenüberliegenden Elbseite. Der Hamburger Yachthafen mit seinen rund 2.000 Liegeplätzen gehört zu den größten gezeitenunabhängigen Sportboothäfen Europas. Und auf dem Elbhöhenwandererg lassen sich die dicken Pötte auf dem Weg nach Hamburg noch lange beobachten. Eine weitere Attraktion ist das Theaterschiff Batavia am Brookdamm in der Wedeler Au. Das umgebaute ehemalige Flusskanonenboot war im späten 19. Jahrhundert vom Stapel gelaufen, und lag nach dem Zweiten Weltkrieg fast 10 Jahre lang auf Grund, bevor es wieder gehoben und restauriert wurde. Heute finden an und unter Deck Theater-, Kabarett- und Kinovorführungen sowie Livemusikveranstaltungen statt.
Das Wahrzeichen Wesels ist aber der Roland, der auch auf dem Stadtwappen abgebildet ist. Er wurde um 1450 als sichtbares Zeichen des hoheitlichen Schutzes der Marktgerechtigkeit aufgestellt. Die heutige Rolandfigur stammt aus dem 17. Jahrhundert.
Leider wurde ein wesentlicher Teil der Altstadt bei Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg zerstört, so dass nicht viele der historischen Gebäude erhalten blieben. Dafür besitzt die Stadt zwei interessante Museen. In den Räumen eines alten Schulhauses befindet sich das Stadtmuseum mit einer sozialgeschichtlichen und heimatkundlichen Dauerausstellung. Berühmtester Sohn der Stadt ist wohl Ernst Barlach (1870 – 1938). Der bedeutende Bildhauer, Graphiker und Literat, dessen Ausdruck sich zwischen Expressionismus und Realismus ansiedelt, wurde hier in Wedel geboren. Barlachs Geburtshaus ist heute als Künstlermuseum, das sich seinem umfangreichen Werk mit zahlreichen Skulpturen, Zeichnungen, Graphiken und Schriftstücken widmet, eingerichtet.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Wedel führen:
Hamburg-Blankenese
lankenese ist einer der ältesten Stadtteile Hamburgs. Hier, am westlichen Rande der Hansestadt, wohnen die Reichen und Schönen. Am Hang des Süllberges stehen über der Elbe eine stattliche Anzahl schöner Villen und stattlicher Kapitänshäuser. Viele dieser stolzen Anwesen, die einst Reedern und wohlhabenden Kaufleuten gehörten, sind heute in öffentlicher Hand. Aber nicht alle Villen sind einsehbar. So manches (privat gebutztes) Anwesen wirkt regelrecht abgeschottet – man möchte sich halt nicht auf die Terasse sehen lassen! In einer dieser Villen befindet sich heute das Puppenmuseum Falkenstein, das heute 300 Puppen ein neues Zuhause bietet. Das ehemalige Fischer- und Lotsendorf ist eine kleine Stadt für sich und pflegt seine Traditionen. Das Treppenviertel mit seinen kleinen Gassen, den verwinkelten Treppen und den historischen Fischerhäusern ist an schönen Tagen Ausflugsziel vieler Hamburger. Zum Radfahren eignet sich dieser Abschnitt allerdings weniger – streckenweise ist das Radeln hier auch verboten. Am östlichen Ende wird das Viertel vom Strandhotel – einem hübschen Jugendstilgebäude von 1902 – begrenzt. Als beliebtes Ziel dient der Leuchtturm und der Römische Garten am westlichen Ende von Blankenese.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Hamburg-Blankenese führen:
Hamburg-Altona
ie Geschichte des Hamburger Stadtteils Altona ist geprägt von der Rivalität zu Hamburg, denn Altona wurde erst 1938 im Zuge des Groß-Hamburg-Gesetzes eingemeindet. Zuvor war die Stadt eigenständig und gehörte einst lange Zeit zu Dänemark. Damals war Altona nach Kopenhagen die zweitgrößte dänische Stadt und die größte in Schleswig Holstein. Erst 1867 kam Schleswig-Holstein als Provinz zu Preußen und somit vier Jahre später zum Deutschen Reich. Als Altona schließlich im letzten Jahrhundert nach Hamburg eingemeindet wurde, erfuhren die meisten Bürger vom Verlust der Selbstständigkeit aus der Zeitung. Erst zu diesem Zeitpunkt endeten die jahrhundertlangen Streitigkeiten mit der Hansestadt, bei denen es um Nutzungsrechte auf der Elbe, um Münz- und Weiderechte oder um Glaubensfragen ging. Mit sechs Stadttoren hatte sich Altona vom ‚Hamburger Berg‘, dem heutigen St. Pauli, abgegrenzt. Der dänische König Friedrich III. hatte Altona 1664 die Stadtrechte mit weitreichenden Privilegien verliehen, die Hamburg freilich erst 1692 anerkannte. Nach einer Legende beruht auch der Name Altona auf einem Streit mit den Hansestädtern, denn ein Wirtshaus war nach Ansicht des Hamburger Rates ‚all to nah‘ (allzu nah) an der Grenze betrieben worden. Auch der bekannte Fischmarkt war als öffentlicher Markt den Hamburgern ein Dorn im Auge. Heute ist der Fischmarkt mit seiner alten Fischauktionshalle von 1896 eine Touristenattraktion. Das aufgeregte und bunte Treiben findet allsonntäglich jeweils zwischen 6:00 und 9:30 Uhr statt. Der 1722 angelegte Holzhafen ist das älteste erhaltene Hafenbecken Hamburgs. Genutzt wird er allerdings heute nicht mehr. Vom Stolz der einst selbstständigen Großstadt zeugen noch die barocke Hauptkirche St. Trinitatis, die 1742 erbaut und nach schweren Schäden im Zweiten Weltkrieg wieder rekonstruiert hergestellt wurde sowie das Rathaus. Der repräsentative Bau war 1898 ursprünglich als Bahnhof konzipiert worden. Heute beherrscht er den Platz der Republik in der Altonaer Altstadt. Der 1900 erschaffene Stuhlmannsbrunnen vor dem Rathaus symbolisiert mit seinem Wasserspiel treffend die anhaltende Konkurrenz mit der Nachbarstadt Hamburg: zwei Zentauren streiten sich um einen riesigen Fisch!
Am nördlichen Ufer der Norderelbe liegt der Museumshafen Oevelgönne. Hier fanden eine Vielzahl historischer Schiffe, Kutter, Barkassen, Fähren, Schlepper, Eisbrecher und Jachten einen neuen Liegeplatz. Der 1976 eingerichtete Museumshafen ist der älteste seiner Art in Deutschland und Vorbild für mehrere ähnlich ausgerichtete Häfen. Alle hier ausgestellten Schiffe und Boote sind noch schwimmfähig und fahrbereit. Der hier liegende Lühe-Ewer ‚Elfriede‘ gehört eigentlich als Außenstelle zum Altonaer Museum, dem zweiten sehenswerten Museum des Stadtbezirkes. Das Altonaer Museum beschäftigt sich mit der Kunst- und Kulturgeschichte des norddeutschen Raumes und dokumentiert die Entwicklung der Elbregion um Altona und der Küstengebiete von Nord- und Ostsee sowie die Geschichte Schleswig-Holsteins. Noch 2010 gab es Diskussionen über den Fortbestand dieser kulturellen Institution. Zuletzt schien aber der Erhalt des Museums gesichert.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Hamburg-Altona führen:
Hamburg-Harburg
er Hamburger Bezirk liegt im Südwesten der Hansestadt an der Süderelbe. Noch in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die beiden selbstständigen Städte Harburg an der Elbe und Wilhelmsburg zu einer Großstadt zusammengefügt. Der Staat Preußen wollte damals einen wirtschaftlichen Gegenpol zum mächtigen Hamburg schaffen. Doch 1937/38 wurde Harburg-Wilhelmsburg im Zuge des ‚Groß-Hamburg-Gesetzes‘ in die Hansestadt eingegliedert. Während Harburg einen eigenen Bezirk bildete, ging Wilhelmsburg im Bezirk Mitte auf. Doch Harburg besitzt auch heute noch seinen eigenen Stolz. Obwohl das Harburger Wappen keinen offiziellen Charakter besitzt, ziert es doch auch heute noch die Post der Bezirksversammlung. Das Bezirksamt hat seinen Sitz im alten Harburger Rathaus. Das 1889 im Stil der Neorenaissance errichtete Backsteingebäude zeugt vom Selbstverständnis der einstigen Stadt Harburg. Das älteste Bauwerk des Bezirkes ist das Harburger Schloss, von dem allerdings nur noch ein baulich stark veränderter Seitenflügel erhalten blieb, der so gar nicht mehr einer geschichtlichen Romantik entsprechen will. Dennoch geht das Kellergewölbe und Teile des Außenmauerwerkes noch auf das 14. Jahrhundert zurück. Hier, im Bereich des heutigen Binnenhafens, war der Entstehungskern Harburgs und hier haben sich auch noch einige alte Speichergebäude (z.B. der Palmspeicher), der Portalkran von 1972 (heute technisches Denkmal) und mehrere historische Brückenanlagen, wie die alte Klappbrücke und die Alte Harburger Elbbrücke, erhalten. Die 417 m lange Harburger Elbbrücke war 1899 von Kaiser Wilhelm II. eröffnet worden. Sie war als erste Süderelbbrücke für den Fahrzeugverkehr zugelassen, dient heute aber nur noch Radfahrern und Fußgängern. Das Bauwerk besteht aus mehreren Stahlbögen und zwei Sandsteinportalen, die an die alten Stadttore von Harburg und Wilhelmsburg erinnern sollen. Über den Torbögen prangen die alten Stadtwappen.
Mit der Sammlung Falckenberg besitzt Harburg eine der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst. Sie ist in einer alten Fabrikhalle untergebracht, wo neben der ständigen Sammlung des Kunstmäzens Harald Falckenberg auch Wechselausstellungen anderer großer Sammlungen präsentiert werden. Daneben zeigt auch der ‚Kunstverein Harburger Bahnhof‘ im Kulturbahnhof wechselnde Kunstausstellungen.
Eine weitere bedeutende Ausstellung präsentierte das Archäologische Museum Hamburg (Helms Museum). Neben seiner umfangreichen archäologischen Sammlung, die sich thematisch auf die norddeutsche Ur- und Frühgeschichte konzentriert, zeigt das Museum in seinem Haupthaus eine ständige Ausstellung zur Stadtgeschichte der Freien- und Hansestadt Hamburg.
Sehenswertes:
Radrouten die durch Hamburg-Harburg führen:
ElbeRadWeg: Abschnitt Nord
Radfernweg Hamburg-Bremen
Nordseeküstenradweg
Weener
inksseitig der Ems befindet sich mit Weener die einzige Stadt und damit der größte Ort des Rheiderlands. Das Rheiderland ist eine historische Landschaft zwischen Ems und Dollart beidseitig der Grenze zu den Niederlanden. Der Landstrich besteht zum überwiegenden Teil aus Marschlandschaften. Bis 1932 war Weener die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises, der mit dem Rheiderland weitgehend identisch war. Danach wurde der Landstrich dem Kreis Leer zugeordnet.
Nachweislich wurde auf dem heutigen Stadtgebiet von Weener bereits in der Steinzeit gesiedelt. Das Heimatmuseum Rheiderland zeigt Funde aus dieser Zeit. Weener selbst war zunächst ein Straßendorf, dem Anfang des 16. Jahrhunderts das Marktrecht verliehen wurde. Mit dem Bau des Hafens um 1570 wurde Weener zum wichtigen Handelsort. Doch während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Stadt mehrfach eingenommen, geplündert und schließlich fast vollständig niedergebrannt. So ist das Wappentier, der Phoenix, als Symbol für die Auferstehung der Stadt aus den Trümmern zu sehen.
Sehenswert ist das Organeum mit seiner Sammlung historischer Tasteninstrumente. Ansonsten kümmert man sich in dieser Einrichtung um die Orgellandschaft Ostfriesland, denn diese gehört zu den an Orgeln reichsten der Welt!
Sehenswertes:
In einer neugotischen Villa in Weener befindet sich das Organeum. Bei dieser Einrichtung handelt es sich nicht nur um ein Museum für Tasteninstrumente, sondern in erster Linie auch eine Kultur- und Bildungsanstalt. Ostfriesland gilt weltweit als eine der reichsten Orgellandschaften und das Organeum kümmert sich auch um die Erforschung und Erschließung dieses Kulturraumes. Darüber hinaus werden Orchesterveranstaltungen, Exkursionen, Kurse und Fortbildungen organisiert.
Das angeschlossene Museum zeigt eine bedeutende Sammlung historischer Tasteninstrumente, darunter Kabinettorgeln, Klaviere, Cembali und Clavichorde, und beschreibt deren spannende Geschichte.
Das Rheiderland ist eine historische Landschaft zwischen Ems und Dollart in Ostfriesland sowie der Provinz Groningen in den Niederlanden. Der Landstrich besteht zum überwiegenden Teil aus Marschlandschaften.
Im Jahre 1791 wurde in Weener das Armenhaus als offene Dreiflügelanlage erbaut. Heute befindet sich in dem Gebäude das Heimatmuseum Rheiderland. Es widmet sich der Geschichte des Rheiderlandes von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Landwirtschaft und dem Ziegelwesen. Als bedeutendstes Exponat gilt der aus dem 16. Jahrhundert stammende Altaraufsatz der Liudger-Kirche in Jemgum-Holtgaste.
Der historische Hafen in Weener wird heute nur noch als Freizeit- und Sporthafen genutzt. Als er um das Jahr 1570 angelegt wurde, diente er vor allem für den Umschlag verschiedenster Güter. Weener entwickelte sich in dieser Zeit zu einem wichtigen Handelsort an der Ems. Während der folgenden Jahrhunderte wurde der Hafen mehrfach umgebaut. Um das Hafenbecken herum wurden mehrere reizvolle mittelständige Bürgerhäuser und Speicher errichtet.
Um das Jahr 1930 wurde in Weenermoor das alte Spritzenhaus gebaut, das bis 1969 von der örtlichen Feuerwehr für ihren Löschzug genutzt wurde. Danach zog man in ein neues Feuerwehrhaus um, das ‚Oll Sprützenhus’ verfiel zusehends. In den 1990er Jahren wurde es abgerissen, gleich danach aber wieder neu aufgebaut. Seitdem beherbergt es ein kleines Feuerwehrmuseum.
Die Ursprünge der heutigen St. Georgs-Kirche reichen bis in die Zeit um das Jahr 900 zurück. Im Bereich des heutigen Friedhofes errichteten Mönche damals eine Holzkirche. Um 1230 wurde diese durch einen heute noch im Kern erhaltenen Backsteinbau ersetzt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Kirche mehrfach um- und ausgebaut. 1492 wurde das Gotteshaus durch den Bischof von Münster gebrandschatzt, sodass das gesamte Inventar verloren ging. Mit dem 1893 erbauten Querschiff erhielt die Kirche ihr heutiges Erscheinungsbild. Vorher ist im 16. Jahrhundert die Gemeinde mit der Kirche zum evangelisch-reformierten Glaubensbekenntnis gewechselt.
Die St. Georgs-Kirche besitzt eine bedeutende Schnittger-Orgel, die im Jahre 1710 durch Arp Schnittger und seinen Söhnen persönlich auf der Empore installiert wurde. Das Rokokogehäuse der Orgel wurde allerdings erst später im 18. Jahrhundert ergänzt.
Die Friesenbrücke ist mit 335 Metern eine der längsten Eisenbahnbrücken Deutschlands und führt bei Weener über die Ems. Sie besitzt ein Klappteil von 29 Metern, um größere Schiffe durchzulassen. Wenn aber eines der großen Kreuzfahrtschiffe von der Meyer Werft in Papenburg zur Nordsee überführt wird, muß der gesamte Mittelteil durch einen Schwimmkran entfernt werden. Zu bestimmten Zeiten kann die Brücke auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad überquert werden.
In Weener existieren noch zwei alte Holländer-Windmühlen. Die Mühle Wichers in Stapelmoor wurde erst 1909 erbaut und ist noch immer vollständig funktionstüchtig. Einige technische Teile der Mühlenanlage wurden von einer alten Bockwindmühle übernommen. Nach vorheriger Absprache mit den Besitzern ist die Mühle zu besichtigen.
Die zweite Windmühle befindet sich in Mühlenwarf und wurde 1899 errichtet. Sie kann nur von außen besichtigt werden.
Im Stadtteil Stapelmoor steht die wuchtig wirkende Kreuzkirche. Sie wurde im 13. Jahrhundert zur Zeit des Überganges von der Romanik in die Gotik erbaut und besitzt daher Merkmale beider Baustile. Das bereits 1429 errichtete Pfarrhaus gilt als das älteste bewohnte Pfarrhaus Deutschlands. Die Orgel des Gotteshauses ist ein bemerkenswerter Nachbau einer französischen Cliquote-Orgel aus dem 18. Jahrhundert.
Radrouten die durch Weener führen:
Leer
as ‚Tor Ostfrieslands’ liegt an der Mündung der Leda in die Ems und ist berühmt für seine wunderschöne und gut erhaltene Altstadt mit ihren prächtigen Bürgerhäusern, dem imposanten Rathaus und der Waage, die auf die historische Bedeutung als Handelszentrum hindeutet. Noch heute hat ein großes Handelsunternehmen, die Bünting-Gruppe, hier ihren Sitz. Darüber hinaus gehört Leer mit seinem gut ausgebauten Seehafen zu den wichtigsten deutschen Reederei-Standorten. Der Museumshafen, vier Burganlagen und eine Vielzahl von Museen laden zu einem längeren Aufenthalt ein.
Bereits vor 5000 Jahren war diese Gegend von germanischen Volksstämmen besiedelt, im Jahre 791 bereiste der berühmte Missionar Liudger die Gegend und gründete hier die erste ostfriesische Kapelle. Im ausgehenden 14. Jahrhundert wurde Leer durch den mächtigen germanischen Häuptling Focko Ukena zur Metropole, das Stadtrecht wurde dem Ort aber erst 1823 verliehen.
Sehenswertes:
Die gemütliche Innenstadt von Leer gilt als die schönste Altstadt in Ostfriesland. Neben zwei Burgen befinden sich hier zahlreiche Bürgerhäuser, die noch aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen. Ungefähr 600 Gebäude stehen heute unter Denkmalschutz. Ein besonderes Augenmerk verdient das Rathaus mit der benachbarten Waage. Das Rathaus wurde 1894 im Stil der Neorenaissance erbaut, die Waage bereits 1714 im Barockstil. Beide Gebäude lehnen sich an niederländische Vorbilder an. Die Stadtwaage war eine öffentliche Einrichtung zum Wiegen von Kaufmannsgütern. Da sich die Gewichtseinheiten von Stadt zu Stadt unterschieden, waren Kaufleute, die auf dem Markt Handel treiben wollten, verpflichtet, ihre Waren in der Stadtwaage wiegen zu lassen.
Der Seehafen Leers besitzt zwei Hafenbecken, dem Industriehafen, der Vorwiegend für den Güterumschlag genutzt wird und der Handelshafen. Durch die vorliegende Seeschleuse können Schiffe bis zu einer Länge von 140 Metern in den Hafen einfahren. Ein Teil des Handelshafens ist heute Museumshafen. Er liegt direkt hinter der Waage und ist über die Uferpromenade leicht zu finden. Der Schipperklottje, eine Abteilung des Heimatvereins, betreibt den frei zugänglichen Museumshafen. Einige Schiffe befinden sich in dessen Besitz, andere historische Klipper nutzen den Museumshafen als Dauerliegestätte. Alle Boote sind noch betriebsbereit. So besteht hier auch die Möglichkeit, auf einem Museumsschiff zu einem Törn auf der Ems aufzubrechen.
In jedem ungraden Jahr findet hier im Sommer das ‚Treffen Traditionsschiffe unner’d Rathuustoorn’ statt, bei dem rund 150 historische Schiffe in den Leeraner Hafen einlaufen.
Die Philippsburg wurde 1730 als Dreiflügelanlage im barocken Stil niederländischer Prägung fertig gestellt. Das Schloss war lange Eigentum der Familie von Wedel, die zu der Zeit auch das benachbarte Schloss Evenburg besaßen. Anfang des 20. Jahrhunderts führten umfangreiche Ausbauarbeiten zur Aufstockung der Seitenflügel, so dass die gesamte Philippsburg einheitlich zweistöckig wurde.
Noch heute befindet sich das Schloss im privaten Besitz. Ein Teil des Parkes ist inzwischen öffentlich zugänglich.
Im Stadtteil Loga nahe des Flusses Leda befindet sich das Wasserschloss Evenburg. Es wurde zwischen 1642 und 1650 errichtet. Der Bauherr Erhard Reichsfreiherr von Ehrentreuter von Hofrieth benannte es nach seiner Frau Eva. Mitte des 19. Jahrhunderts war das Bauwerk stark verfallen. Es wurde zum Teil abgebrochen und daraufhin im klassizistischen Stil niederländischer Prägung wieder auf- bzw. umgebaut.
Die Evenburg wird heute als Schulungsgebäude genutzt. Im Saal und in der Vorburg finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt. Das Schloss kann mit einer Führung besichtigt werden.
Am östlichen Rand der Innenstadt Leers, unweit der Ems, befindet sich der Plythenberg. Eigentlich gibt es in Ostfriesland keine Berge und auch diese Erhebung wurde, vermutlich im 15. Jahrhundert, nur künstlich aufgeschüttet. Der Plythenberg ist ungefähr 9 Meter hoch und besitzt einen Durchmesser von 64 Metern. Die Annahme, es handele sich um ein germanisches Häuptlingsgrab, wurde inzwischen widerlegt. Vielmehr diente der Hügel wohl als Aussichtspunkt für die Festung Leerort.
Als Nachfolgebau der ältesten Steinkirche Leers wurde die Große Kirche als repräsentatives Gotteshaus im Jahre 1787 eingeweiht. Der Barockbau ist die Hauptkirche der Evangelisch-Reformierten Kirche und zieht auch außerhalb der Gottesdienste viele Besucher an. Auffällig ist der mächtige Glockenturm von 1805, der im unteren Bereich auf quadratischem Grundriss steht, weiter oben aber eine achteckige Form annimmt. Die Innenausstattung ist nach der Tradition der Evangelisch-Reformierten Kirche eher schlicht gehalten. Viele Gegenstände der Inneneinrichtung, wie Kanzel und Orgel, wurden aus der Vorgängerkirche übernommen. Das romanische Taufbecken stammt als ältester Einrichtungsgegenstand aus der Zeit um 1200.
Die Vorgängerkirche wurde bis auf die Krypta abgetragen. Das Grabgewölbe wurde wegen der Totenruhe versiegelt und blieb bis heute erhalten.
Ursprünglich als Barockkirche im Jahre 1675 erbaut, veränderte die Lutherkirche durch mehrere Umbauten und Erweiterungen im 18. Jahrhundert ihr Erscheinungsbild zu einer Kreuzkirche. Bekannt ist die Kirche im Besonderen durch die imposante Orgel von Jürgen Ahrend. Die Kanzel stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert und ist damit der einzige Einrichtungsgegenstand, der älter als der Kirchenbau selber ist.
In zwei Handelshäusern aus dem 18. Jahrhundert wurde das Heimatmuseum eingerichtet. Neben der Geschichte der Stadt behandelt es schwerpunktmäßig die Ostfriesische Wohnkultur und die heimische Schifffahrt. Mehrere Wohnräume mit Inventar zeigen auf, wie sich das häusliche Leben in der Zeit um 1800 abgespielt hat. Das herausragende Exponat der Schifffahrtsabteilung ist die hölzerne Torfmuttje ‚Gretje’, das letzte Exemplar ihrer Art in Ostfriesland. Anhand von Modellen und Bildern wird die Geschichte der Schifffahrt, der Heeringsfischerei und der Reedereibetriebe in Leer plastisch beschrieben. Eine prähistorische Abteilung befindet sich im Gewölbekeller des historischen Gebäudes.
Inmitten der Altstadt von Leer befindet sich eine der ältesten noch erhaltenen Burganlagen Ostfrieslands. Erbaut wurde die Harderwykenburg noch unter dem Namen Unkenburg durch den Leeraner Häuptling Hajo Unken im Jahre 1421. Das ‚Hohe Haus’ war ein Wehrturmbau aus Backstein, der in erster Linie Speicherfunktionen hatte. Mit Ausnahme des Verteidigungsfalles wohnte der Häuptling zu dieser Zeit noch auf seinem Bauernhof. Erst im 17. Jahrhundert wurde die Burg zu einer Wohnburg umgestaltet und erweitert, bekam Giebel im Stile der Renaissance und wurde fortan Harderwykenburg genannt. Im Jahre 1788 übernahm Carl-Gustav zu Innhausen und Knyphausen das Anwesen. Bis heute blieb die Burg im Familienbesitz und ist daher nicht zu besichtigen. Der Park der Harderwykenburg hingegen ist öffentlich zugänglich.
In der Leeraner Altstadt befindet sich am Ende einer Kastanienallee die Haneburg. Sie wurde im Jahr 1570 als zunächst einflügliger Backsteinbau errichtet. Erst 1621 erfolgte der Ausbau zu einer Zweiflügelanlage im Stile der niederländisch geprägten Renaissance. Bei einem weiteren Umbau 50 Jahre später erhielt das Herrenhaus seine heutige Form. Die Burg wurde im letzten Jahrhundert als Bauernschule, Lazarett und Altersheim genutzt. In den 1970er Jahren wurde das bereits stark verfallene Gebäude aufwendig renoviert und dient heute der Volkshochschule. Von der historischen Inneneinrichtung ist aber nichts mehr erhalten. Zeitweilig finden in der Haneburg Ausstellungen statt. Die Außenanlagen sind öffentlich zugänglich.
Um ein riesiges Niederungsgebiet im Hinterland von Leer zu entwässern, wurde zwischen 1950 und 1954 das fast 100 m breite Ledasperrwerk erbaut. Zuvor waren die Flüsse Leda und Jümme nach starken Regenfällen so hoch angeschwollen, dass die Deiche das Umland vor den Wassermassen nicht mehr schützen konnten. Meistens ist das Ledasperrwerk geöffnet, um die natürlichen Gezeiten nicht zu beeinflussen. Zu einer Schließung der Hubtore kommt es erst bei stärker erhöhten Wasserständen.
Die Jann-Berghaus-Brücke ist mit 464 Metern Länge eine der größten Klappbrücken in Westeuropa. Das Klappteil alleine besitzt eine Länge von 63 Metern. Die Überführung führt westlich von Leer über die Ems und wurde im Jahr 1991 als Nachfolgebau einer Drehbrücke in Betrieb genommen. Benannt nach dem früheren Präsidenten der Ostfriesischen Landschaft, verbindet die Jann-Berghaus-Brücke die Leeraner Stadtteile Bingum und Leerort. Im Jahre 2009 wurde begonnen, die Pfeiler weiter nach außen zu verlegen, um die immer größer werdenden Kreuzfahrtschiffe von der Papenburger Meyer Werft zur Nordsee überführen zu können. So beträgt die neue Durchfahrbreite etwa 56 Meter.
‚Tee trinken’ ist in Ostfriesland ein Kulturgut. Was es alles Wissenswertes über Tee gibt, kann man im Teemuseum erfahren, vom Anbau über alle Produktionsstufen bis zu den Handelswegen. Besonders spannend sind die Geschichten über den Teeschmuggel. Begrüßt wird man im Museum mit einer Tasse originalem Ostfriesentee. Zu bewundern gibt es außerdem umfangreiches Teezubehör und historisches Tee-Porzellan.
Im Museum kann man sich auch für die Tee-Akademie anmelden: hier wird man in die Geheimnisse und die Besonderheiten der ostfriesischen Teezeremonie eingeführt.
Karl-Ludwig Böke gilt als der bedeutendste Künstler Leers im 20. Jahrhundert. Er lebte von 1927 bis 1996 und erlangte besonders im ostfriesischen Raum Popularität durch seine figürlichen Großplastiken. Seine Porträtbüsten machten ihn auch überregional bekannt. Böke probierte sich aber auch in der abstrakten Skulptur aus. Bekannt wurden seine Eisenkonstrukte und seine Steinräume. Zeit seines Lebens blieb er immer seiner Heimatstadt Leer treu. Zwei seiner Werke sind auch im öffentlichen Raum Leers zu finden: die ‚Teelke’, eine Frau mit Tasse und Teekanne, steht an der Ecke Brunnenstraße und Mühlenstraße. Das ‚Meerwiefke’ ist eine doppelschwänzige Nymphe im Skulpturengarten an der Neuen Straße.
Das Böke-Museum hat sich zur Aufgabe gemacht, das Werk Karl-Ludwig Bökes zu pflegen, zeitgenössische deutsche Kunst zu präsentieren und regionale ostfriesische Künstler zu fördern.
Das Haus ‚Samson’ in der Rathausstraße gilt als eines der schönsten Häuser der Stadt. Es wurde 1643 im Stil des Barock erbaut und beherbergt im Erdgeschoß eine Weinhandlung. Darüber befindet sich ein liebevoll eingerichtetes privates Museum, welches sich mit der ostfriesischen Wohnkultur beschäftigt.
Radrouten die durch Leer führen:
Jemgum
emgum ist eine Großgemeinde im nördlichen Rheiderland und besteht aus elf einst selbstständigen Dörfern, von denen die kleinsten noch heute eine lediglich zweistellige Einwohnerzahl ausweisen. Aber jedes Dorf besitzt seine alte und sehenswerte Kirche. Diese historischen Backsteinkirchen wurden auf Warften erbaut stammen zum großen Teil noch aus dem 13. Jahrhundert. Einige dienten als Wehrkirchen und einige Glockentürme wurden wohl auch als Leuchttürme genutzt.
Das Rheiderland ist eine Marschlandschaft und liegt westlich von der Ems. Im Norden wird sie vom Dollart begrenzt. So liegt dieser Landstrich mit der Gemeinde Jemgum verhältnismäßig isoliert. Bis zum heutigen Tage wird der Ort durch die Landwirtschaft und die Fischerei geprägt. Zwischenzeitlich spielte auch die Ziegelbrennerei einen nicht unwesentlichen Faktor.
Sehenswert ist das pittoreske Fischerdorf Ditzum mit seinem malerischen Hafen, den Kuttern, und dem historischen Siel, dessen Ursprünge im 12. Jahrhundert liegen und das immer noch der Entwässerung des Binnenlandes dient.
Sehenswertes:
Die ursprüngliche Jemgumer Kirche ging wohl auf einen Ausbau der ehemaligen Klosterkapelle des Johanniterordens aus dem 14. Jahrhundert zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Jemgumer Kirche auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes neu erbaut. Nachdem die Kirche 1930 fast vollständig niederbrannte, wurde sie im Stil des Art Déco umgehend wieder neu errichtet. Im Jahre 2004 brannte die Kirche erneut, wurde aber schnell wieder instand gesetzt.
Markant ist der leuchtturmartige Kirchturm, der zum Wahrzeichen der Gemeinde wurde. Seine offene Laterne wird mit einem Kupferdach abgeschlossen und von einem Segelschiff als Wetterfahne bekrönt. Der Innenraum wurde in den Farben Rot, Blau, Braun und Gold im Stil des Expressionismus gestaltet. Die Orgel stammt von Joseph William Walker und wurde 1844 erbaut.
Im Hauptort der gemeinde Jemgum steht eine alte, stolze Windmühle aus Backstein. Der Galerieholländer wurde bereits 1740 erbaut und 1756 nochmals erhöht. Damit gehört er zu den ältesten funktionstüchtigen Windmühlen in Ostfriesland. Mit dem Einsatz eines Dieselmotors im 20. Jahrhundert wurde die Mühle windunabhängig. Heute ist im Motorschuppen das Mühlencafé untergebracht. Die Windmühle wird seit 1995 vom Mühlenverein Jemgum betreut, der das historische Gebäude zu besonderen Anlässen der Öffentlichkeit zugänglich macht.
Die Midlumer Kirche wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ursprünglich im romanischen Baustil erbaut. Bei mehreren Umbauten wurden einige Fenster erst gotisch umgestaltet und später teilweise ganz zugemauert. Auffällig ist der dreistöckige Glockenturm, der wahrscheinlich bereits im 13. Jahrhundert so gestaltet wurde. Der 14 Meter hohe Turm besitzt Arkaden von unterschiedlicher Größe. Durch den wasserreichen Untergrund ist er wahrscheinlich schon früh in Schieflage geraten, so dass er durch zusätzliche Mauern gestützt werden musste. Mit einer Neigung von 6,7° wird er als der schiefste Glockenturm der Welt bezeichnet. Die imposante Orgel von Hinrich Just Müller wurde im Jahre 1766 erbaut und ist noch nahezu im originalen Zustand.
In der Umgebung von Jemgum gab es einst sehr viele Ziegeleien. Hier befand sich über drei Jahrhunderte das Zentrum der ostfriesischen Ziegeleiproduktion. Der Grund dafür liegt in den hohen Lehmvorkommen in dieser Region. Um die alte Tradition der Ziegelbrennerei zu vermitteln, wurde in der alten Ziegelei Cramer in Midlum ein Museum aufgebaut, das die Geschichte des Ziegelwesens und im Besonderen die der Ziegelei Cramer beschreibt. Das zentrale Ausstellungsstück ist der alte Ringofen im Brandhaus, der anschaulich die Produktion der Ziegelsteine dokumentiert.
Das kleine Dorf Critzum wurde kreisförmig um die heute evangelisch-reformierte Kirche und ihren Friedhof gebaut. Die Höfe führen sternförmig von dem im Mittelpunkt der Ortschaft stehenden Gotteshauses weg. Das Gebäude wurde im13. Jahrhundert auf einer Warft als rechteckige Saalkirche errichtet und gehörte ursprünglich zum Bistum Münster. Der Backsteinbau diente zunächst auch als Wehrkirche für örtliche Häuptlinge und ist noch heute von einem Wassergraben umgeben. Im 16. Jahrhundert wechselte die Kirchengemeinde zum evangelisch-reformierten Glaubensbekenntnis. Der Glockenturm war einst bedeutend höher als heute und hatte zwischenzeitlich wohl auch als Leuchtturm gedient.
In Hatzum befindet sich die St. Sebastiankirche. Die evangelisch-reformierte Kirche wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts zur Zeit des Überganges von der Romanik zur Gotik als Kreuzkirche erbaut und besitzt daher Merkmale beider Stilepochen. Im Laufe des 17. Jahrhunderts wurde bei einem Umbau das Querschiff zurückgebaut. Das Taufbecken der Kirche stammt noch aus dem 13. Jahrhundert und besteht aus Baumberger Sandstein. Bemerkenswert sind die Grabplatten im Inneren der St. Sebastiankirche, von denen die älteste noch aus dem Jahre 1505 stammt.
Oldendorp gehört zu den ältesten Ortschaften des Rheiderlandes. Eine erste urkundliche Erwähnung findet sich bereits um das Jahr 1000. Die Oldendorper Kirche ist ein typisches Beispiel für die Kirchenbauten in dieser Region. Sie wurde im 13. oder 14. Jahrhundert als rechteckige Saalkirche auf einer Warf errichtet. Der rote Backsteinbau wurde im romanisch-gotischen Übergangsstil erbaut und besitzt daher Elemente beider Stile. Das romanische Nordportal wurde wieder zugemauert. Ursprünglich gehörte die Oldendorper Kirche zum Bistum Münster, aber in der Zeit der Reformation wechselte die Kirchengemeinde zum evangelisch-reformierten Bekenntnis über. Das Bauwerk unterlag in ihrer Geschichte mehreren Umbauten. Die Orgel auf der Ostempore stammt von den Gebrüdern Rohlfs und wurde 1870 erbaut.
Das pittoreske Fischerdorf Ditzum im nördlichen Rheiderland liegt am Südufer der Ems nahe dem Dollart. Es wurde bereits im 8. Jahrhundert auf einer Warft erbaut. Geprägt wurde Ditzum seit Jahrhunderten durch die Fischerei und seinen malerischen Hafen. Noch heute haben einige Fischkutter hier ihren Liegeplatz. Lange Zeit, bis in das 19. Jahrhundert hinein, hatte der Ditzumer Hafen auch als Umschlagplatz für Handelswaren große Bedeutung. Neben dem Hafen befindet sich im Zentrum des Ortes ein großes Siel. Es teilt Ditzum in zwei Hälften. Bedingt durch den Deichbau im 12. Jahrhundert musste das Hinterland durch Siele entwässert werden. So entstand in Ditzum das erste Siel. Das heutige Siel wurde 1891 neu auf den Resten des ersten steinernen Siels von 1752 erbaut. In den Jahren 1985 und 86 fand noch einmal eine Vergrößerung der Anlage statt. Sie dient auch heute noch der Entwässerung des Binnenlandes.
Bereits seit 600 Jahren besteht zwischen dem ehemals selbstständigen Fischerdorf Ditzum und Pelkum, ein Stadtteil von Emden, eine Fährverbindung über die Ems. Anfänglich hatten nur Pelkumer Häuptlinge das Recht, die Fähre zu betreiben. Im 18. Jahrhundert ging das Fährrecht auf das Kirchspiel Ditzum über. Heute ist die Fährverbindung Ditzum – Petkum die einzig verbliebene über die Unterems in Niedersachsen. Die Überfahrt mit dem bereits 1926 auf der Meyer Werft in Papenburg erbauten Fährschiff dauert ungefähr 20 Minuten. Im Sommer verkehrt die Fähre – außer zur Mittagszeit – im Stundentakt, im Winter gibt es einen eingeschränkten Fährbetrieb.
Das Dorf Ditzum wird von seiner Kirche und seiner dreistöckigen Windmühle geprägt. Der Galerieholländer hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Eine erste, 1769 errichtete Mühle brannte ab und wurde 1883 wieder aufgebaut. Nach einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg brannte auch diese Mühle nieder, so dass sie nach dem Krieg erneut aufgebaut werden musste. Heute betreibt der Mühlenverein Ditzum die Holländermühle. Während der Öffnungszeiten betreiben die Landfrauen eine Stöberstube mit selbst erzeugten Produkten.
Die Backsteinkirche in Ditzum wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, möglicherweise sogar bereits Ende des 12. Jahrhunderts erbaut. Der Bau entstand als einschiffige Saalkirche auf einer Warft und gehörte zunächst zum Bistum Münster. In der Zeit der Reformation wechselte die Kirchengemeinde zunächst zum lutherischen, wenig später dann zum evangelisch-reformierten Bekenntnis. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Ditzumer Kirche mehrfach umgestaltet, zugemauerte Portale und Rundbögen zeugen noch heute von diesen Umbauten.
Der Innenraum besitzt ein hölzernes Tonnengewölbe. Der Abendmahltisch und die Kanzel stammen noch aus dem 17. Jahrhundert, einige Grabplatten sogar noch aus romanischer Zeit.
Die Liudgerkirche in Jemgum-Holtgaste gilt als die älteste in dem an Kirchen reichen Rheiderland. Ein erstes Gotteshaus aus Holz wurde um das Jahr 820 erbaut und unterstand dem Kloster Werden. Das heute noch erhaltene Kirchengebäude stammt aus dem 13. Jahrhundert. 1284 wurde die Liudgerkirche an die Johanniterkommende weitergegeben. Während der Reformationszeit wurde die Holtgaster Kirchengemeinde lutherisch. In der Folgezeit fanden mehrere Umbauten statt – die letzte im Jahre 1855. Die Liudgerkirche besitzt, wie häufig in Ostfriesland, einen separaten Glockenturm und einen alten Schnitzaltar von 1520. Die originale Orgel von Arnold Rohlfs stammt noch aus dem Jahr 1865 und blieb bis heute unverändert erhalten.
Radrouten die durch Jemgum führen:
Emden
ie größte Stadt Ostfrieslands ist eine Stadt des Wassers. Rund 150 Kilometer Kanäle fließen durch das Stadtgebiet. Teile des Kanalsystems gehörten zu den mittelalterlichen Befestigungsanlagen, während der Ems-Seitenkanal und der Ems-Jade-Kanal allein für die Schifffahrt angelegt wurden. Die Seehafenstadt liegt am nördlichen Rand des Mündungsgebietes der Ems in den Dollart und wird wesentlich durch seinen Hafen geprägt.
Bereits um das Jahr 800 entstand hier eine Handelssiedlung, im 14. Jahrhundert jedoch gab es wegen der Unterstützung des Seeräubers Klaus Störtebeker einen lang anhaltenden Konflikt mit der Hanse. Heute ist Emden kreisfreie Stadt und bekannt durch ihre berühmten Komiker Otto Waalkes und Karl Dall, sowie durch den ehemaligen Chefredakteur des Stern, Henri Nannen, der die Kunsthalle stiftete. Wahrzeichen der Stadt sind das Rathaus und das Emder Hafentor, sehenswert sind aber auch die Museumsschiffe im Ratsdelft.
Sehenswertes:
Das Emder Rathaus wurde ursprünglich in den Jahren 1574-76 durch den niederländischen Baumeister Laurens van Steenwinckel erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde es fast vollständig zerstört und bis 1962 nach altem Vorbild wieder aufgebaut.
Das Ostfriesische Landesmuseum wurde bereits 1833 eröffnet und ist damit das älteste Museum Ostfrieslands. Unter dem Namen ‚Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden’ wurden Kunst- und Kulturschätze aus privaten Beständen gezeigt. Fast der gesamte Bestand konnte im Zweiten Weltkrieg durch Auslagerung gerettet werden. Zusammen mit Beständen der Stadt Emden wurde das Ostfriesische Landesmuseum im wieder aufgebauten Rathaus neu eröffnet. Dabei handelt es sich um eine der bedeutendsten kulturellen Einrichtungen der gesamten Region. Mit den Schwerpunkten Emden/Friesland/Europa behandelt es die Geschichte des friesischen Küstenraums und der Stadt Emden im europäischen Zusammenhang. Sehenswert ist die Gemäldesammlung mit Werken niederländischer Künstler aus dem 17. Jahrhundert, die Skulpturensammlung, die Silberabteilung sowie das Münzkabinett.
Eine besondere Aufmerksamkeit aber verdient die Rüstkammer. Hier wird eine bedeutende Sammlung von Harnischen, Schutzschilden sowie Hieb- und Stichwaffen der frühen Neuzeit präsentiert. Die Utensilien dienten im 15. und 16. Jahrhundert der Emder Bürgerwehr.
Vom Museum aus ist auch der Aufstieg auf den Rathausturm möglich, von dem man einen weiten Blick über die Stadt genießen kann.
Die Kunsthalle Emden ist das herausragende Kunstmuseum Ostfrieslands. Sie wurde 1986 vom damaligen Chefredakteur und Herausgeber vom ‚Stern’ gestiftet und gilt als dessen Lebenswerk. Fast sein gesamtes Vermögen und seine Kunstsammlung, die aus bedeutenden Werken des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit besteht, flossen in diese Stiftung. Später kamen mit der Sammlung Otto van de Loo weitere großartige Werke hinzu, die eine Erweiterung des Museums notwendig machten.
Neben der ständigen Ausstellung werden auch immer wieder zum Teil sehr erfolgreiche Wechselausstellungen gezeigt. Die Kunsthalle Emden ist Mitglied im ‚Arbeitskreis selbstständiger Kultur-Institute’.
In der umgebauten Ruine des Großen Kirche befindet sich heute eine der bedeutendsten Bibliotheken Deutschlands. Sie wurde 1995 eröffnet und basiert auf dem Archiv der seit 1559 bestehenden Büchersammlung der reformierten Gemeinde Emden. Namensgeber war der polnische Theologe und Reformer Johannes a Lasco. Die Spezialbibliothek ist öffentlich zugänglich und behandelt den Schwerpunkt reformierter Protestantismus. In diesem Zusammenhang ist sie auch eine wichtige Stätte der Forschung.
Die Bibliothek wird auch als Ort für kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte, Vorträge und Ausstellungen genutzt.
Otto Waalkes ist der wohl berühmteste Komiker Deutschlands und der bekannteste Emder. Ihm zu Ehren wurde in seiner Heimatstadt bereits 1986 ein Museum eröffnet. Im Otto Huus erfährt man alles über seinen Werdegang, kann Requisiten aus seinen Filmen und seine berühmten Ottifanten bestaunen. In einem Kino werden Ausschnitte aus seinen Programmen und Spielfilmen gezeigt.
Direkt hinter dem barocken Hafentor unweit des Rathauses befindet sich der Ratsdelft, ein Teil des Emder Hafens. An der Mündung der Ehe in die Ems hatte sich hier seit dem Jahre 800 der Hafen zu einem wichtigen Umschlagplatz und Handelszentrum entwickelt. Ein Großteil des Delfts wurde allerdings wieder zugeschüttet und zum Stadtgarten umgestaltet. Vom Ratdelft aus kann man zu einer Hafenrundfahrt starten und hier befindet sich auch das Schifffahrtsmuseum mit seinen drei Museumsschiffen.
Museums-Feuerschiff ‘Amrumbank/Deutsche Bucht’
Das Feuerschiff ‘Amrumbank/Deutsche Bucht’ wurde 1915 auf der Meyer Werft in Papenburg gebaut und versah zwischen 1917 und 1983 seinen Dienst als schwimmender Leuchtturm an verschiedenen Positionen auf der Nordsee. Es beherbergt heute ein Restaurant sowie eine Ausstellung über historische Seezeichen.
Seenotrettungskreuzer ‘Georg Breusing’
Im Jahre 1963 wurde der Seenotrettungskreuzer ‘Georg Breusing’ in Bremen-Vegesack getauft. Es wurde in Borkum stationiert und half bis 1988 über 1600 Menschen aus Seenot. Das ehemalige Schiff der ‚Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger’ ist noch immer betriebsbereit und verlässt zu besonderen Anlässen seinen heutigen Liegeplatz am Ratdelft.
Heringslogger ‚AE7 Stadt Emden’
Die bewegteste Geschichte der drei Museumsschiffe am Ratsdelft besitzt der Heringslogger ‚AE7 Stadt Emden’. Er wurde 1908 im niederländischen Scheveningen gebaut und dort auch bis 1931 für den Heringsfang eingesetzt. Danach wurde er nach Norwegen überführt und für den Transport von Zement eingesetzt. Ende der 1980er Jahre wurde das Schiff nach alten Plänen wieder in den Originalzustand zurückgebaut und nahm seine letzte Liegestätte in Emden ein. Die Kajüten der Mannschaft und des Kapitäns vermitteln einen Einblick in das Leben auf See. Ein alter Schwarz-Weiß-Film dokumentiert den Arbeitsalltag der Heringsfischer.
Von den einstigen prächtigen Stadttoren aus dem 17. Jahrhundert blieb nach dem Krieg nur das Hafentor erhalten. Es wurde 1635 erbaut und in der Zwischenzeit mehrfach restauriert. Heute ist es ein Wahrzeichen der Stadt. Es führt direkt zum historischen Hafen hinaus am Ratsdelft entlang zum Alten Markt. Das Hafentor wird von einem barocken Giebel kunstvoll bekrönt. Auf seinem Rundbogen steht der fromme Sinnspruch: ‚Et pons est Embdae et portus et aura deus’ (Gott ist für Emden Brücke, Hafen und Segelwind).
Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Altstadt Emdens durch Bombadierungen fast vollständig zerstört. Nur zwei Häuser in der Pelzerstraße blieben erhalten. Sie vermitteln einen Eindruck, wie die Altstadt Emdens vor dem Krieg ausgesehen hat, wobei nur das eine Haus aus dem 16. Jahrhundert stammt. Das andere wurde 1909 unter Verwendung der alten Ziegeln nach dem Vorbild des Vorgängerbaus neu errichtet.
In den Pelzerhäusern befindet sich eine Außenstelle des Ostfriesischen Landesmuseums. Hier finden Wechselausstellungen zu verschiedenen Themen statt.
Im Südosten der Stadt Emden befindet sich ein technisches Bauwerk, das in seiner Form einzigartig in Europa ist. Die Kesselschleuse ist das Verbindungsglied für gleich vier Wasserstraßen: den Ems-Jade-Kanal, den Emder Stadtgraben, das Fehntjer Tief und das Rote Siel. Da alle Kanäle zumeist verschiedene Wasserstände aufweisen, wurde hier eine Schleuse geschaffen, die eine zentrale Kammer, den Kessel, und vier Seitenkammern besitzt. So können die einfahrenden Schiffe zu jeder Wasserstraße abbiegen. Darüber hinaus dient die Kesselschleuse aber auch der Entwässerung des Ems-Jade-Kanals.
Erbaut wurde die Schleuse mit zwei Kammern bereits 1887. Der Ausbau zum heutigen System erfolgte 1913 und in den 1980er Jahren wurde sie noch einmal grundsaniert. Heute dient die unter Denkmalschutz stehende Kesselschleuse allerdings kaum mehr dem Gütertransport, sondern überwiegend der Sportschifffahrt.
Im Emder Stadtteil Borssum befindet sich auf dem Gelände eines ehemaligen Klärwerkes ein Informationszentrum zum Thema Natur und Umwelt. Das Gelände wird von einer solarbetriebenen Kleinbahn durchfahren und bietet Einblicke in den Obst- und Gemüseanbau, naturnahe Gartengestaltung und umweltfreundliche Energienutzung. Vom Aussterben bedrohte Haustierrassen, wie Moor- und Heidschnucken oder Emder Gänse bevölkern die weitläufige Parkanlage.
Als im Zweiten Weltkrieg ab 1940 die allierten Bomberstaffeln nach Deutschland einflogen, lag Emden direkt an der Haupeinflugsroute. So wurde die Innenstadt fast vollständig zerstört. Zum Schutz der Bevölkerung wurden deshalb mit Hilfe von Zwangsarbeitern viele Luftschutzbunker erbaut, von denen bis heute noch 31 erhalten sind. In einem dieser Bunker an der Holzsägerstraße wurde ein Museum eröffnet, welches die Kriegszeit, das Leben während der Zeit des Nationalsozialismus und den Wiederaufbau Emdens dokumentiert. Dabei stellt sich die Einrichtung der Aufgabe, eine Begegnungsstätte für den Frieden und wider den Schrecken des Krieg und des Vergessen zu sein.
Eine reizvolles Einrichtung ist das Maritime Museum ‚Freunde der Seefahrt’. Es wird ehrenamtlichen von Vereinsmitgliedern, die zum Teil auch selber zur See gefahren sind, geführt und zeigt Exponate rund um das Thema ‚Seefahrt’. Gezeigt werden ein Sammelsurium von historischen Bildern und Unterlagen, Modellen und alte Schiffsglocken. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den ehemaligen Reedereien der Seehafenstadt Emden. Bei einer Tasse Tee kann man hier einen Klönschnack mit einem alten Seebären haben und sich aus erster Hand über das Thema Seefahrt informieren.
Auf dem Emder Stadtwall befinden sich noch die Reste mehrerer alter Windmühlen. Allerdings besitzt nur noch eine von ihnen heute Flügel: die über 200 Jahre alte Mühle ‚De Vrouw Johanna’. Der dreistöckige Galerieholländer wurde 1804/05 aus Ziegelsteinen erbaut. Er besitzt einen Steert anstatt einer Windrose sowie im Erdgeschoss eine Durchfahrt. Nachdem der Mühlenbetrieb eingestellt worden war, diente das Gebäude zusammen mit dem Müllerhaus zwischenzeitlich einem Holzhandel, ehe es von der Stadt Emden übernommen wurde. Eine erste Renovierung wurde 1982 abgeschlossen. Im Jahre 1997 wurde ein Brandanschlag auf die Mühle verübt, der erheblichen Schaden anrichtete. Ein Jahr später erhielt ‚De Vrouw Johanna’ ihre reetgedeckte Mühlenkappe wieder und erstrahlt heute stolz und erhaben im alten Glanz.
Heute wird in der Mühle in unregelmäßigen Abständen wieder Korn gemahlen. Dann drehen sich die großen Flügel auch wieder im Wind. Nach vorheriger Absprache mit dem Emder Mühlenverein e.V., der die ‚Vrouw’ betreut, kann das Gebäude auch besichtigt werden.
Radrouten die durch Emden führen:
Norden
orden, die älteste Stadt Ostfrieslands, wird von der Landwirtschaft und vom Tourismus geprägt. Trefflich wählte die Stadt für sich den Slogan ‚Das grüne Tor zum Meer’. An dem Fährhafen von Norden-Norddeich starten Fähren zu den der Küste vorgelagerten Inseln Norderney und Juist. Die Ortsteile Norddeich und Westermarsch II sind seit 2010 Nordseeheilbäder. Norden selber wurde im Jahr 1235 erstmals urkundlich erwähnt und entwickelte sich als regionaler Marktort. Sehenswert ist der ‚größte Marktplatz Europas’ mit dem alten Rathaus, der romanisch-gotischen Ludgerikirche, der Mennonitenkirche und zahlreichen weiteren historischen Gebäuden, die zum Teil noch aus der Renaissance stammen. Darüber hinaus bietet die ‚Stadt hinterm Deich’ eine vielfältige und interessante Museumslandschaft.
Sehenswertes:
Im Zentrum der Stadt Norden befindet sich der über 6,5 ha große Marktplatz, liebevoll auch der ‚größte Marktplatz Europas’ genannt. Über 250 alte Bäume stehen auf diesem Platz, der eigentlich eher eine schöne Parkanlage darstellt, und der von zahlreichen historischen Gebäuden eingerahmt wird.
Die dreischiffige Ludgerikirche wurde zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert in mehreren Bauabschnitten errichtet. In ihr befindet sich das Grabmal des Häuptlings Unico Manninga. Die Arp-Schnitger-Orgel ist wegen ihres außergewöhnlichen Klanges überregional berühmt.
Das alte Rathaus an der Westseite des Marktplatzes ist ein prächtiger Renaissancebau aus dem Jahre 1539. Das außergewöhnlich gut erhaltene Kellergewölbe stammt sogar noch aus dem 13. Jahrhundert. Hier befinden sich heute das Teemuseum und das Heimatmuseum der Stadt.
Das ehemalige Kettler’sche Haus wurde 1662 als Patrizierhaus errichtet und 1795 zu einer heute noch existierenden Mennonitenkirche umgebaut.
Um 1600 entstanden an der Südseite des Marktplatzes drei Renaissance-Backsteingebäude mit sehr ähnlichen Fassaden, die so genannten ‚Dree Süsters (Drei Schwestern). Das rechte Gebäude dieses wunderschönen Ensembles wurde allerdings erst 1991 originalgetreu wiederhergestellt, nachdem das ursprüngliche Haus Anfang der 1960er Jahre abgerissen worden war.
Das Haus ‚Markt 46’ wurde bereits um 1500 im spätgotischen Stil errichtet, 1680 aber noch einmal umgestaltet. Aus dem 16. Jahrhundert stammt auch das Haus ‚Markt 66’. Es wurde allerdings später in den klassizistischen Stil umgestaltet.
Das Vossenhus (Fuchshaus) an der Ostseite des Marktplatzes beherbergt heute die Stadtbibliothek. Im heutigen Hotel zur Post war früher die Posthalterei untergebracht. Das Polizeikommissariat stammt noch aus dem Jahre 1610.
Im Zentrum der Stadt Norden befindet sich auf dem Marktplatz die mächtige dreischiffige Ludgerikirche. Das größte erhaltene ostfriesische Kirchengebäude wurde zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert in mehreren Bauabschnitten errichtet. Da diese Bauphasen in die Übergangszeit der Romanik in die Gotik fielen, sind auch beide Baustile in der Architektur noch erkennbar. Das Langhaus zeigt noch deutliche romanische Elemente, während das Querhaus und der Chor gotisch geprägt sind. Der Glockenturm aus dem 14. Jahrhundert steht etwas abseits auf der anderen Straßenseite.
Im Zuge der Reformation wurde die Ludgerikirche 1527 evangelisch. Vier Jahre später, nach der Zerstörung der Andreaskirche, wurde sie auch Stadtkirche. Der überwiegende Teil der Gemälde fiel im 16. Jahrhundert dem Bildersturm zum Opfer. Trotzdem besitzt die Ludgerikirche eine besonders reichhaltige und bedeutende Innenausstattung. Die barocke Kanzel mit ihrem reichen Schnitzwerk ist aus dem Jahre 1712. Ende des 16. Jahrhunderts wurde der ‚Fürstenstuhl’, eine Empore im Übergangsbereich zwischen Chor und Querschiff, gebaut. Das Grabmal mit der lebensgroßen Marmorfigur des 1588 verstorbenen Häuptlings Unico Manninga wurde erst 1678 an dieser Stelle errichtet. Der älteste Gegenstand der Ausstattung ist der Taufstein aus Bentheimer Sandstein. Er wird auf das frühe 14. Jahrhundert datiert. Aus Baumberger Sandstein wurde das spätgotische Sakramentshaus in Form eines gotischen Turmes erschaffen. Der spätgotische Hochaltar, der später zum Schriftaltar umgestaltet wurde, stammt wie das Sakramentshaus aus dem 15. Jahrhundert. Eine besondere Beachtung verdient die Orgel. Sie stammt von dem berühmten Orgelbaumeister Arp Schnitger. Das Instrument gilt als die größte Orgel Ostfrieslands. Erbaut wurde sie in den Jahren 1686 bis 88, 1692 wurde sie noch einmal erweitert. Es gibt in Deutschland nur noch eine größere erhaltene Schnitger-Orgel. Ihr außergewöhnlicher Klang hat die Orgel überregional bekannt gemacht.
Zu den interessantesten Gebäuden der Stadt Norden gehört das 1662 erbaute ehemalige Kettler’sche Haus. Dieses stolze Gebäude wurde 1795 von der Mennonitengemeinde übernommen, die das Innere des Patrizierhauses nach ihren Bedürfnissen und im Stil des Rokoko umgestaltete. Besonders sehenswert ist das Deckengemälde, das allerdings erst im Jahr 1900 entstand.
Die Mennonitengemeinde ist eine christliche Freikirche, die sich aus der Täuferbewegung entwickelte. Ihr kulturelles Zentrum befand sich lange Zeit in Emden. Heute besitzt die Gemeinde in Norden, die zu den ältesten Mennonitengemeinden in Ostfriesland gehört, noch ungefähr 50 Glieder. Gottesdienste finden jeden vierten Sonntag im Monat um 10:00 Uhr statt.
Das historische Rathaus im Zentrum von Norden ist ein prächtiger Renaissancebau aus dem Jahre 1539. Der Gewölbekeller stammt noch aus dem 13. Jahrhundert und ist noch bemerkenswert gut erhalten. Das alte Rathaus beherbergt heute das Ostfriesische Teemuseum.
Das Trinken von Tee gilt in Ostfriesland als Kulturgut. Tee ist das Nationalgetränk. Im Ostfriesischen Teemuseum erfährt man Wissenswertes über den Anbau, die Ernte und die Verarbeitung von Tee. Eine umfassende Sammlung von Porzellan und Keramik rundet die Ausstellung ab. In der Teeküche kann man den berühmten Ostfriesentee verkosten und hier werden auch Ostfriesische Teezeremonien veranstaltet. Denn eine Teezeit bedeutet auch, sich zu entspannen und gemeinsam einen Klönschnack zu halten.
Dem Teemuseum ist auch ein Heimatmuseum angeschlossen. Hier wird eine Ausstellung zur Stadt- und Industriegeschichte präsentiert. Dabei wird insbesondere auf die Entwicklung der Brennerei ‚Doornkaat’ und der ‚Norder Eisenhütte’ eingegangen.
In der Osterstraße, nicht weit entfernt vom Marktplatz, fällt sofort ein prächtiges Haus auf. Das Schöningsche Haus ist das am reichsten verzierte Renaissance-Patrizierhaus in ganz Ostfriesland. Es wurde 1576 erbaut und fällt durch seine aus den Niederlanden stammende Specklagenbauweise auf. Bei dieser Technik wurden abwechselnd horizontale Lagen aus rotem Backstein und hellen Sandstein genutzt.
In einem Lokschuppen sowie dem dazugehörigen Außengelände präsentiert der Verein Museumseisenbahn ‚Küstenbahn Ostfriesland e.V.’ eine ansehnliche Sammlung historischer Eisenbahnen und Waggons sowie Gerätschaften, die im Zusammenhang mit dem geschichtlichen Bahnbetrieb stehen. So ist auf dem Gelände auch das 1954 außer Dienst genommene Stellwerk ‚Norden Mitte’ zu sehen, das hier wieder neu aufgebaut wurde.
Eine besondere Bummelfahrt kann man in den Sommermonaten erleben. Vom Bahnhof Norden werden auf der alten, stillgelegten Küstenbahn Ostfriesland Museumsfahrten in historischen Waggons durchgeführt. Die 16 Kilometer lange Fahrt führt von Norden über Hage, Westerende, Dornum und wieder zurück. Die Abfahrzeiten werden auf der Internetseite bekannt gegeben.
Jedes Jahr werden im niedersächsischen Wattenmeer 30 bis 90 kleine Seehunde und Kegelrobben gefunden, die zuvor von der Mutter getrennt wurden. In der Seehundstation werden diese süßen ‚Heuler’, so wie die jungen Seehunde heißen, aufgezogen und auf ihr Leben in der Nordsee vorbereitet. Wenn sie groß sind, werden sie wieder in die freie Natur entlassen. In der Seehundstation kann man die kleinen Seehunde und Robben bei der Fütterung beobachten und die Ausstellung besuchen, die das Leben dieser Tiere dokumentiert.
Das Waloseum ist ein Wal-Erlebniscenter. Die interaktive Ausstellung rund um ein riesiges Pottwalskelett beantwortet viele Fragen rund um den Meeressäuger. Hier erfährt man, wie Walgesänge klingen, was für Wanderwege Wale einschlagen und wie ihr Tauchverhalten ist.
In einem 1781 erbauten unter Denkmalsschutz stehenden historischen Bürgerhaus befindet sich das ‚Haus des Bundes ostfriesischer Baumeister e.V.’. Das Gebäude beherbergt eine Ausstellung zur Norder Stadt- und Baugeschichte, das 1. Teekontor der Firma Onno Behrens aus dem Jahre 1888 sowie das Sportmuseum, welches eine Ausstellung über den Norder Sport präsentiert.
In unmittelbarer Nähe der Deichmühle am Südrand der Stadt befindet sich die Frisia-Mühle, auch Weerdasche Mühle genannt. Der vierstöckige Gallerieholländer wurde ursprünglich 1855 errichtet, brannte allerdings 1864 vollständig ab und wurde daraufhin wieder neu aufgebaut. Die Windmühle erhielt 1930 einen Motor, damit der Mahlbetrieb auch bei Windstille fortgesetzt werden konnte. Nach einer umfassenden Sanierung in den 1980er Jahren wurde die Windmühle 1993 wieder in Betrieb genommen. Heute beherbergt die fast 30 Meter hohe Mühle einen Kunsthandwerkerladen, das Muschel- und Schneckenmuseum, eine Ausstellung über die Geschichte der Mühle sowie eine Galerie.
Das Muschel- und Schneckenmuseum im zweiten Stock der Windmühle ist ein kleines privates Museum, das aus einer privaten Sammelleidenschaft entstand. Inzwischen werden in der 1994 eröffneten Ausstellung über 1000 verschiedene Muschel- und Schneckenexemplare gezeigt.
Am westlichen Ortsausgang von Norden befindet sich die Westgaster Mühle. Der 27 Meter hohe Galerieholländer wurde 1863 erbaut und beherbergt heute eine Ausstellung mit historischen landwirtschaftlichen Geräten, Werkzeugen und Haushaltsgegenständen. Im Müllerhaus befindet sich ein Café.
Im Norder Ortsteil Tidofeld wurde eine einzigartige Gedenkstätte eröffne, die sich mit dem Thema ‚Flucht und Vertreibung auseinandersetzt. Zentrales Gebäude dieser ‚Dokumentationsstätte zur Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen in Niedersachsen und Nordwestdeutschland’ ist die 1961 erbaute Gnadenkirche.
Auf dem Gelände der Kirche befand sich in den 1930er Jahren ein Ausbildungslager für Marinesoldaten. Das Lager diente nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlingslager für die Vertriebenen aus den Ostgebieten. Durchschnittlich lebten bis 1960 hier 1.200 Menschen. Seit dem Jahre 1949 war in einer Baracke eine ökumenische Kirche eingerichtet gewesen. 1961 wurde an der gleichen Stelle die Gnadenkirche erbaut. Sie bot auf einer Fläche von 80 m² Platz für bis zu 1.000 Gläubige. Die außergewöhnlichen Kirchenfenster stammen von Max Herrmann.
Heute dient das Gebäude nicht mehr als Gotteshaus. Die hier eingerichtete Gedenkstätte dokumentiert die Integration und das Schicksal von Flüchtlingen und Vertriebenen und schildert deren Wohnsituation. Die alte Barackenkirche soll auf dem Gelände wieder neu entstehen.
Der alte Hafen von Norden hat schon aufregende Zeiten erlebt. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts legten hier regelmäßig Schiffe aus England, Schweden und Portugal an. Aber die Zeiten änderten sich und der Hafen wurde den neuen Bedürfnissen angepasst. Geblieben ist nur noch das alte, 1857 erbaute Pack- und Zollhaus. Im Hafen legen heute die Fähren nach Norderney und Juist ab. Der Fähranleger befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Norddeich-Mole.
Die Fähre nach Norderney verkehrt nahezu im Stundentakt. Die Fahrzeit auf die nach Borkum zweitgrößte Ostfriesische Insel beträgt ungefähr 55 Minuten. Norderney wurde 1948 das Stadtrecht verliehen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Inseln dieser Inselgruppe ist hier das Fahren von Autos mit Benzinmotoren erlaubt. Bereits 1797 wurde Norderney als das erste Nordseeheilbad anerkannt. Das ‚bade-museum’ geht auf die Geschichte der Seebadeanstalt ein. Weitere interessante Museen sind das historische Museum der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit dem Seenotkreuzer Bernard Gruben und das Heimatmuseum ‚Norderneyer Fischerhaus’. Zu den sehenswerten Gebäuden gehören das Kurhaus von 1799, das noch existierende Postamt von 1892, das Central-Schulgebäude von 1900 und die Windmühle von 1862. Der Galerieholländer ist die einzige Inselwindmühle Niedersachsens. Das Stadtzentrum wird durch die vielen im 19. Jahrhundert erbauten wilhelminischen Häuser geprägt. Ansonsten bietet die Insel die Möglichkeit zur ausgiebigen Ruhe und Entspannung.
Da die Fahrrinne für die Fähre nach Juist tideabhängig ist, variieren die An- und Abfahrzeiten der Schiffe täglich. Sie werden aber, soweit das möglich ist, den An- und Abfahrtzeiten der Regionalbahn angepasst. Die Fahrzeit nach Juist beträgt ungefähr 90 Minuten. Juist ist mit 17 Kilometern die längste der Ostfriesischen Inseln, ihre maximale Breite beträgt allerdings nur 900 Meter. Neben der Möglichkeit zur Ruhe und Entspannung bietet die Insel mit dem Küstenmuseum, dem Nationalpark-Haus und dem Kutschenmuseum mehrere kleine liebevoll gestaltete Museen, die einen Besuch lohnen. Der 1928 erbaute Wasserturm ist das Wahrzeichen der Insel Juist. Das imposanteste Gebäude jedoch ist das 1898 im wilhelminischen Stil errichtete Kurhaus, im Volksmund auch ‚Weißes Schloss am Meer’ genannt. Eine Besonderheit der Insel ist der Hammersee, der einzige Süßwassersee der Ostfriesischen Inseln und ein anerkanntes Naturdenkmal. Er entstand während einer Sturmflut, als in dieser Stelle von Norden her Wasser durchbrach und Juist vorübergehend in zwei voneinander getrennte Inselhälften teilte. Die Zuschüttung an der Nordseite wurde erst 1932 mit einem Damm vollendet. Inzwischen hat sich der Salzgehalt des Hammersees fast vollständig verflüchtigt.
Radrouten die durch Norden führen:
Wurster Nordseeküste
er nich will dieken, de mutt wieken‘ (Wer nicht deichen will, muss weichen). Dieser Satz sagt viel aus über das Wurster Land, in dem der Mensch 1000 Jahre lang gegen die Gewalten der Nordsee ankämpfen musste, ehe die Küstenlinie und das dahinterliegende Marschland durch Deiche wirkungsvoll gesichert und befestigt werden konnte. Das Niedersächsische Deichmuseum informiert über die Geschichte des Deichbaus und des Küstenschutzes. Heute gehört das Wurster Watt zum Nationalpark Wattenmeer und damit zum UNESCO-Weltnaturerbe und das Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste vermittelt alles Wissenswerte über diese einzigartige und schützenswerte Landschaftsform und bietet auch geführte Wattwanderungen an. Die Wurster Nordseeküste wird durch den Tourismus geprägt und bietet eine Vielzahl von Attraktionen und Sehenswürdigkeiten. Dorum und Wremen sind anerkannte Nordseebäder mit eigenen Krabbenkutterhäfen, wo man die bunte Kutterflotte beim Ein- und Auslaufen beobachten kann. In Wremen gibt es mit dem Museum für Wattenfischerei auch dafür ein eigenes Museum.
Das Land Wursten ist eine reine Marschlandschaft zwischen Bremerhaven und Cuxhaven, die traditionell landwirtschaftlich geprägt ist. Historisch gehört der Landstrich zu Friesland. Der Name ‚Wursten‘ leitet sich von ‚Wurtsassen‘ (Wurtenbewohner) ab. Wurten sind künstlich aufgeschüttete Siedlungshügel, die vor der Errichtung der Deiche den einzigen Schutz vor Sturmfluten boten. Alle sieben Wurster Kirchen wurden als Wehrkirchen auf solchen Wurten erbaut und entstanden im 12. bzw. 13. Jahrhundert im romanischen Stil. Die St.-Peter-und-Paul-Kirche in Cappel wurde berühmt, weil sie die am besten erhaltene Arp-Schnitger-Orgel besitzt. Im Mittelalter war das Land Wursten ein geschlossener friesischer Kulturraum, später war der Begriff lange nur noch als Landschaftsbezeichnung gebräuchlich. 1974 wurden die zuvor selbstständigen Gemeinden dieser Region zusammengefasst und es entstand damit die Samtgemeinde Land Wursten. Im Jahre 2015 fusionierte sie mit der Gemeinde Nordholz und trägt seitdem den Namen Wurster Nordseeküste.
Sehenswertes:
Im Juni 2009 wurde das Wattenmeer als einzigartige und schützende Landschaft in den Kanon des UNESCO- Weltnaturerbes aufgenommen.
Nahe dem Kutterhafen von Dorum-Neufeld befindet sich das Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste. Die moderne Ausstellung wurde 2012 wiedereröffnet. In mehreren Großaquarien wird die vielfältige Tierwelt dieses außergewöhnlichen Lebensraumes gezeigt. Daneben informiert das Nationalpark-Haus über den Naturschutz im Wattenmeer und die angrenzenden Salzwiesen als wichtiges Rastrefugium für Zugvögel. Um das Wattenmeer besser begreifen zu können, sollte man auf jeden Fall an einer im Nationalpark-Haus angebotenen geführten Wattwanderung teilnehmen.
In der Gemeinde Wurster Land gibt es noch zwei idyllisch gelegene Krabbenkutterhäfen. In Dorum-Neufeld und in Wremen kann man noch die farbigen Kutter beobachten, wie sie den kleinen Hafen anlaufen und den Granat anlanden. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, denn an diesem Bild und an diesen Abläufen hat sich seit vielen Jahrzehnten kaum etwas geändert. Teilweise kann man die Krabben direkt von Bord kaufen – und das lohnt sich, denn frisch gepulter Granat ist geschmacklich kaum zu übertreffen, sagen die Einheimischen. Die Krabben werden sofort in das ‚Krabbensiebhus‘ gebracht und dort weiterverarbeitet. Die Wattenfischerei im Wurster Land ist tideabhängig, denn die schmale Fahrrinne ins Wattenmeer kann nur bei Flut befahren werden. Das Fanggebiet der Krabbenfischer erstreckt sich über die Außenweser bis nach Cuxhaven sowie die Deutsche Bucht bis Helgoland.
An der Außenweser liegt idyllisch hinter dem Deich der Kutterhafen von Wremen. Hier kann man noch immer die Krabbenkutter beobachten, wie sie zum Wattenfischen auslaufen und später mit ihrem Fang wieder heimkehren. Im Museum für Wattenfischerei kann sich der interessierte Zuschauer auch über die Theorie informieren. Es befindet sich am Dorfplatz gleich neben der Kirche in einem der ältesten Häuser des Ortes. Hier erfährt der Besucher alles Wissenswerte über die Geschichte der Wattenfischerei, die beschwerlichen Lebensbedingungen der Fischer, ihre Fangmethoden und die früher gebräuchlichen Gerätschaften.
‚Gott schuf das Meer, aber der Friese die Deiche‘, so heißt es hier an der Nordseeküste. Über 1000 Jahre lang hat der Mensch mit den Naturgewalten der Nordsee gekämpft, ehe es zu einer festen, von Deichen geschützten Küstenlinie gekommen ist. Noch vor wenigen Jahrhunderten musste die Landkarte nach jeder Sturmflut neu gezeichnet werden. Die Deiche wurden zum Schicksal für das Land. Im 12. Jahrhundert entstand der erste zusammenhängende Deich vor der Wurster Küste.
Das Niedersächsische Deichmuseum in Dorum ist das einzige Museum in Europa, das sich der Thematik des Deichbaus und des Küstenschutzes ausführlich annimmt. Die Ausstellungsfläche des 2012 modernisierten Museums beträgt ungefähr 600 m². Auf ihr werden die Veränderung der Nordseeküste aufgrund von Sturmfluten und Flutkatastrophen und die Besiedelung des Marschlandes dokumentiert sowie die geschichtliche Entwicklung des Deichbaus und dessen Unterhaltung in der heutigen Zeit erklärt. Die umfangreiche Sammlung von Deichbaugeräten und Werkzeugen ist in dieser Form wohl einzigartig.
In diesem Museum werden über 4.000 Muscheln und Meeresschnecken aus verschiedenen Teilen der Welt ausgestellt. Dabei handelt es sich aber nicht um eine einfache Muschelsammlung, sondern vielmehr um eine kreative und geistreiche Präsentation. Neben der beeindruckenden Vielfalt in Form, Muster und Farben führen die phantasievollen und witzig gewählten Vergleiche mit ähnlich aussehenden Dingen zum Staunen und Schmunzeln. Gerade diese humorvollen Umschreibungen machen das Kuriose Muschel-Museum so sehens- und erlebenswert.
Erbaut wurde der barkenähnliche Leuchtturm bereits 1887. Über 100 Jahre lang stand er vor der Küste und markierte bis 1922 das Hauptfahrwasser der Außenweser. Als sich die Fahrrinne natürlich verlagerte, wurde er überflüssig und dementsprechend abgeschaltet. Lange Zeit fristete er ein nutzloses Dasein, bis er 2003 umgesetzt wurde und seitdem als Hafenfeuer von Dorum-Neufeld dient. Im Leuchtturm wurde eine Ausstellung untergebracht, die die Lebens- und Arbeitswelt eines Leuchtturmwärters im ausgehenden 19. Jahrhundert dokumentiert. Dabei kann auch der Laternenraum besichtigt werden. Von der Leuchtturmgalerie hat man einen wunderschönen Blick über das Watt der Außenweser und auf die in der Ferne vorbeifahrenden Ozeanriesen. Nach Norden kann man bis zur Insel Neuwerk sehen.
Einst stand am Kutterhafen am Wremer Tief der Leuchtturm ‚Kleiner Preuße‘. Seinen Namen erhielt er aufgrund seiner mit 10 m geringen Größe und den preußischen Farben schwarz-weiß. Er verrichtete seinen Dienst zwischen 1906 und 1930 als Quermarkenfeuer. Danach wurde er wieder abgebaut.
Im Jahr 2005 wurde ein Nachbau am Wremer Kutterhafen aufgestellt, der sich schnell zur Toristenattraktion entwickelte. Bei schönem Wetter ist er während der Saison geöffnet. Der neue ‚Kleine Preuße‘ dient zwar nicht mehr als Seezeichen, scheint aber als Leuchtfeuer im Gleichtakt in Richtung Hafen und Deich.
Die Mühle vom Typ ‚Galerie-Holländer‘ wurde 1857 erbaut. Bis 1955 arbeitete sie noch mit Windkraft, danach wurde sie bis 1992 noch als Schrotmühle mit elektrischem Antrieb privatwirtschaftlich genutzt. Nach dem Verkauf an die Gemeinde Midlum wurde das denkmalgeschützte Gebäude renoviert und ist auch heute noch voll funktionsfähig. Der ‚Verein zur Erhaltung der Midlumer Mühle‘ veranstaltet regelmäßig Backtage, zu denen auch das Mühlengebäude kostenlos besichtigt werden kann.
Auf einer aufgeschütteten Wurt entstand im 12. Jahrhundert eine Kapelle, aus der sich auch der Name der Dorfschaft ableitet. Der Turm mit der eigenwilligen Haube wurde im 15. Jahrhundert erbaut und diente auch lange als Seezeichen. 1810 wurde die Kirche bei einem verheerenden Feuer stark beschädigt. Das Kirchenschiff wurde abgetragen und in den Jahren 1815/16 wieder neu aufgebaut. Da man für eine neue Orgel kein Geld zur Verfügung hatte, entschloss man sich, eine gebrauchte Orgel zu kaufen. Dieser Umstand verhalf Cappel im Nachhinein zum Weltruhm, denn man übernahm von der Hamburger St. Petrikirche eine Arp-Schnitger-Orgel. Diese wurde 1679/80 von dem weltberühmten Orgelbauer mit reich ausgestaltetem Prospekt erschaffen. Von den ursprünglich 30 Registern sind noch immer 28 original erhalten. Das Instrument gilt heute als die besterhaltendste Schnitger-Orgel überhaupt und ist damit ein wahrhaft kostbares Juwel. Auf der Orgel entstanden weltberühmt gewordene Schallplattenaufnahmen und in jedem Jahr finden im Juli und August vielbesuchte Orgelvorführungen statt.
Die aus Feldsteinen errichtete Dorfkirche von Midlum stammt im Kern noch aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Im 13. Jahrhundert wurde das Kirchenschiff noch einmal vergrößert. Aus dieser Zeit stammt auch der gotische Chor. An der Nordseite ist der ursprüngliche romanische Baustil noch gut erkennbar. Im Kontrast dazu wirkt der 1848 überarbeitete Turm mit seinem spitzen Bleidach noch sehr jung. An der südlichen Außenwand befindet sich eine historische Sonnenuhr aus Sandstein, die 1750 erschaffen wurde.
Zur Innenausstattung gehören die reich verzierte Kanzel von 1623, der Altar von 1696, ein Epitaph von 1611 und ein bleierner Taufkessel aus dem 14. Jahrhundert. Auch das Gestühl stammt noch aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Im Ortszentrum von Misselwarden steht auf einer im 13. Jahrhundert aufgeschütteten Kirchenwurt die St.- Katharinen-Kirche. Der Backsteinbau besitzt einen wuchtigen, auf quadratischem Grundriß stehenden Kirchturm, von dem die bereits 1459 gegossene Glocke ‚Gloriosa‘ schallt. Sehenswert ist der 1671 erschaffene Altar von Jürgen Heitmann.
Das Alte Pastorenhaus Misselwarden stammt noch aus dem Jahre 1707 und dient heute als vielbesuchter Veranstaltungsort für Konzerte und Theateraufführungen.
Der Friedhof an der Marienkirche in Mulsum war 1524 Schauplatz des Wurster Freiheitskampfes, in dem die Wurster Bauern gegen die Truppen des Bremer Erzbischof Christoph kämpften. Die Fehde führte zu einer verheerenden Niederlage für die Wurster und in der Folge zu Plünderungen im ganzen Land.
Die massive Felssteinkirche wurde 1250 auf einer künstlich aufgeschütteten Wurt erbaut. Schutzpatronin der Kirche ist Maria, die Mutter Jesus. Maria wird in der Marsch auch mit den Kräften des Meeres (Mare) in Verbindung gebracht und aus diesem Grunde in dieser Gegend stark vereehrt. Sehenswert sind der gotische Flügelaltar (um 1430), die Madonna auf der Mondsichel (um 1500) sowie die gotische Kanzel.
Die Dorfkirche von Padingbüttel wurde im 13. Jahrhundert als Wehrkirche auf einer aufgeschütteten Dorfwurt errichtet. Als Baumaterial für das romanische Gotteshaus dienten schwere Granitquadersteine. Der massige Backsteinturm wurde im 15. Jahrhundert angebaut und diente lange auch für die Seefahrt als Landmarke. Bei einem Blitzschlag im Jahre 1825 wurde der Kirchturm schwer beschädigt und ist seitdem schiefergedeckt.
Zu den wertvollen Kunstschätzen gehören der Passionsflügelaltar und die Kreuzigungsgruppe aus dem späten 15. Jahrhundert sowie die barocke Kanzel von 1652.
Im Zentrum der Ortschaft Wremen befindet sich mit der Willehadi-Kirche das älteste erhaltene Gotteshaus im Wurster Land. Sie wurde um 1200 als Wehrkirche aus rheinischem Tuffstein erbaut. Teile der Südwand wurden später mit Backstein ausgebessert. Der wuchtige Turm mit seiner barocken Haube wurde während des Ersten Weltkrieges vorübergehend abgetragen, damit die Kirche nicht als Landmarke erkennbar war.
Die 1864 durch die Gebrüder Peternell erbaute Orgel dominiert den Innenraum der einschiffigen Kirche. Auffällig ist auch die 1737 entstandene Deckenbemalung mit alttestamentlichen Motiven. Zum historischen Inventar gehören die Kanzel von 1670, der barocke Altaraufsatz von 1709 und das Taufbecken von 1738. Auffällig ist auch das Segelschiff über dem Mittelgang, das an den glimpflichen Ausgang einer großen Flut erinnert. An der Außenwand stehen zwei gut erhaltene Grabplatten mit figürlichen Abbildungen, die noch aus dem späten 16. bzw. frühen 17. Jahrhundert stammen.
Die Dorfkirche zu Dorum ist neben der Willehadi-Kirche die Hauptkirche im Wurster Land. Das heutige Gotteshaus, dessen älteste Teile noch aus dem 13. Jahrhundert stammen, besaß zwei Vorgängerbauten: eine aus Holz und eine aus Tuffstein. St. Urbanus ist ein einschiffiger Saalbau, bestehend aus unbehauenen Granit-Feldsteinen. An den Fenstern wurden teilweise Ausbesserungen mit Backsteinen vorgenommen. 1510 wurde die Kirche um einen dreischiffigen Hallenchor ergänzt. Mitte des 18. Jahrhunderts entstand der heutige Westturm, nachdem der alte wegen Baufälligkeit abgetragen wurde. Das Chorgewölbe wird durch eine spätgotische Bemalung ausgeschmückt. Weitere Kunstschätze im Inneren der Kirche sind das aus belgischem Marmor geschaffene Taufbecken aus dem frühen 13. Jahrhundert, mit 17 Reliefs ausschmückte Kanzel von 1620, der reich verzierte Altaraufsatz von 1670, das gotische Sakramentshäuschen aus Baumberger Sandstein von 1524 sowie zwei hölzerne Kruzifixe aus dem 13. bzw. 15. Jahrhundert. Das historische Orgelprospekt stammt noch von 1765, das Orgelwerk wurde aber inzwischen ausgetauscht.
Während des Ersten Weltkrieges war der Fliegerhorst Nordholz ein wichtiger Standort für Zeppeline. Noch heute benennt sich das hier stationierte Marinefliegergeschwader 3 nach dem Vater der deutschen Luftschifffahrt ‚Graf Zeppelin‘. Parallel zur großen Asphaltlandebahn des Militärflughafens befindet sich die viel kleinere Graspiste des Sonderlandeplatzes Nordhorn-Spieka, wo kleine Privatflugzeuge landen können.
Etwas nördlich vom Fliegerhorstes befindet sich mit dem Aeronauticum ein Luftschiff- und Marinefliegermuseum. Bereits seit den 1960er Jahren wurden Gegenstände aus der Luftfahrt gesammelt. 1991 wurde diese Sammlung im ‚Marine-Luftschiff-Museum Nordholz‘ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 1996 wurde das Museum erweitert und als Aeronauticum wiedereröffnet.
Zu der Sammlung gehören inzwischen 17 Flugzeuge und Hubschrauber, darunter eine Breguet Atlantic und zwei Panavia Tornados. Neben dem Außengelände wird eine Dauerausstellung gezeigt, die die Geschichte der zivilen und militärischen Luftschifffahrt dokumentiert und insbesondere auf den Luftschiff- und Marinefliegerstandort Nordholz eingeht. Ein weiterer Ausstellungsbereich beschreibt die Geschichte der Marinebahn.
Hinter dem Deich in Spieka-Neufeld liegt der malerische Kutterhafen. Zwei Stunden vor der jeweiligen Hochwasserzeit kommen die verschiedenfarbigen Krabbenkutter von ihrer Fangreise aus dem Wattenmeer zurück. Teilweise kann man den schon an Bord gekochten Granat direkt am Schiff kaufen. Die restlichen frischen Nordsee-Krabben werden dann zur Krabbenpulmaschine gebracht und dort sofort weiterverarbeitet, indem das Krabbenfleisch mit Hilfe von Druckluft aus der Schale geblasen wird. Danach wird der Granat zum Weitertransport konserviert und verpackt.
Die Kirchen an der Wurster Nordeeküste wurden im Mittelalter auf künstlich aufgeschütteten Siedlungshügeln errichtet. Vor der Errichtung von Deichen boten diese Wurten den einzigen Schutz vor Hochwasser und Sturmfluten. Das gilt auch für die St.-Georg-Kirche in Spieka. Sie wurde 1319 als Wehrkirche erbaut. Durch häufige Erweiterungen und Umgestaltungen wirkt das äußere Erscheinungsbild recht uneinheitlich. Der Backsteinturm wurde als Ersatz für einen hölzernen Glockenturm erst 1922 fertig gestellt. Der Haupteingang zur Kirche führt durch den schlichten Turmraum. Sehenswert sind der Altar des Bildhauers Friedrich Eggers von 1678, die Kanzel von 1663 sowie der Taufstein mit dem reich verzierten Holzdeckel. Das Gestühl und die Emporen sind noch aus dem 17. bzw. 18. Jahrhundert erhalten.
Als Ersatz für die baufällig gewordene alte evangelische Kirche von Nordholz entstand 2012 im Zentrum des Ortes ein architektonisch herausragender Neubau. Das lichtdurchflutete Gotteshaus wurde betont schlicht gehalten und besitzt keine Ecken – alles ist rund! Die runden Formen gelten als Symbol der Geborgenheit. Nach dem Konzept sollen sich die Kirchenbesucher mit offenen Armen aufgenommen fühlen.
Im Jahre 1863 wurde die Nordholzer Windmühle als Galerieholländer erbaut. Bereits zuvor hatte hier eine ältere Windmühle gestanden. Das heutige Mühlengebäude besitzt einen dreistöckigen Unterbau aus Ziegelstein und einen reetgedeckten Rumpf. Die Mühle wird als Sommerhaus genutzt und befindet sich im privaten Besitz. Daher ist nur eine Außenbesichtigung möglich.
Radrouten die durch Wurster Nordseeküste führen:
Weser-Radweg
Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer
Nordseeküstenradweg
Geestland
irekt im Norden der Seestadt Bremerhaven liegt die Kleinstadt Langen. Obwohl bereits 1139 erstmals erwähnt, blieb Langen zunächst über Jahrhunderte nur eine kleine zum Amt Bederkesa gehörende Bauernschaft. Erst im 20. Jahrhundert erhöhte sich die Einwohnerzahl Langens deutlich, bedingt durch die Nähe zu Bremerhaven und die Fusionierung mit der Samtgemeinde Neuenwalde. Seit 1990 trägt Langen sogar die Bezeichnung ‚Stadt‘. Im Jahre 2015 fusionierte Langen mit der Samtgemeinde Bederkesa zur Stadt ‚Geestland‘. Die neu gebildete Stadt besitzt einen direkten Zugang zur Nordsee, denn der Stadtteil Imsum liegt direkt hinter dem Deich der Außenweser.
Sehenswertes:
Die evangelische Dorfkirche von Debstedt wurde um 1200 im spätromanischen Stil auf einer aufgeschütteten Wurt erbaut. Der einschiffige Bau wurde aus starkem Felssteinmauerwerk errichtet.
Im Jahre 1912 vernichtete in Debstedt eine Feuerkatastrophe fast 30 Häuser. Auch die Kirche wurde stark beschädigt. Heute ist von der ursprünglichen Bausubstanz noch der Kirchturm, die Südseite vom Schiff und vom Chor sowie die Ostwand erhalten. Das restliche Kirchengebäude wurde etwas größer wieder neu aufgebaut.Der verzierte bronzene Taufkessel stammt noch von 1497, musste aber nach dem Brand restauriert werden. Der Großteil der Inneneinrichtung ging dabei allerdings unwiederbringlich verloren.
Vom Ochsenturm hat man einen prächtigen Ausblick über das Watt und die Außenweser mit ihren weit entfernt vorbeifahrenden Schiffen. Für die Schifffahrt ist der rote Backsteinturm auch heute noch eine wichtige Landmarke.
Erbaut wurde der Ochsenturm im Jahre 1215 als Teil einer Kirche. Im 19. Jahrhundert schlug jedoch ein Blitz in das Gotteshaus ein und beschädigte es dabei schwer. Man entschloss sich, das Kirchenschiff abzutragen und die Kirche im benachbarten Wedderwarden wieder neu aufzubauen. Nur der Turm der alten Kirche blieb erhalten. Er steht auch heute noch inmitten des alten Friedhofes, dessen ältesten Grabsteine noch aus dem 16. Jahrhundert stammen. Hinter der Szenerie: Die Entscheidung der Ochsen Die Dorfältesten von Dingen, Wedderwarden und Lepstedt beschlossen in trauter Einigkeit, eine gemeinsame Kirche zu bauen. Aber über den Standort war man uneins! Jeder wollte die Kirche im eigenen Dorfe wissen, keiner wollte jeden Sonntag ins Nachbardorf wandern. Da kam ein Wurster auf die Idee, ein Ochsenpaar zwischen den drei Dörfern laufen zu lassen. Dort, wo sich die Tiere niederlegen würden, dort solle die neue Kirche entstehen. So geschah es. Und obwohl das Gotteshaus die Zeiten nicht überstand, so blieb der Kirchturm bis heute stehen! Im Gedenken an diese Begebenheit heißt der Turm noch heute ‚Ochsenturm‘.
Die alte romanische Feldsteinkirche von Holßel wurde im Jahre 1111 erbaut. Der auffällig spitze Turm wurde allerdings erst 1896 fertig gestellt. Seit dem 16. Jahrhundert gehört das Gotteshaus zu der evangelisch-reformierten Gemeinde.
Hymendorf wurde 1829 als Moorkolonie gegründet und angelegt. Es entstanden lange, gerade Wege und ein Kanalnetz zur Entwässerung des Bodens. Die Hauptkanäle wurden durch die Torfkähne als Transportwege genutzt.
Der Nachbau einer alten Moorkate erinnert heute an diese entbehrungsreiche Zeit. Solche Katen stellten die allererste Hausform dar, die die Moorbewohner damals nutzten. Die Moorkate ist inzwischen ein beliebtes Ausflugsziel für Urlauber und Naherholungssuchende geworden.
Das Benediktinerinnenkloster Neuenwalde wurde 1334 erbaut und bestand neben der Klosterkirche aus einem Gebäudekomplex mit Mühle. Nach einem verheerenden Brand im Jahre 1500 musste das gesamte Kloster neu aufgebaut werden. Im Zuge der Reformation wurde das Konvent im 16. Jahrhundert protestantisch und dient auch heute noch als evangelisches Damenstift.
Als Bülzenbett wird ein steinzeitliches Großsteingrab zwischen Sievern und Holßel bezeichnet. Die Megalithanlage entstand zwischen 3.500 und 2.800 v.Chr. Sie bestand ursprünglich aus 55 Steinen, von denen 33 noch erhalten sind. Die Steinblöcke fassen eine 8 x 5 m große Kammer, deren Innenraum etwa 2,5 x 6 m misst.
Nördlich von Sievern befindet sich ein runder Ringwall von etwa sechs Metern Höhe und knapp 60 Metern Durchmesser. Über die Geschichte der ehemaligen Burg muss viel gemutmaßt werden, denn die Faktenlage ist recht dünn. Die mittelalterliche Burg besaß wahrscheinlich bereits eine steinerne Befestigung und stammte wohl aus der Zeit um 1000. Sie bestand aus Vor- und Hauptburg und war mehrfach durch Wälle und Gräben gesichert. Die Gräben der damals Sieverdesborg genannte Anlage wurde von der Sieverner Aue gespeist, die zu dieser Zeit sogar schiffbar gewesen ist. Vermutlich wurde die Burg im 13 Jahrhundert von den Wurster Friesen zerstört und nach einem Wiederaufbau im 14. Jahrhundert endgültig geschleift. Der Name ‚Pipinsburg‘ tauchte erstmals Anfang des 17. Jahrhunderts auf, als die Wehranlage schon lange nicht mehr bestand.
Einen Kilometer östlich befindet sich eine weitere Wallanlage. Die Heidenschanze, in alten Dokumenten auch als Karlsburg bezeichnet, ist sogar wesentlich älter als die Sieveringsborg.
Im Heimatdorf Debstedt ist neben der Dionysiuskirche auch das Heimatmuseum sehenswert. In dem alten niedersächsischen Bauernhaus werden über 2000 Gegenstände aus der bäuerlichen Kultur und des ländlichen Handwerks gezeigt. Zum Museum gehören auch ein Backhaus, ein Bienenstand sowie ein Pferdegöpel.
Im ehemaligen Amtshaus des Alten Klosters hat der Verkehrsverein Neuenwalde ein umfangreiches heimatkundliches Museum eingerichtet. Die Ausstellung zeigt bäuerliche Gerätschaften, Werkzeuge, altertümliches Spielzeug, historischer Schmuck, Kleidung, einen Ackerwagen und eine Kutsche. Eine alte Bauernküche und ein Wohnzimmer zeugen von den früheren Lebensumständen auf einem ländlichen Hof. Zahlreiche präparierte Tiere geben einen Überblick über die heimische Fauna. Ergänzt wird die Ausstellung von zahlreichen Dokumenten, Fotos und Gemälden.
Als John Wagener im Jahre 1876 starb, gaben ihm 6.000 Personen das letzte Geleit. Wagener war amerikanischer Brigadegeneral und Bürgermeister der Stadt Charleston. Die Gründung mehrerer Vereine, einer deutschen Zeitung, einer Kirche und einer Schule gehen auf seine Initiative zurück. Geboren wurde er 1831 als Johannes Andreas Wagener im niedersächsischen Sievern, wo er in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Bereits im Alter von fünfzehn Jahren wanderte er nach Amerika aus und fand dort eine neue Heimat, ohne dass er seine Herkunft jemals verleugnete.
Das John Wagner Haus widmet sich der Auswanderergeschichte dieser Region. Das Museum befindet sich in einem reetgedeckten, typischen niedersächsischen Bauernhaus. Die Ausstellung beschreibt, wie beschwerlich und entbehrungsreich das Leben auf dem Lande im 18. und 19. Jahrhundert war. Die Landwirtschaft konnte die Familien damals kaum ernähren. Aus solch einem bäuerlichen und wirtschaftlich trostlosen Umfeld kamen viele Auswanderer, die in der neuen Welt auf eine neue Chance hofften. Zu ihnen gehörte auch John Wagener, dessen Werdegang hier ausführlich beschrieben wird. So präsentiert sich das John Wagener Haus sowohl als Erinnerungsstätte für die vielen Auswanderer als auch als heimatgeschichtliches Museum.
Radrouten die durch Geestland führen:
Weser-Radweg
Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer
Nordseeküstenradweg






















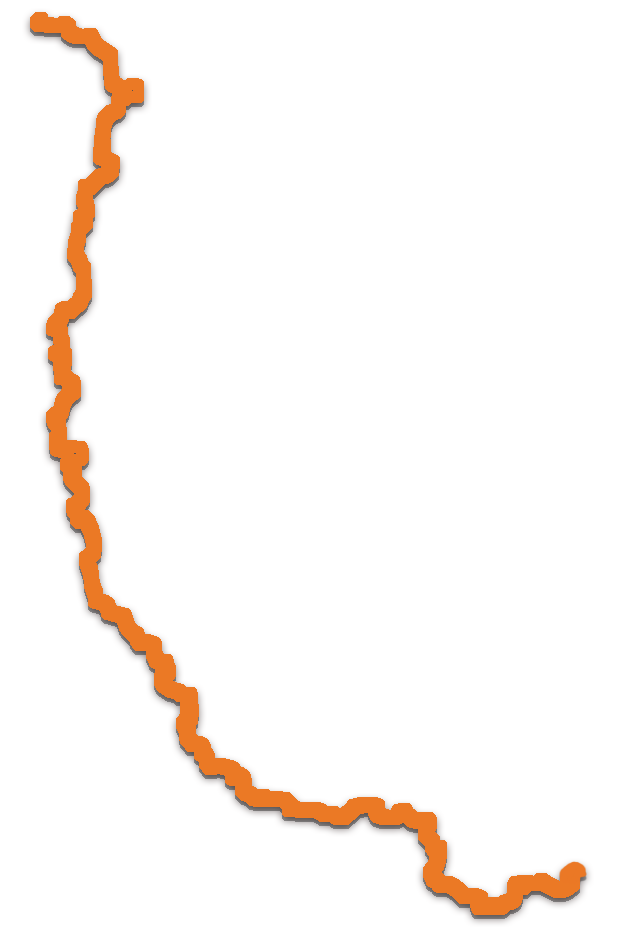
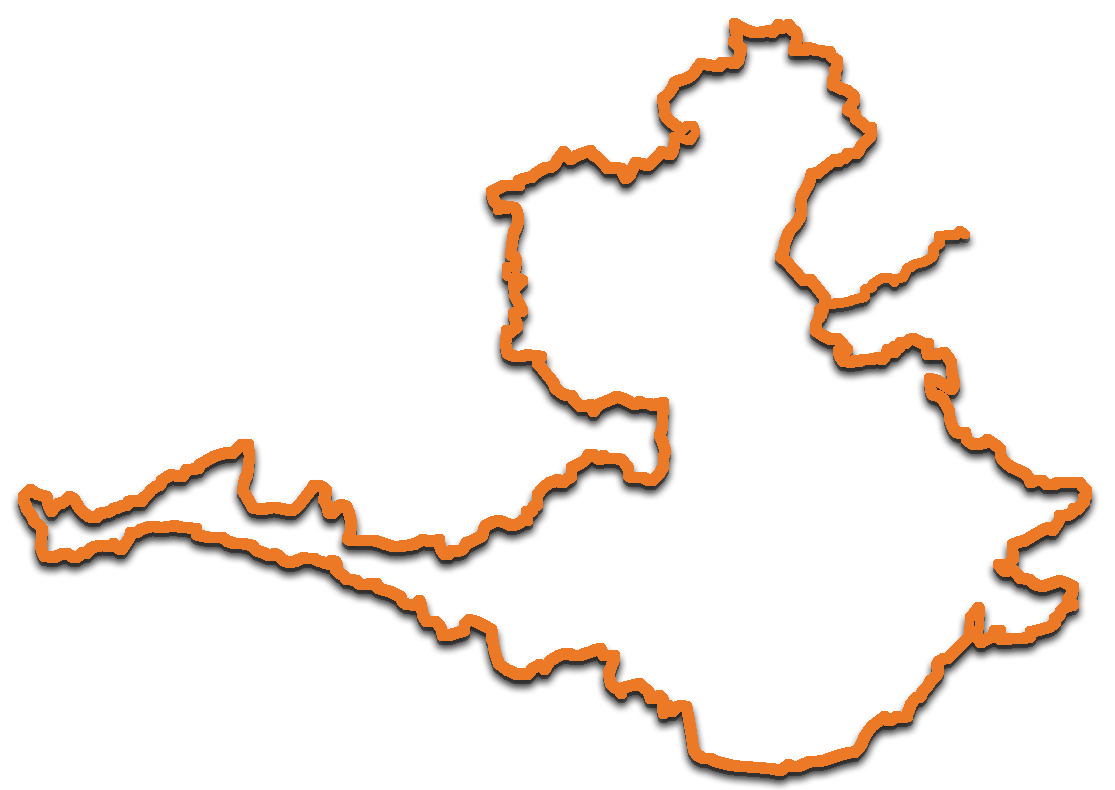
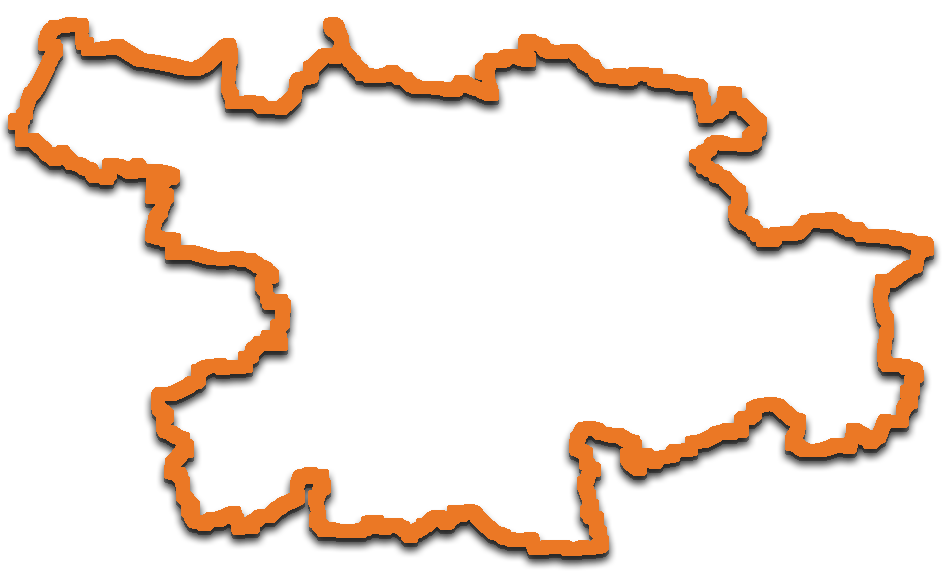

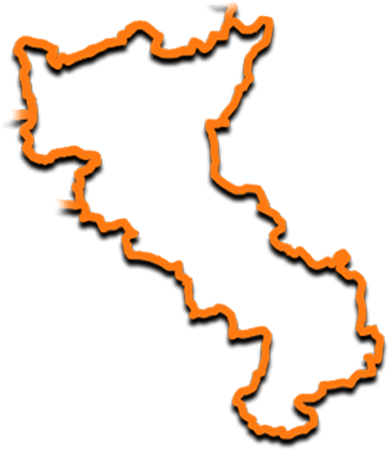
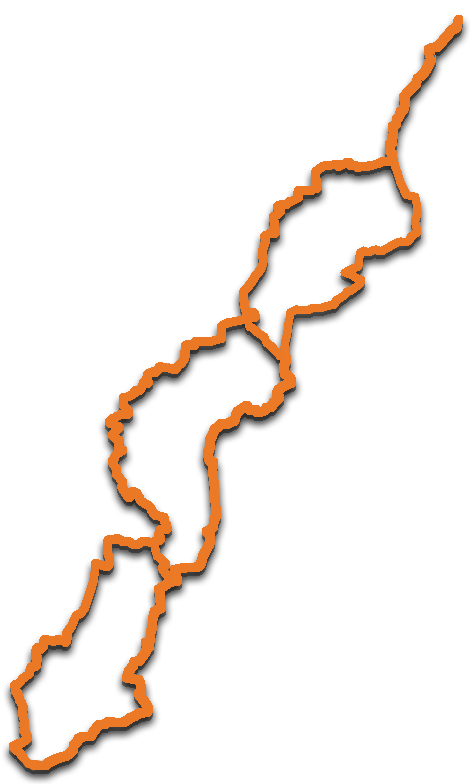


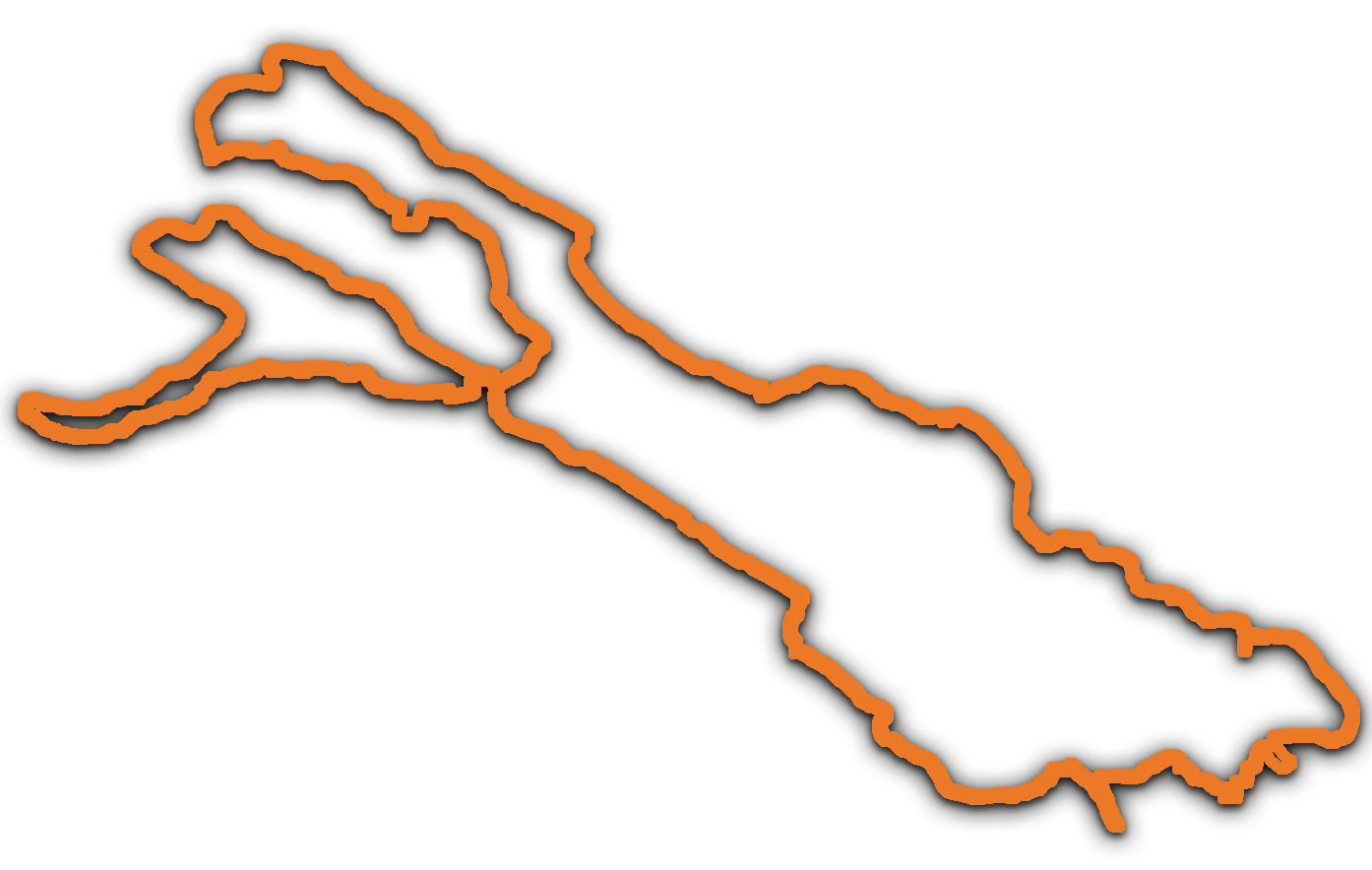

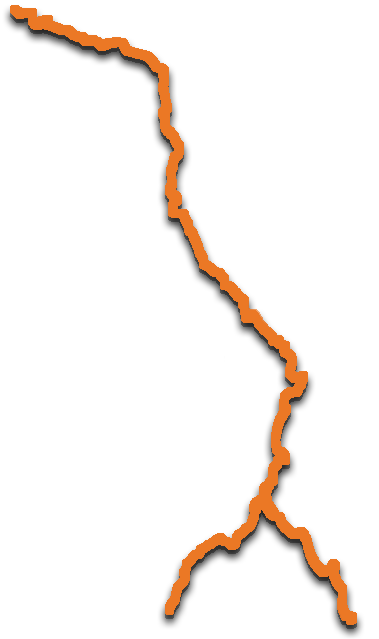
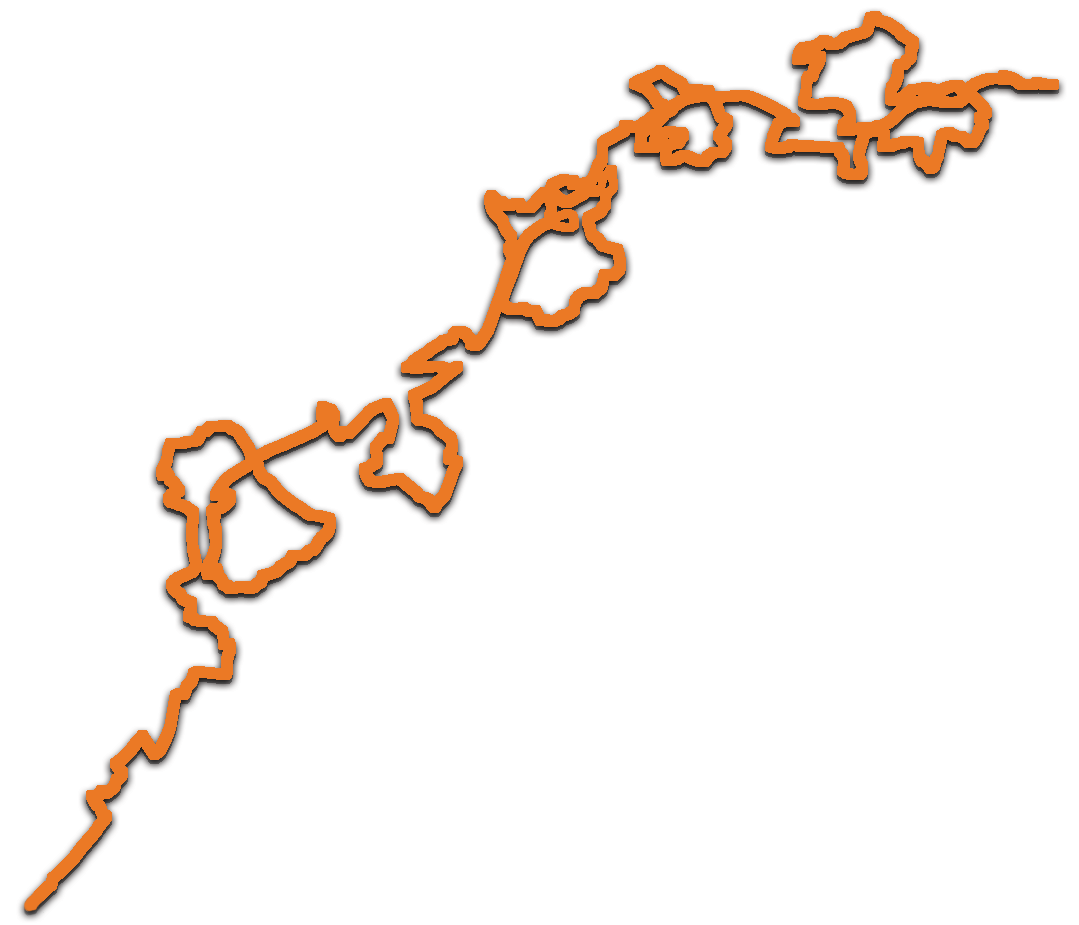
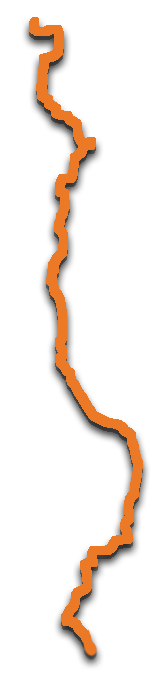












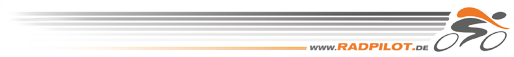







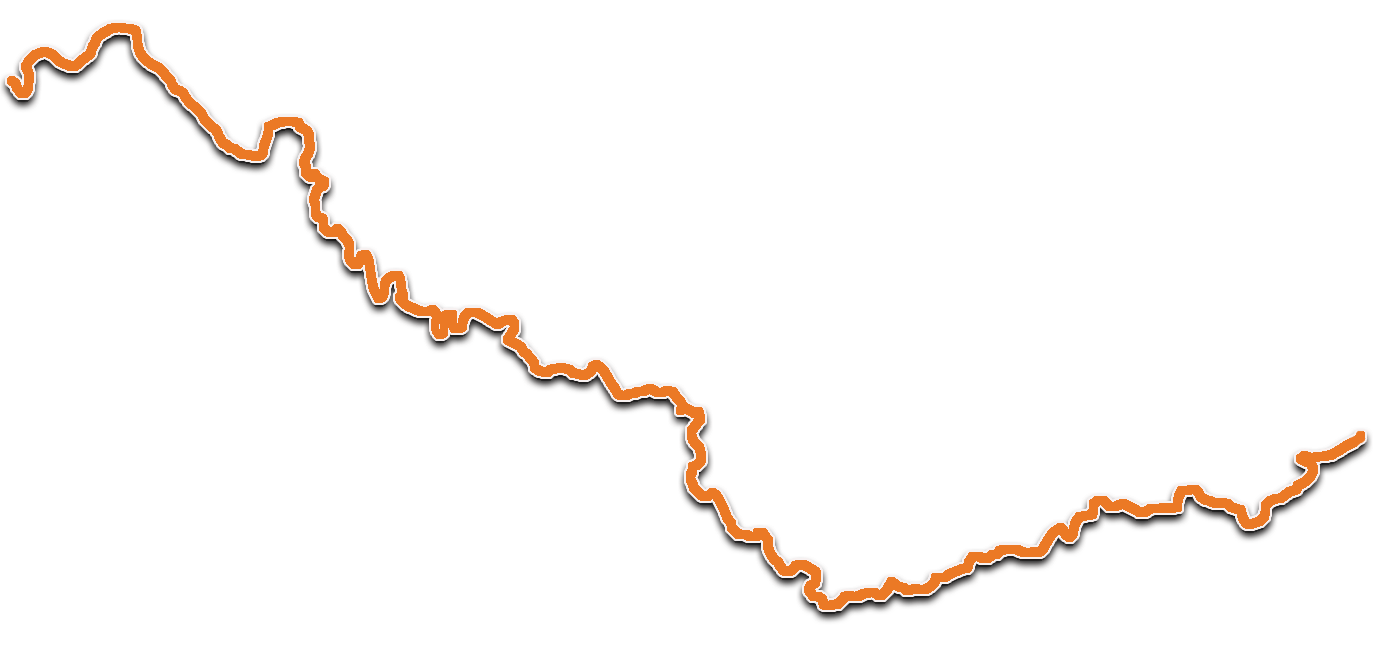

















































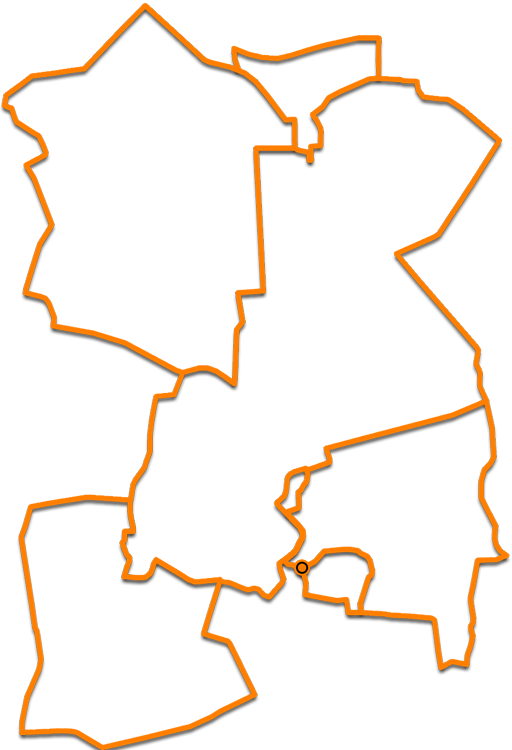





















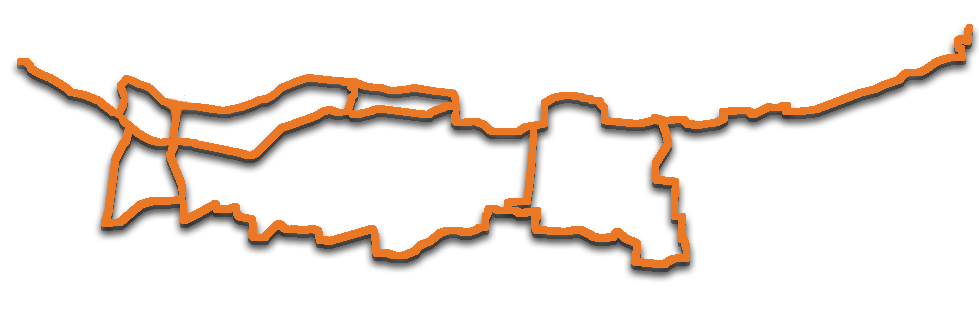











































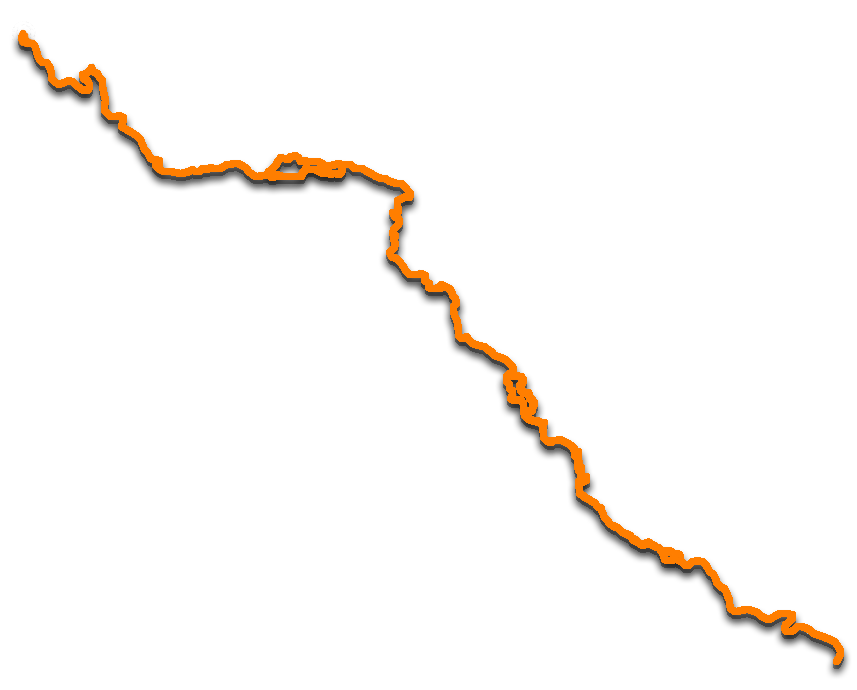










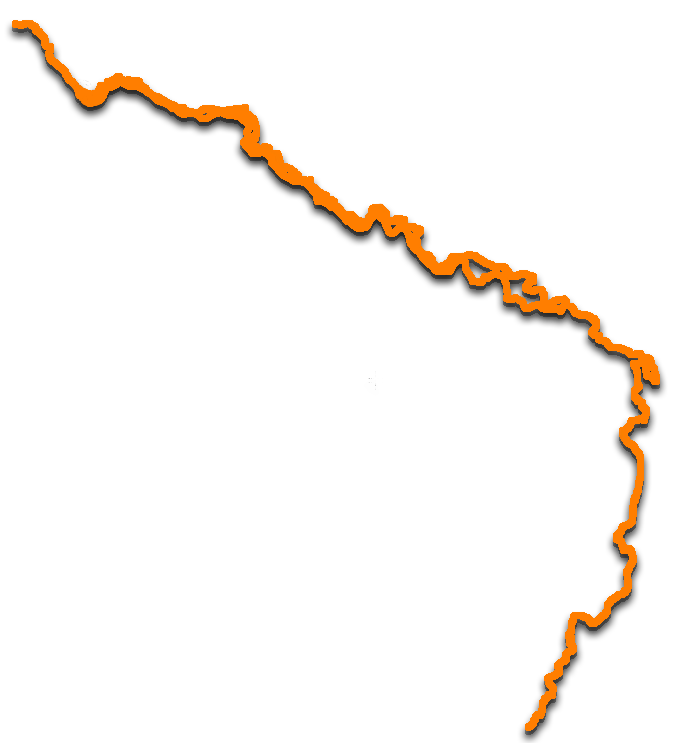











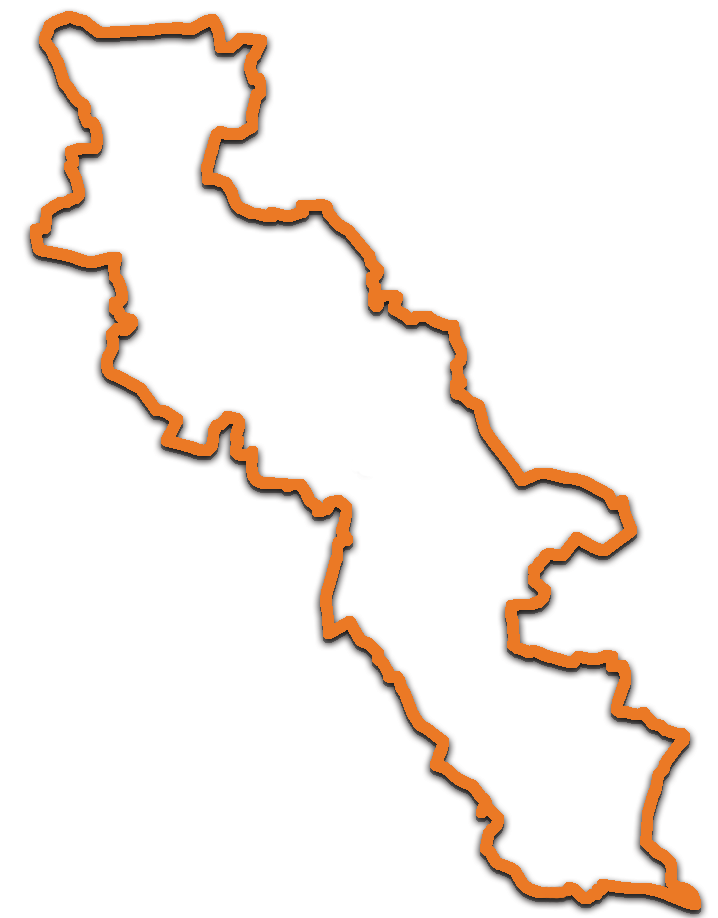

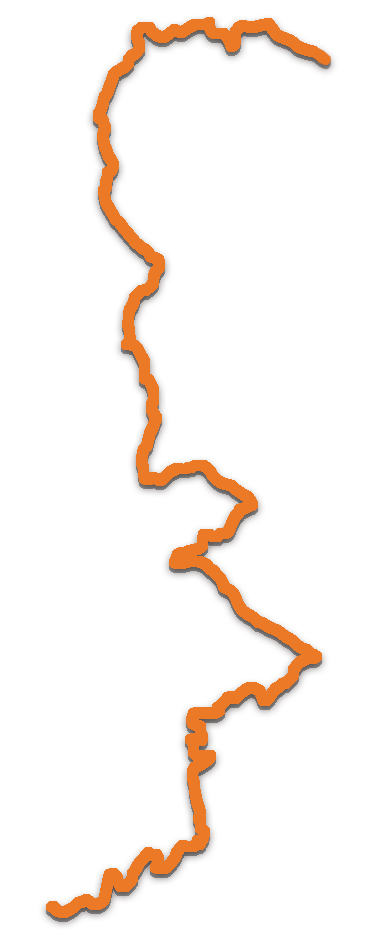














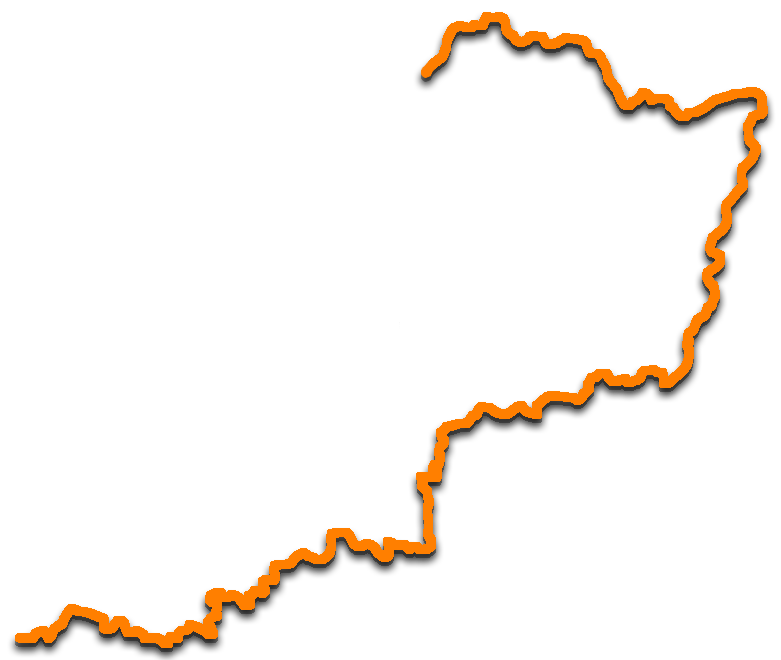
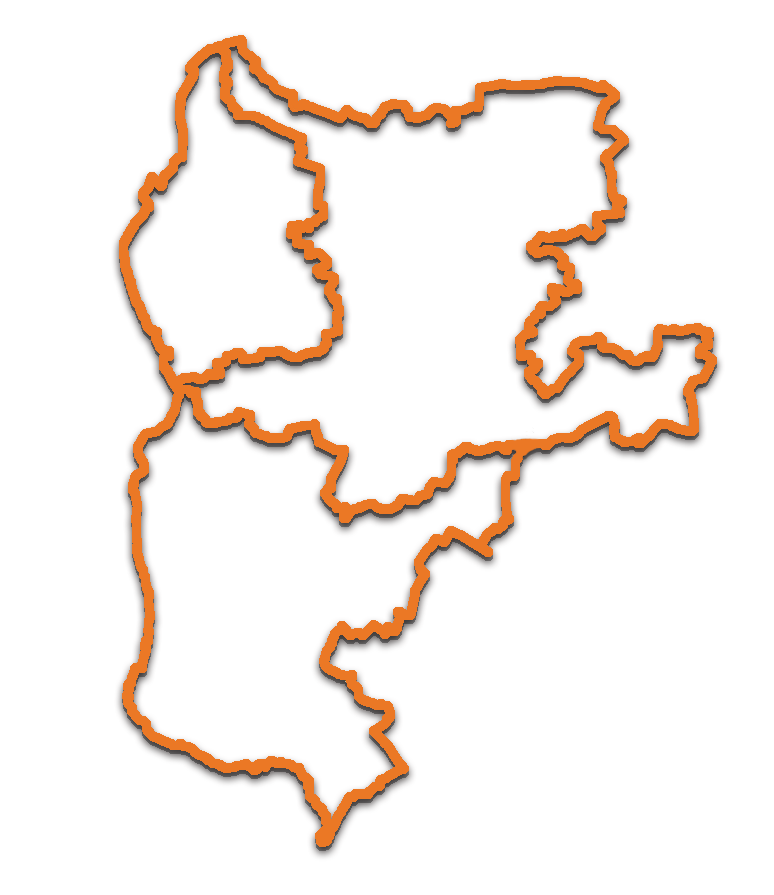
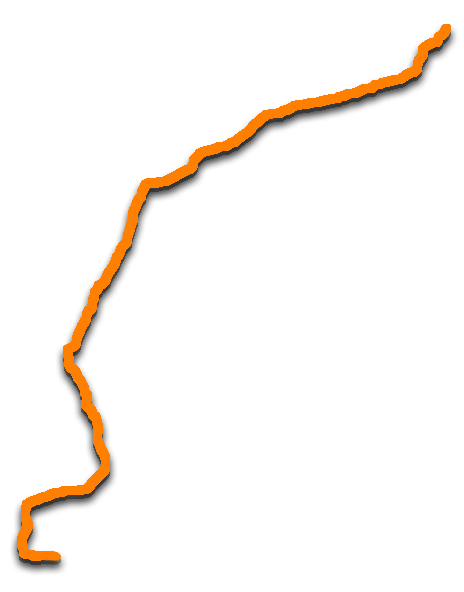
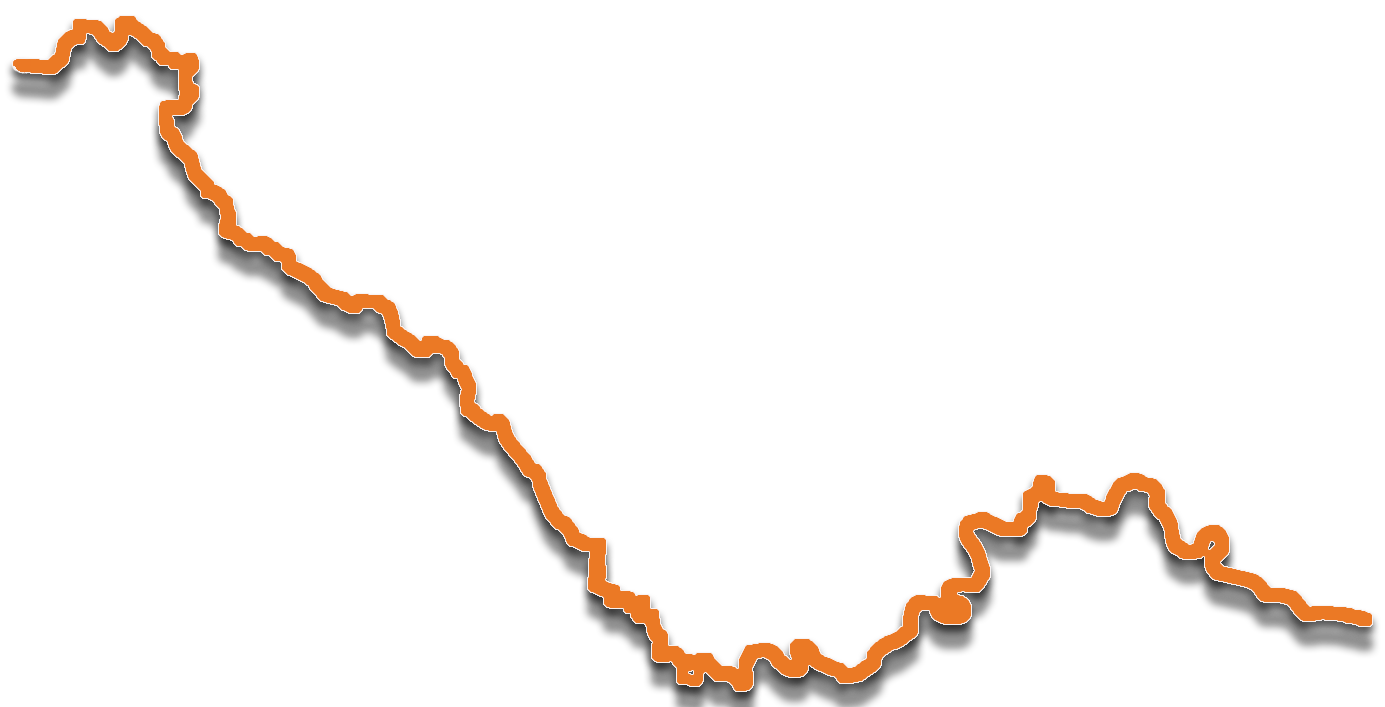
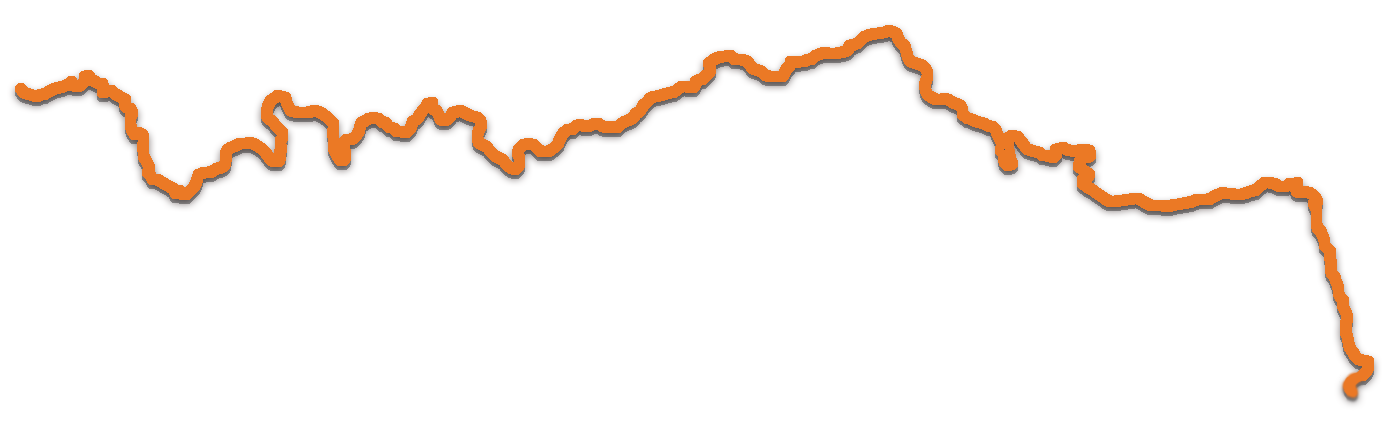
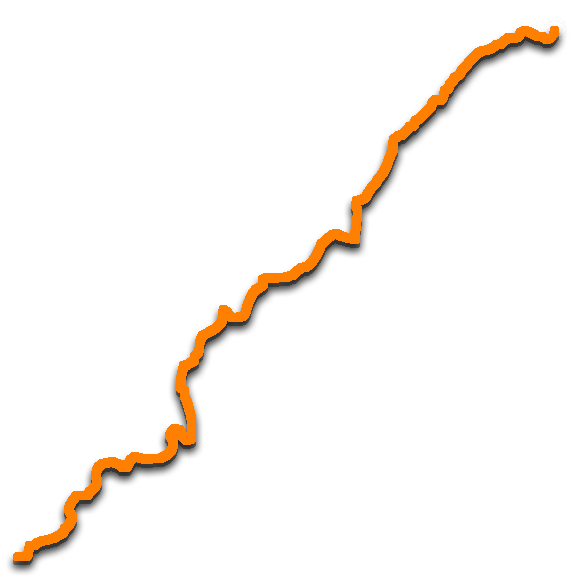




 e
e