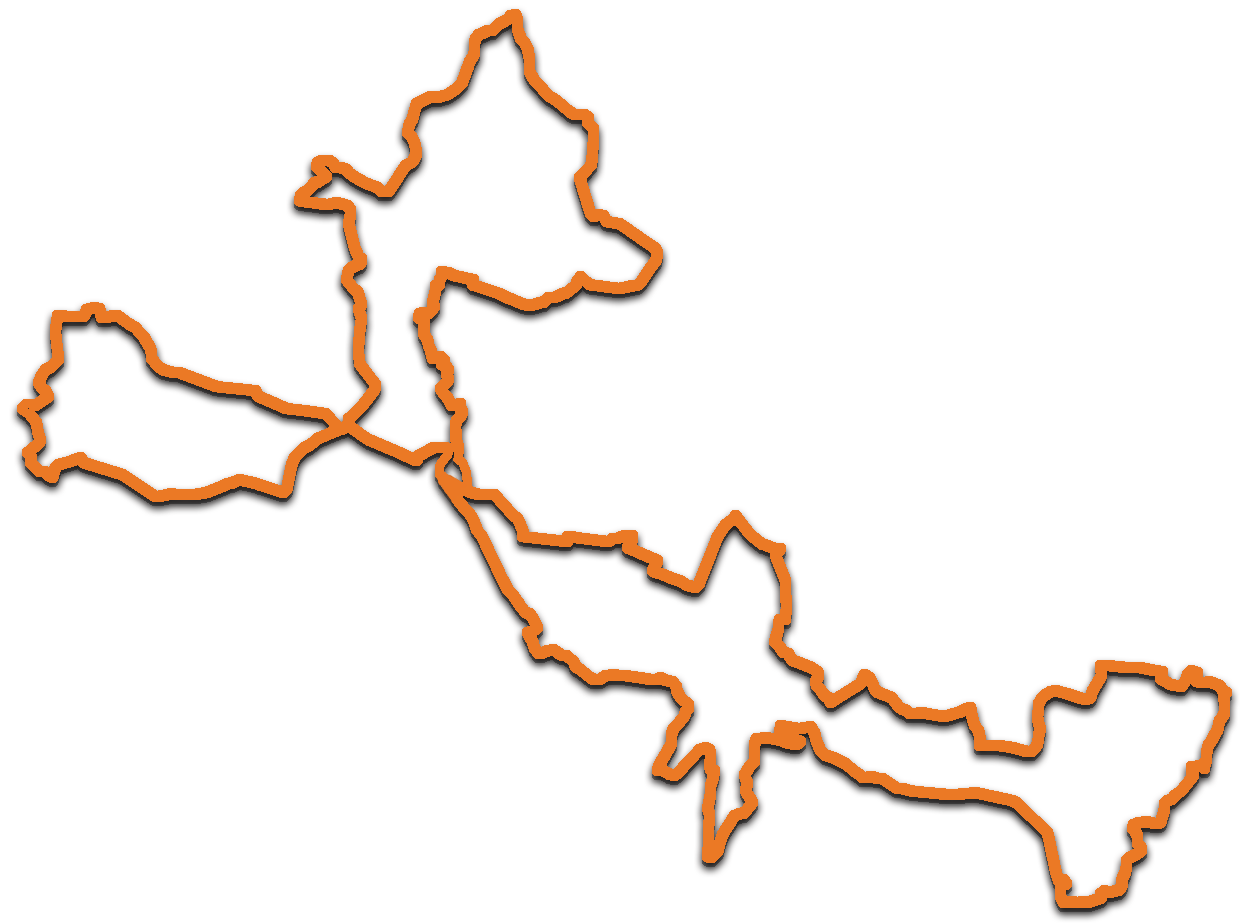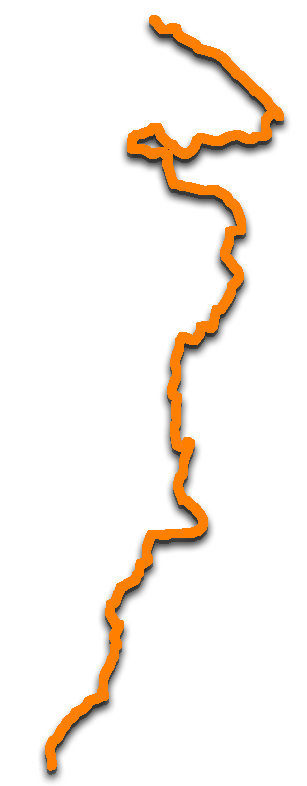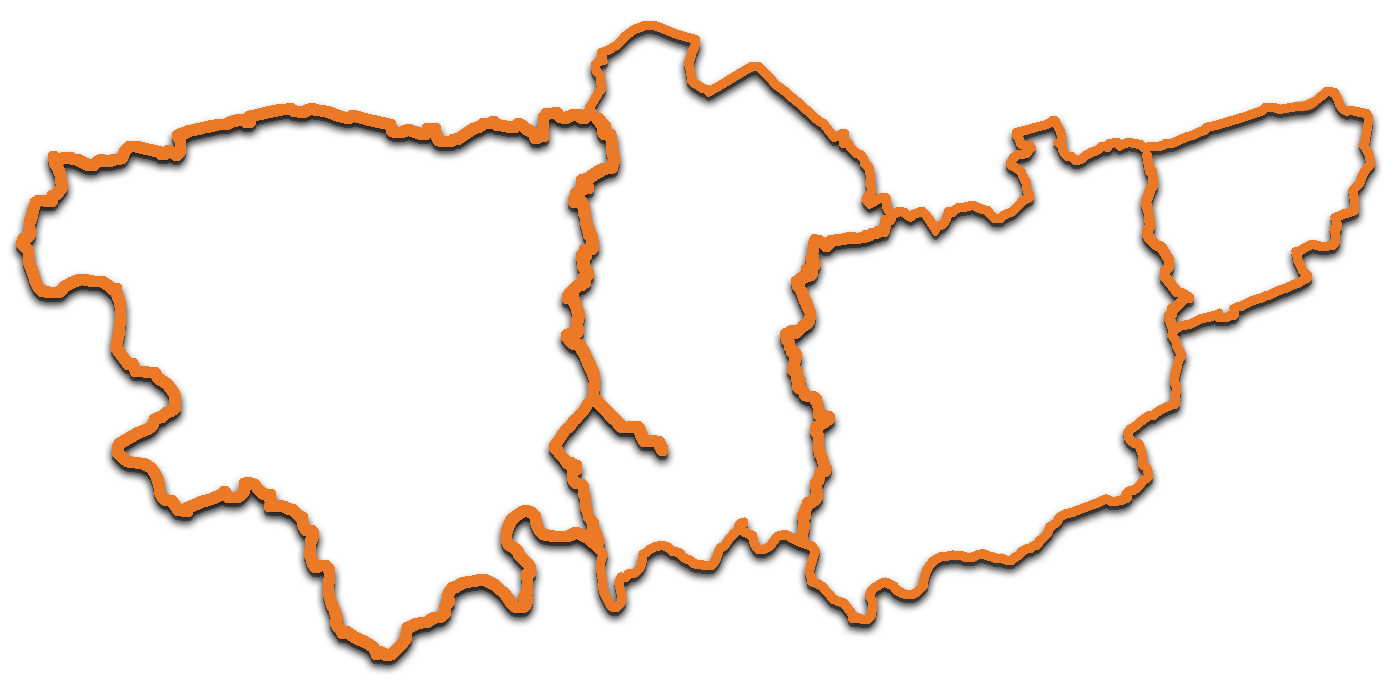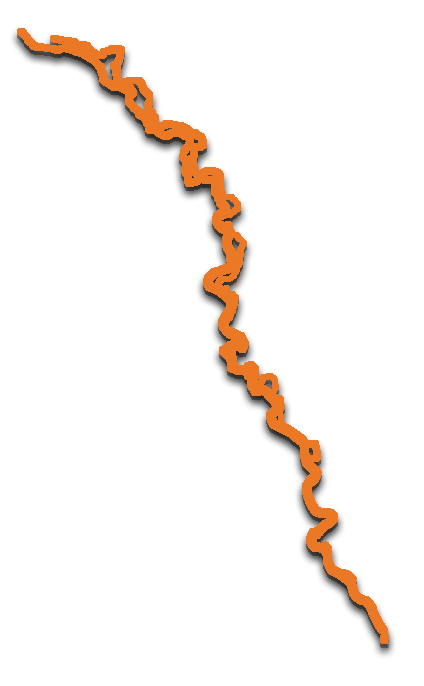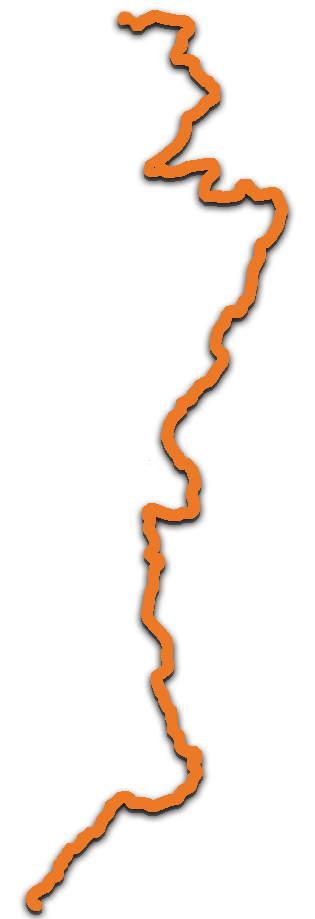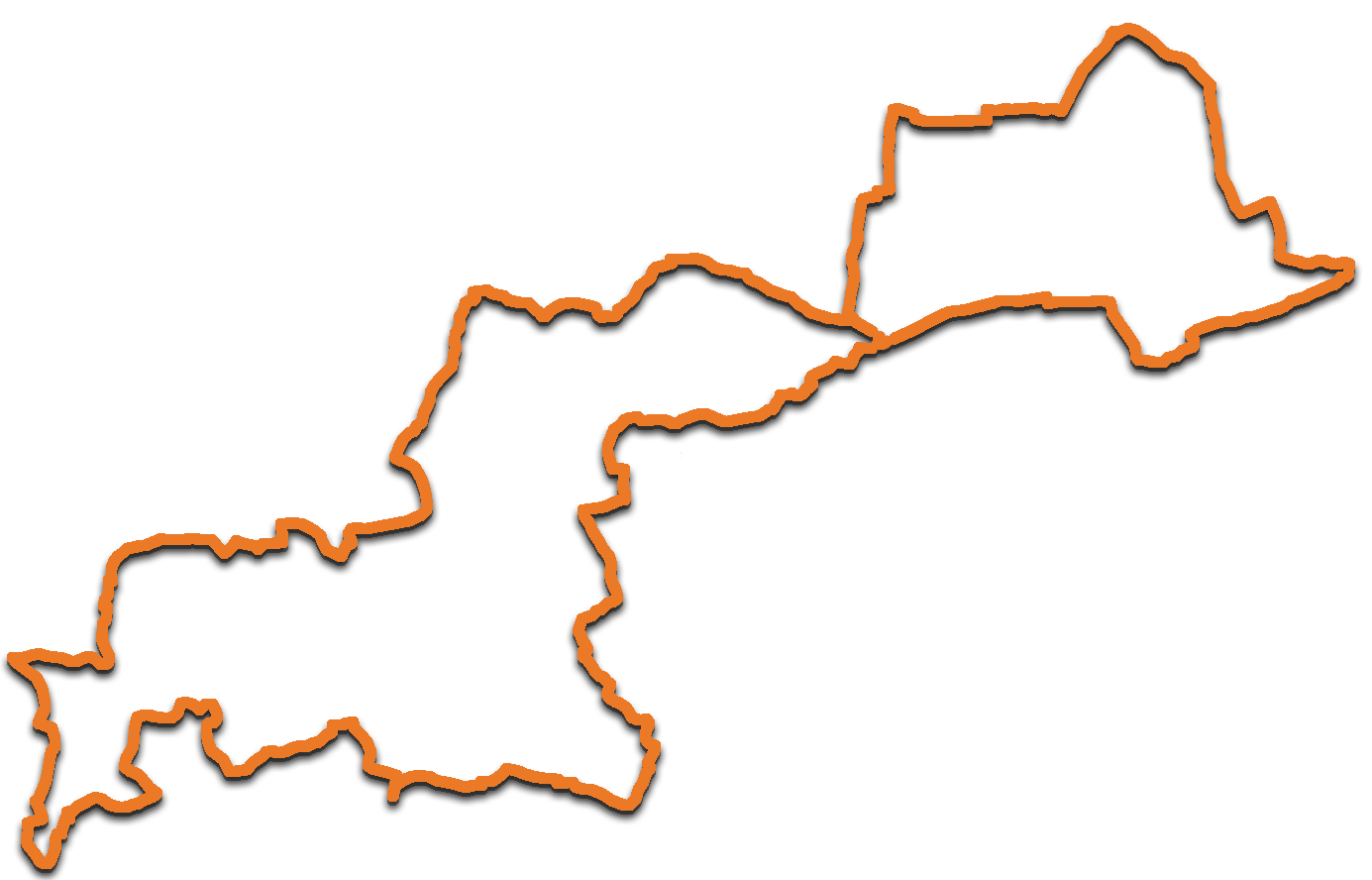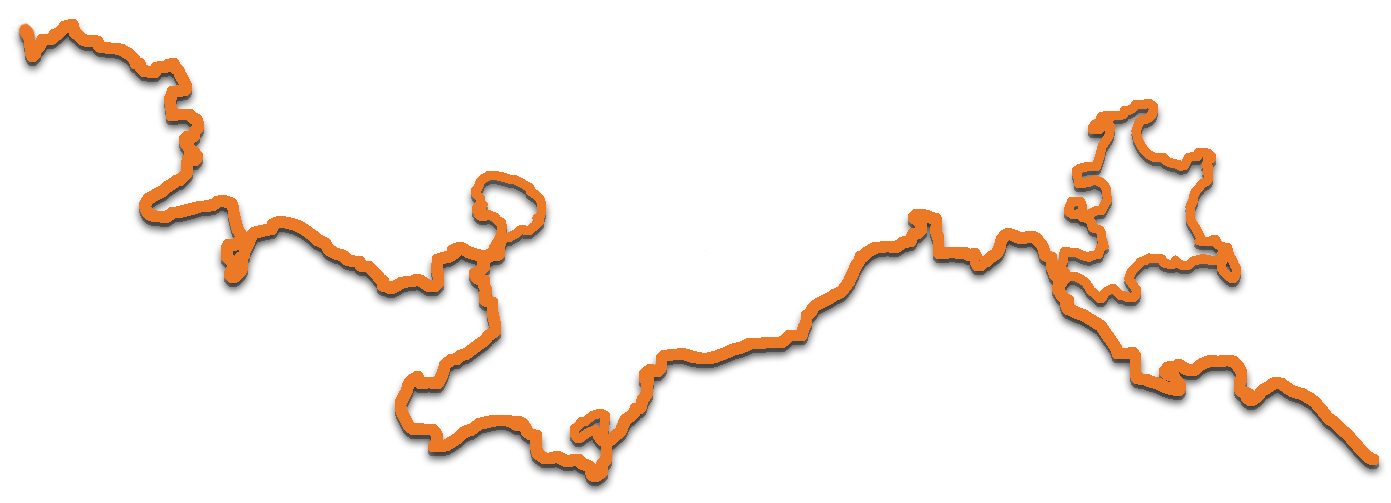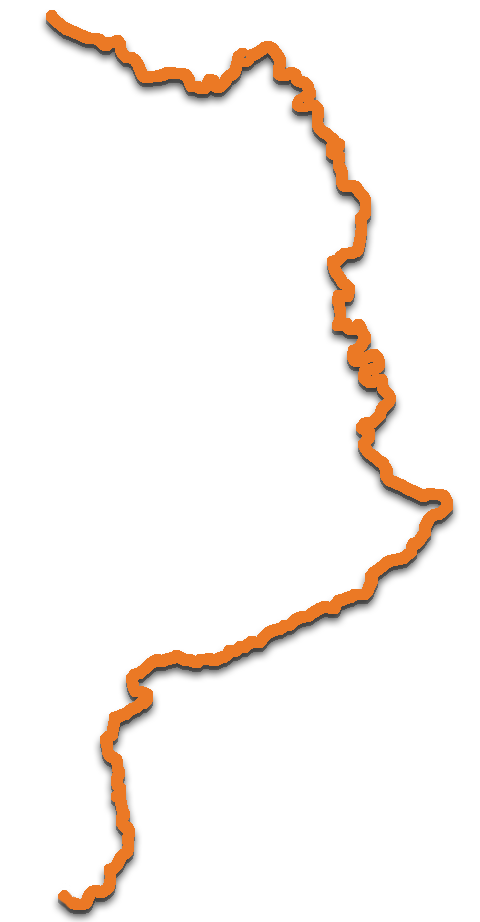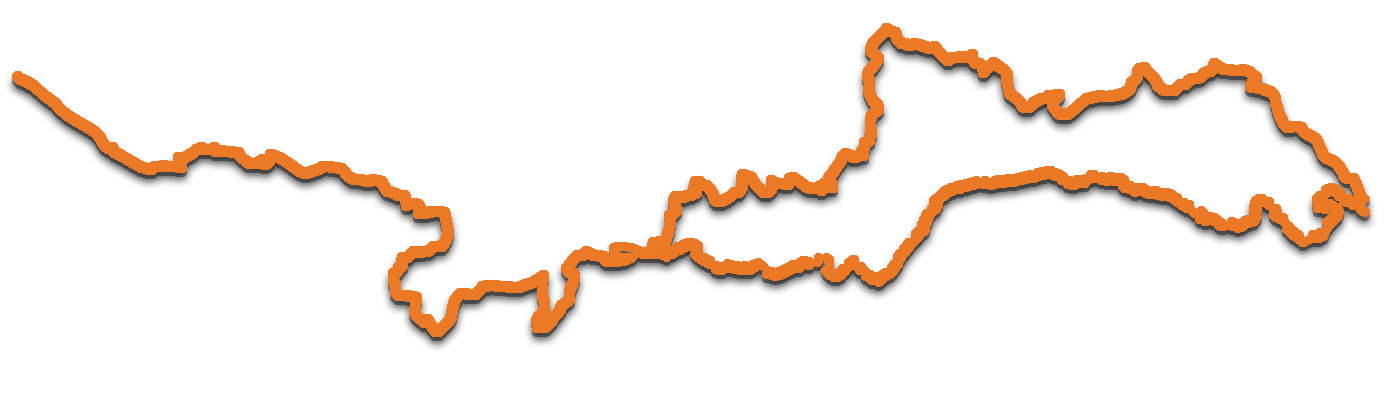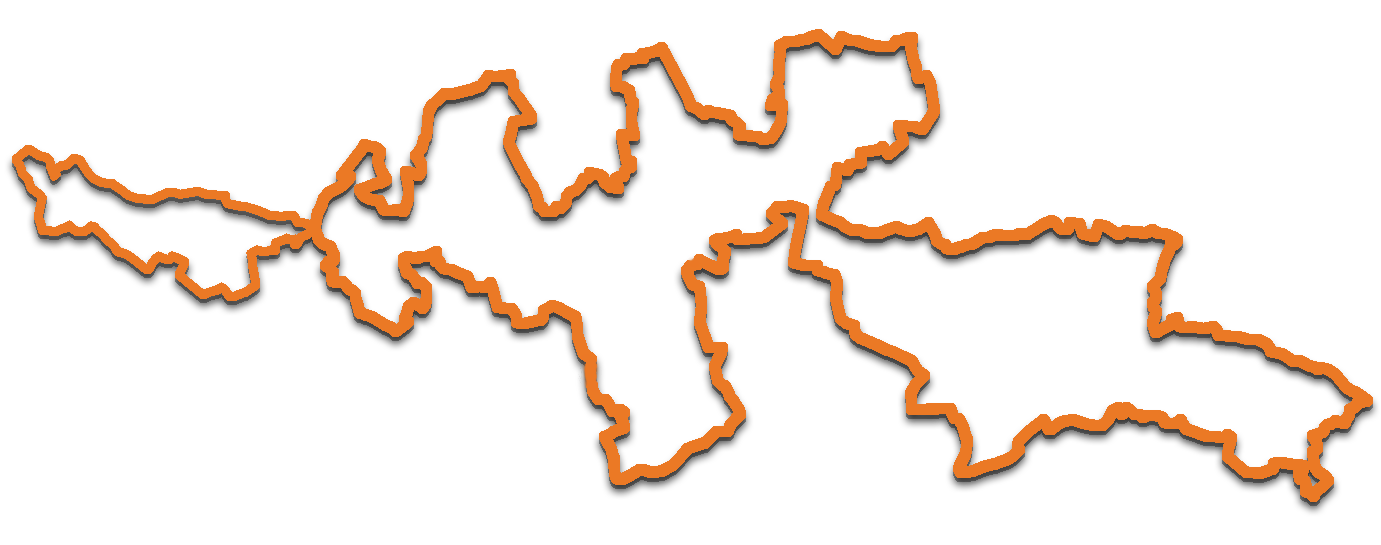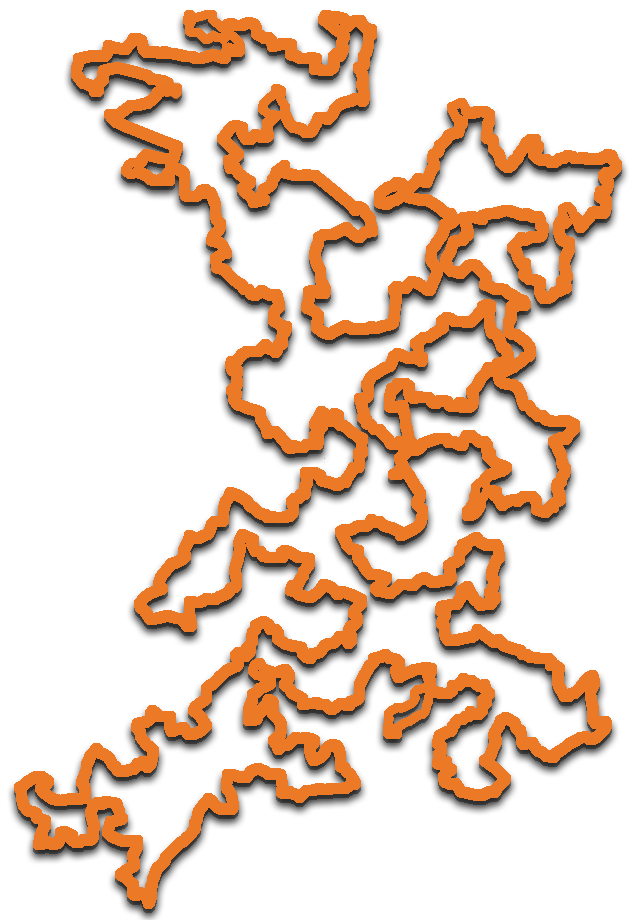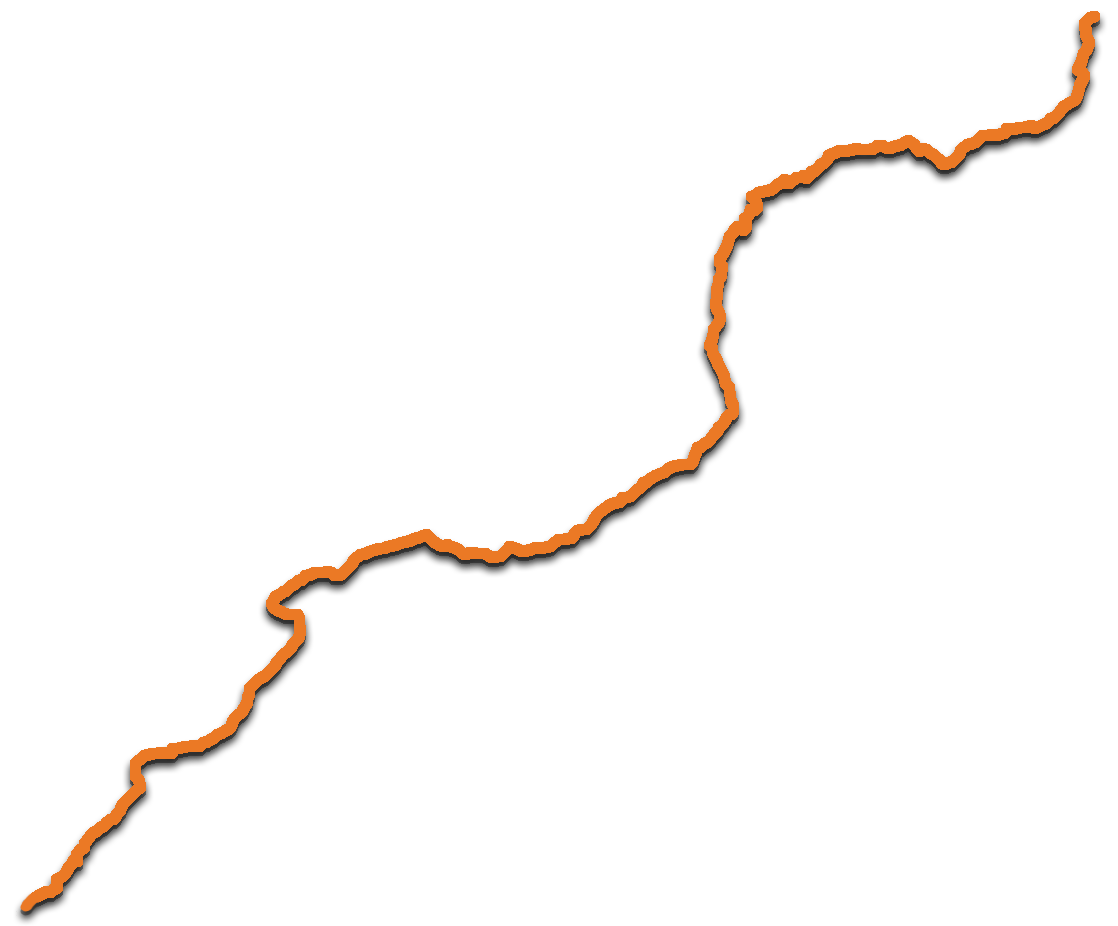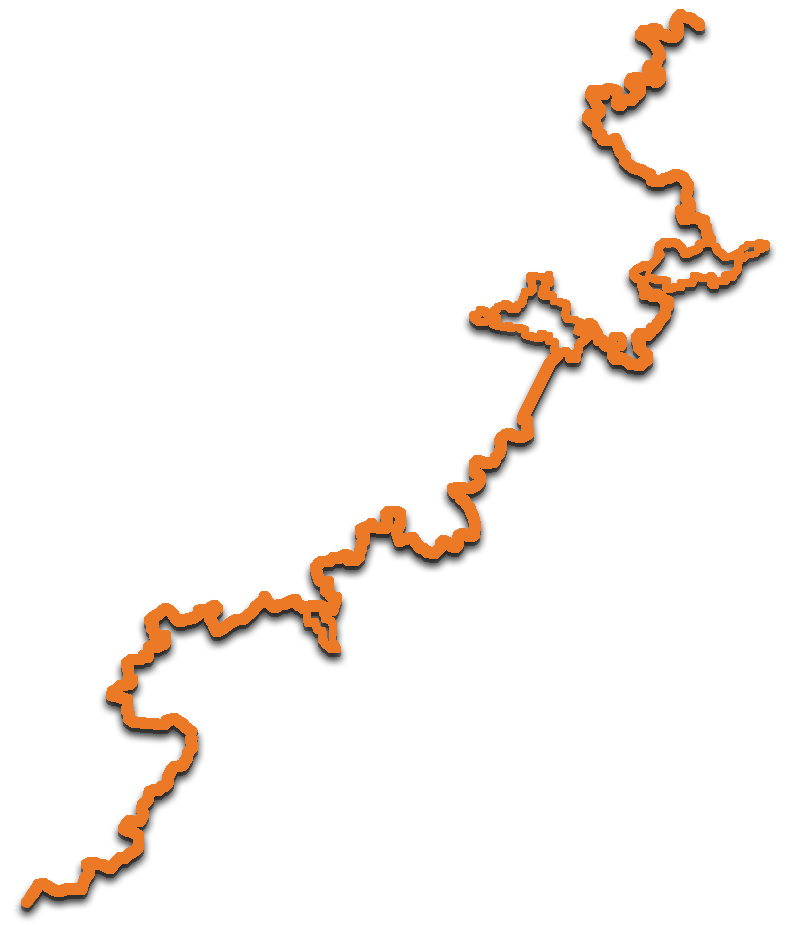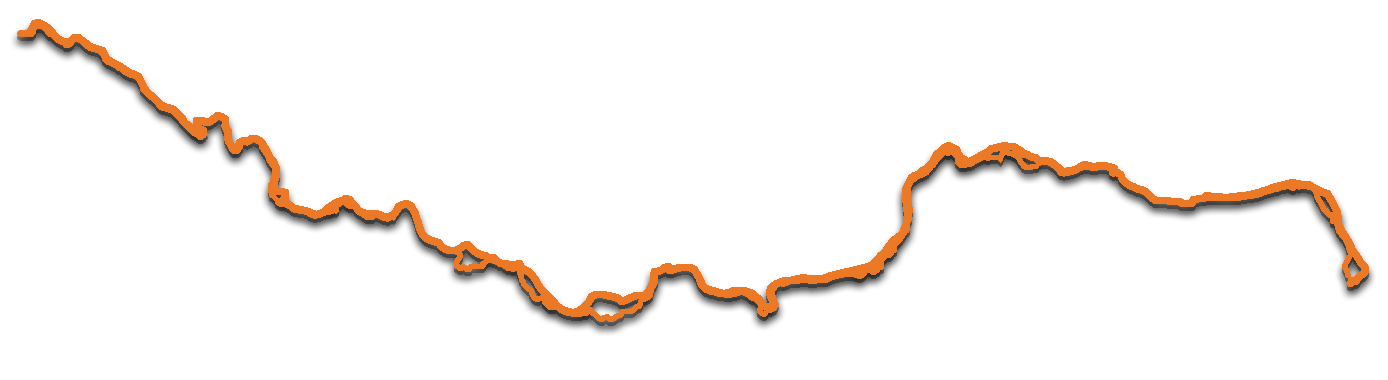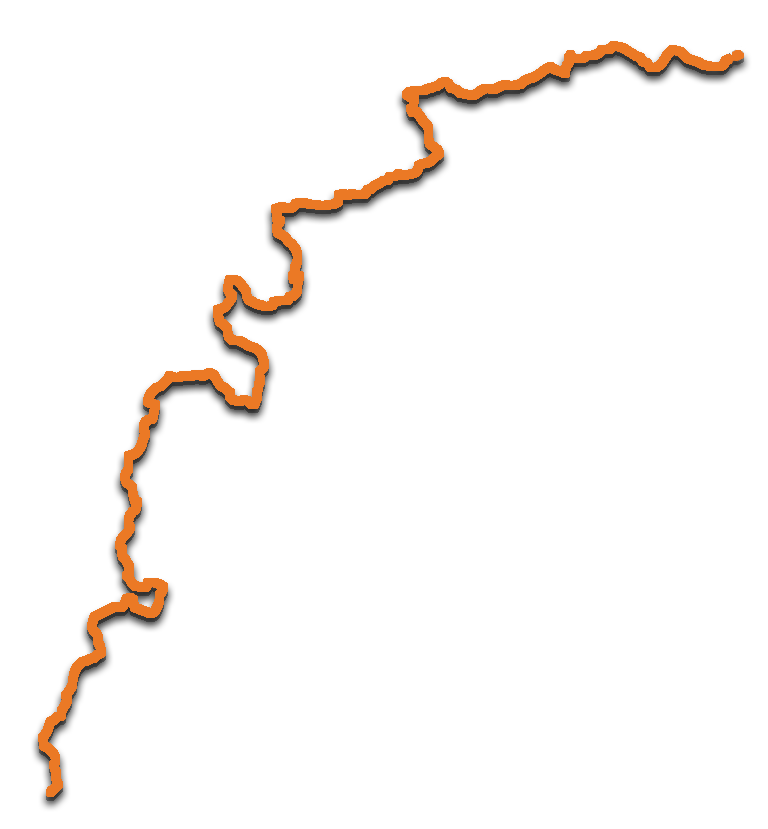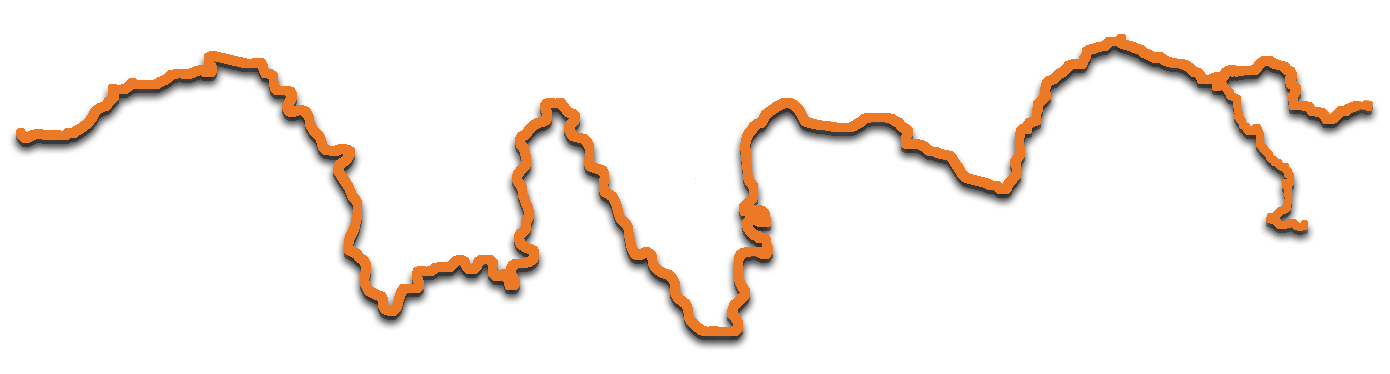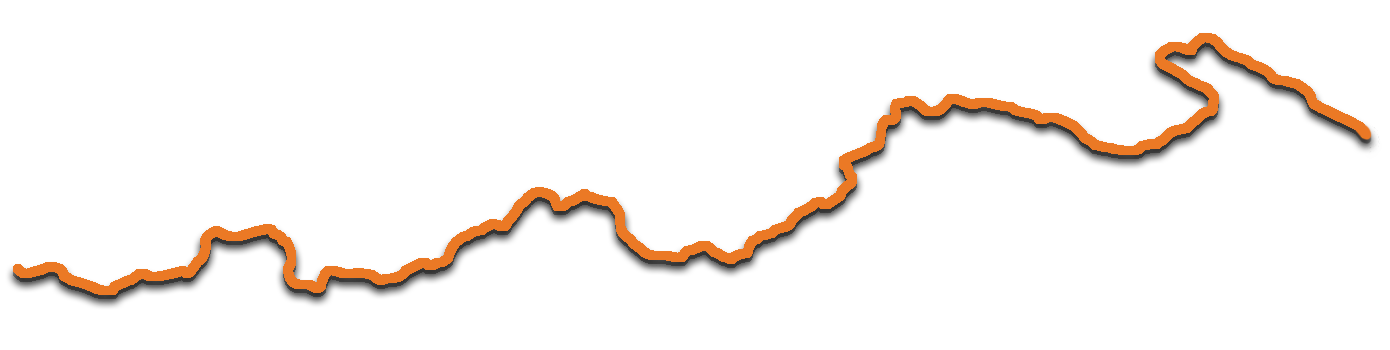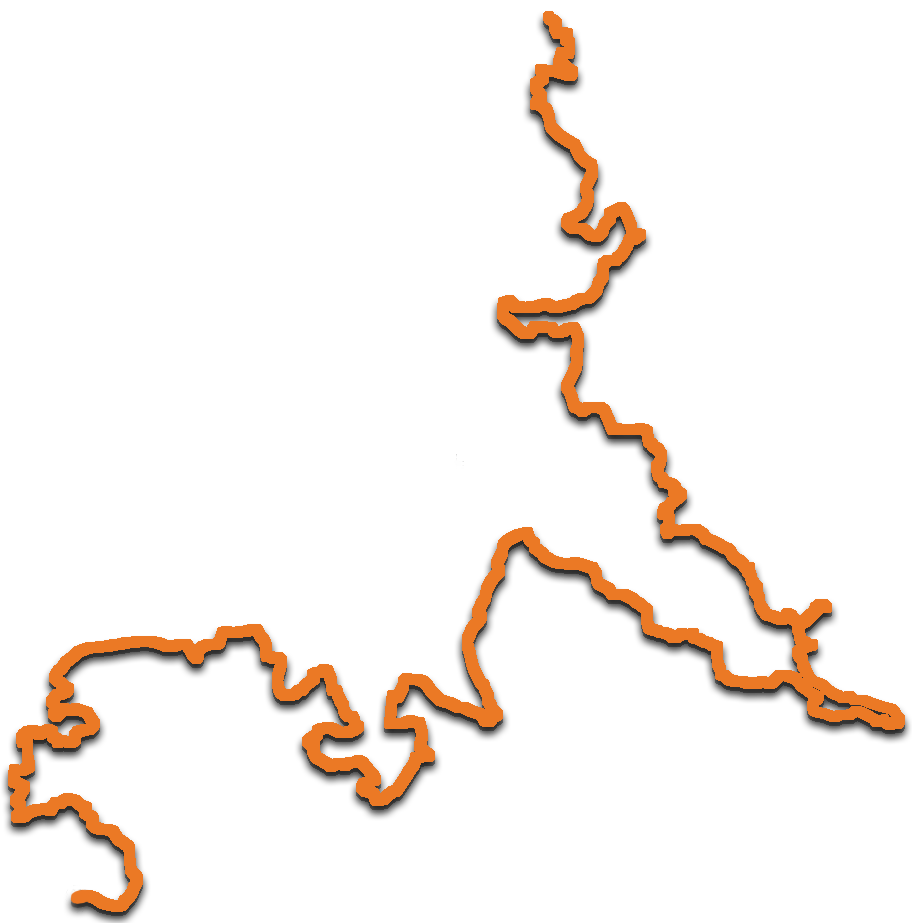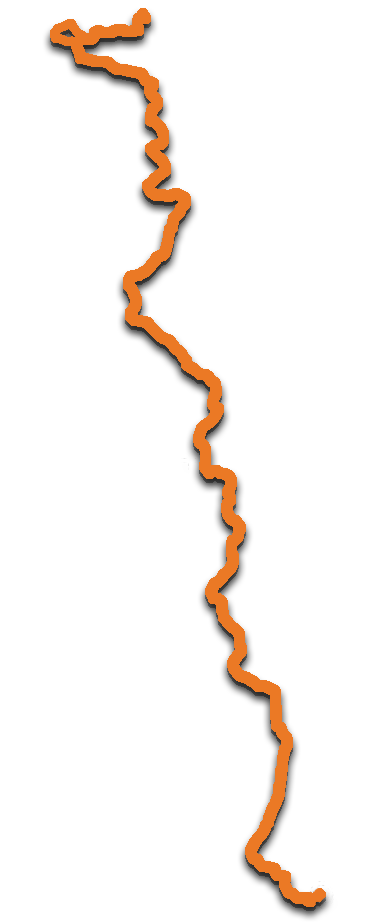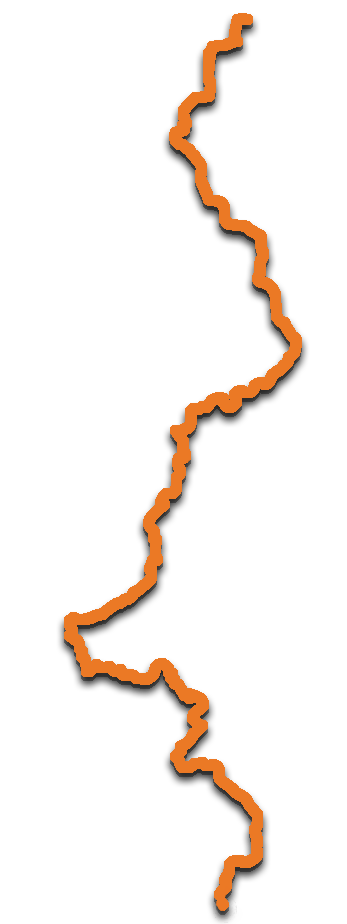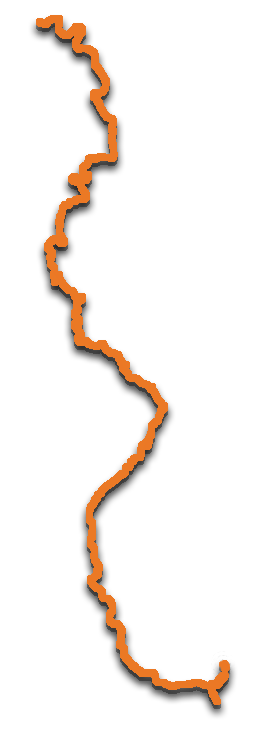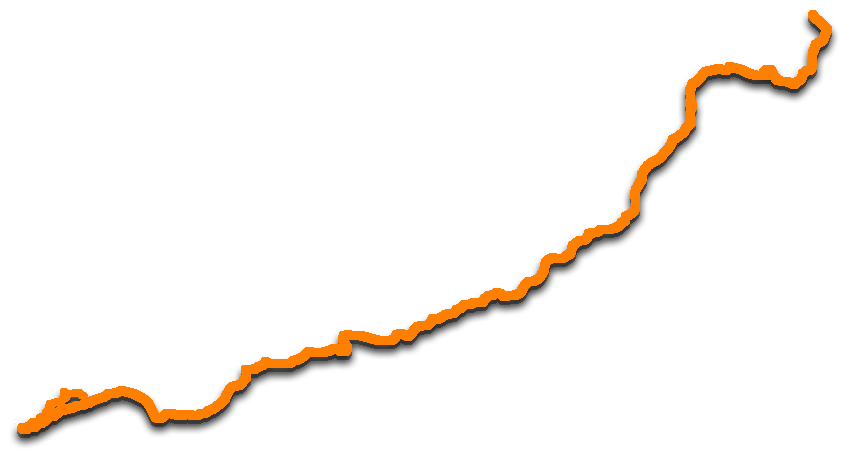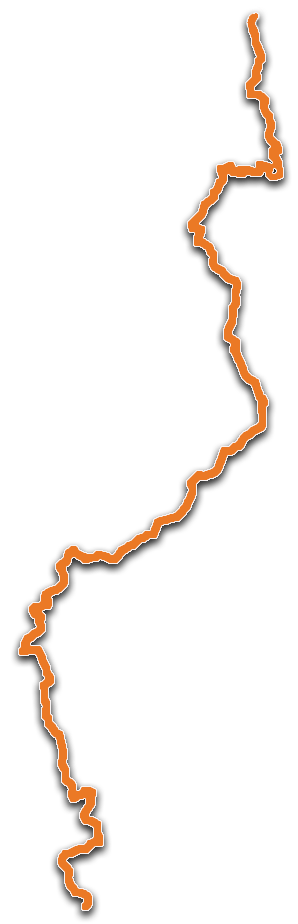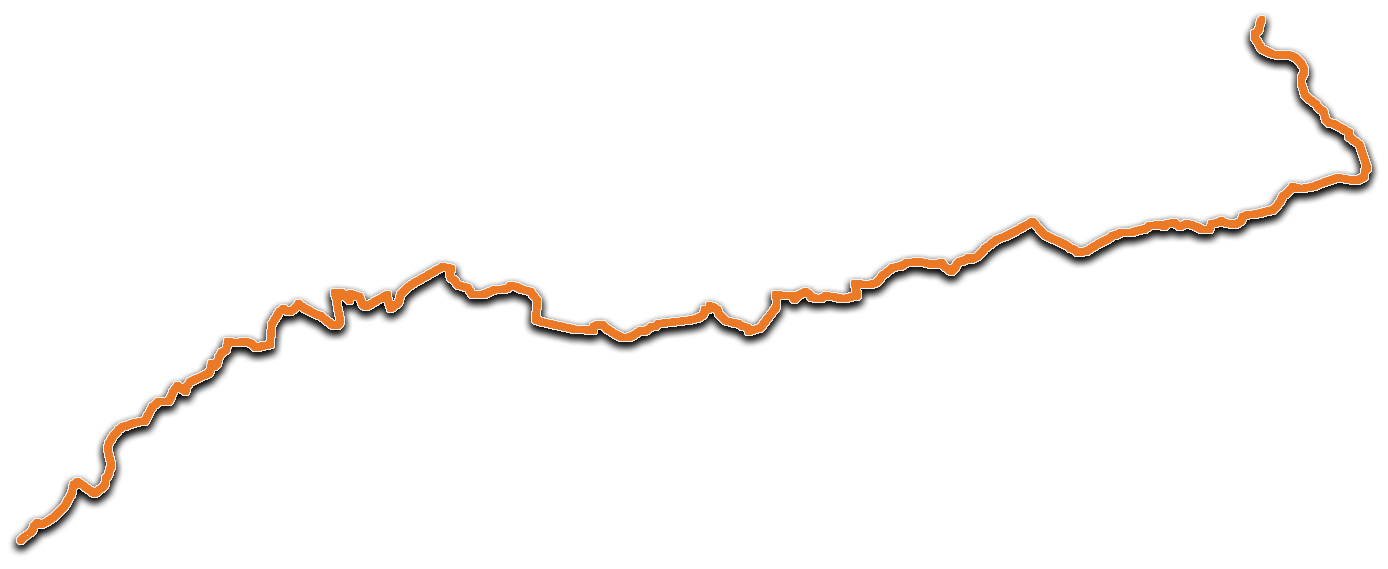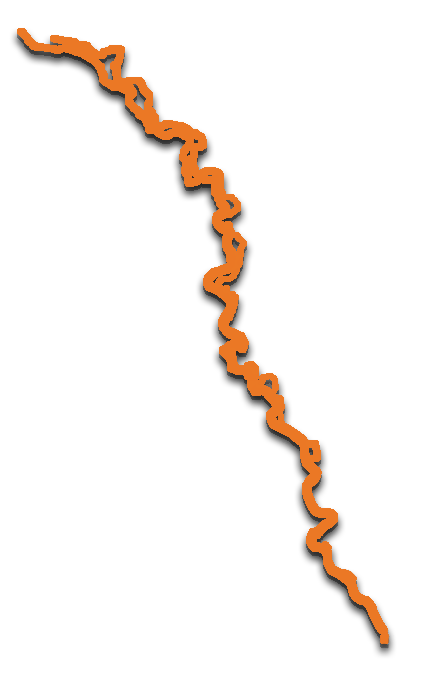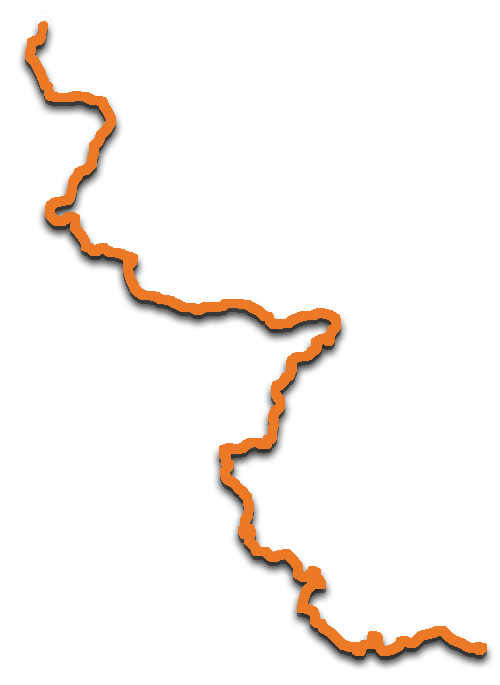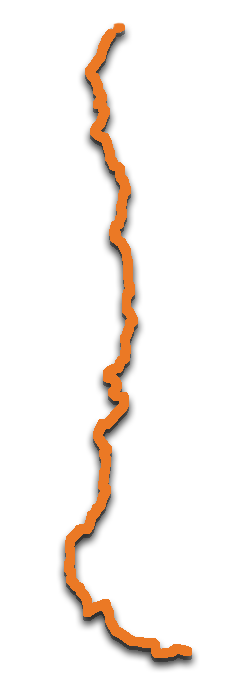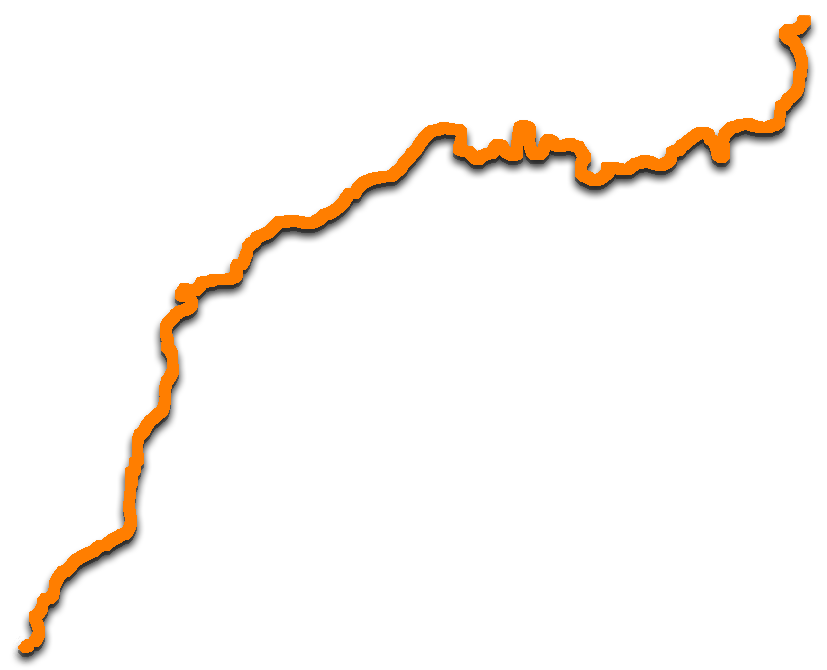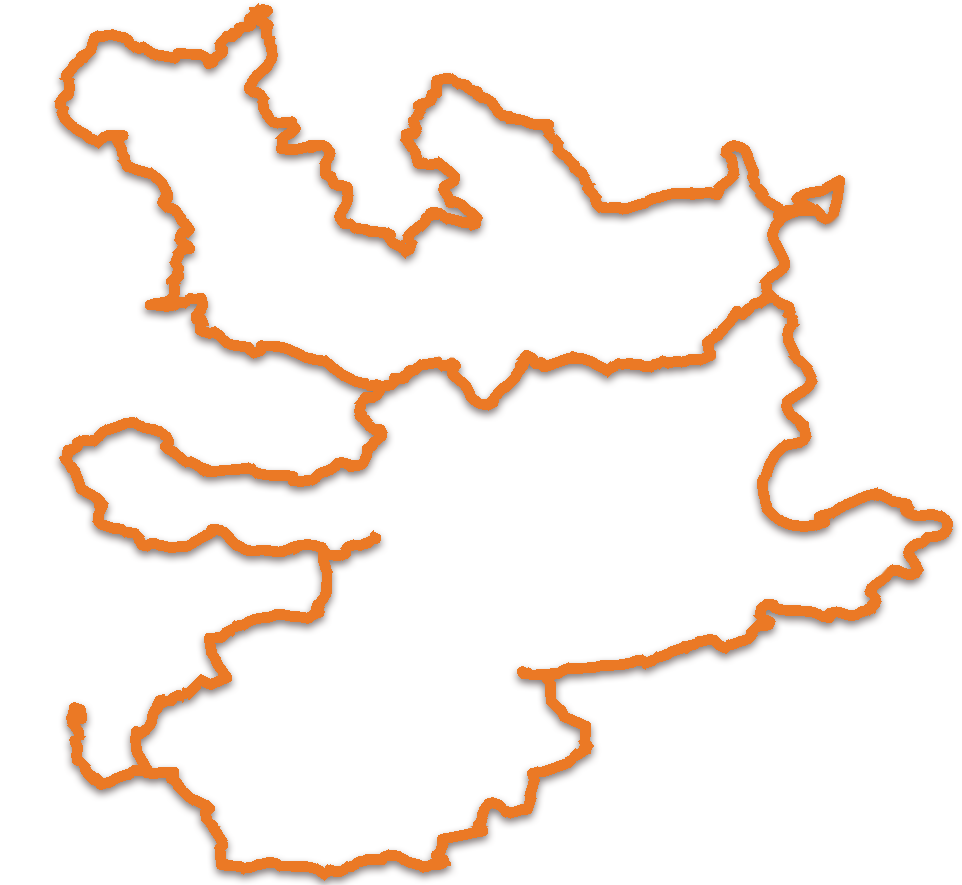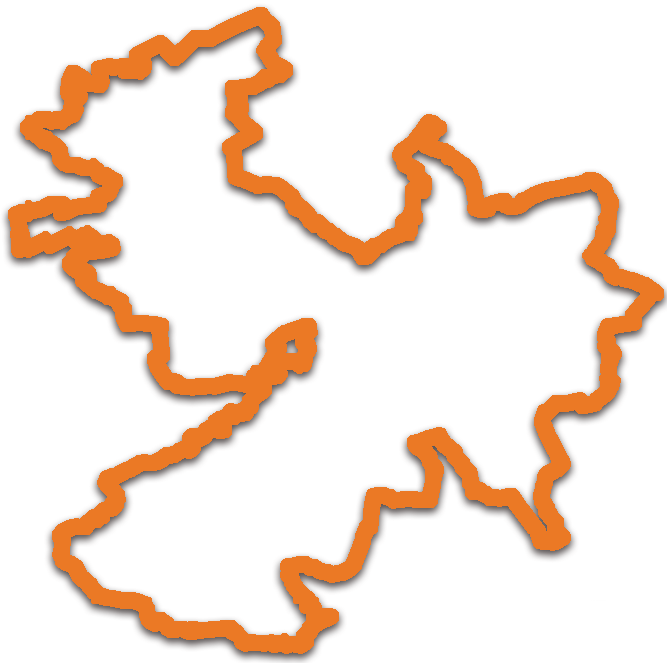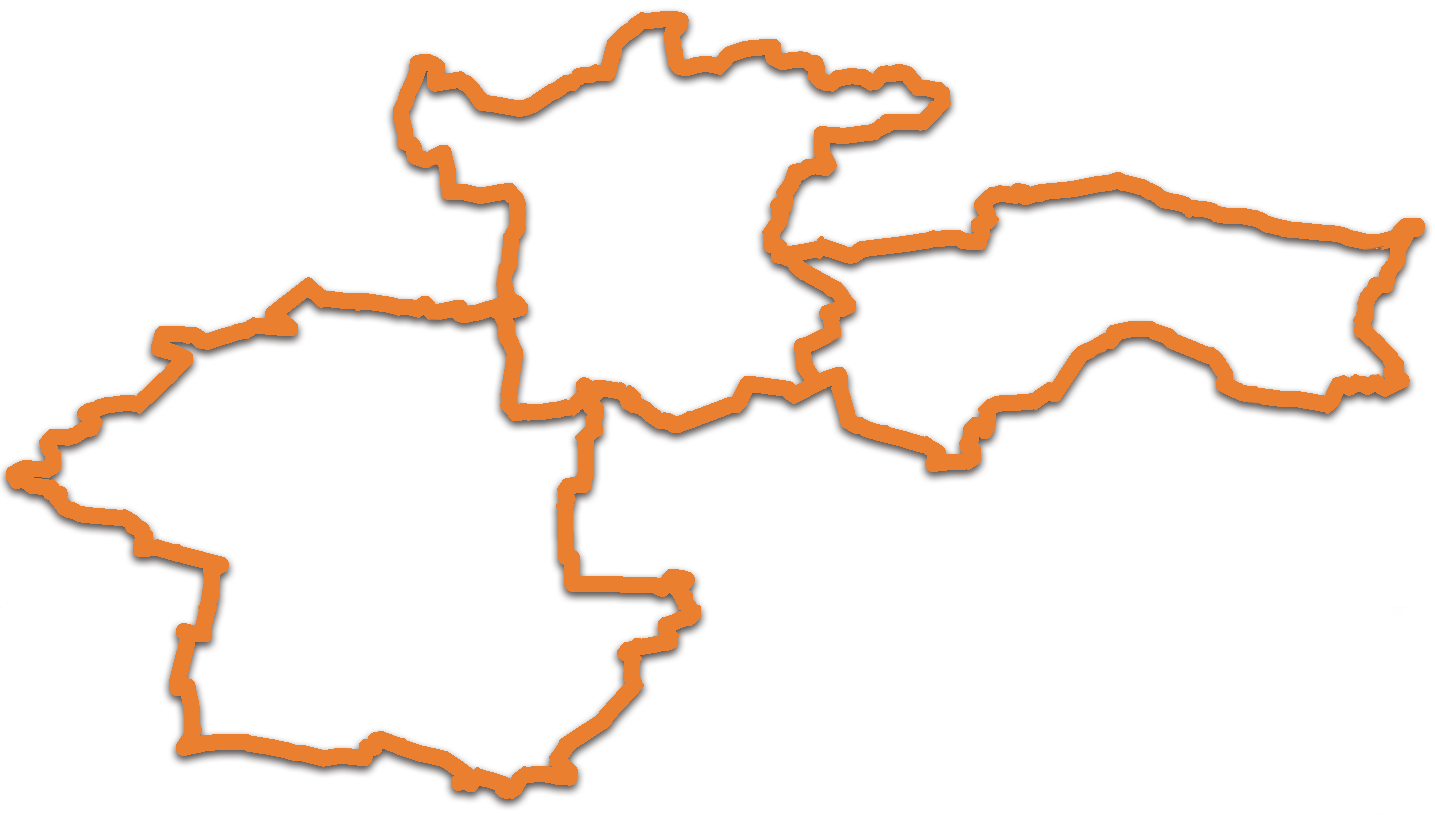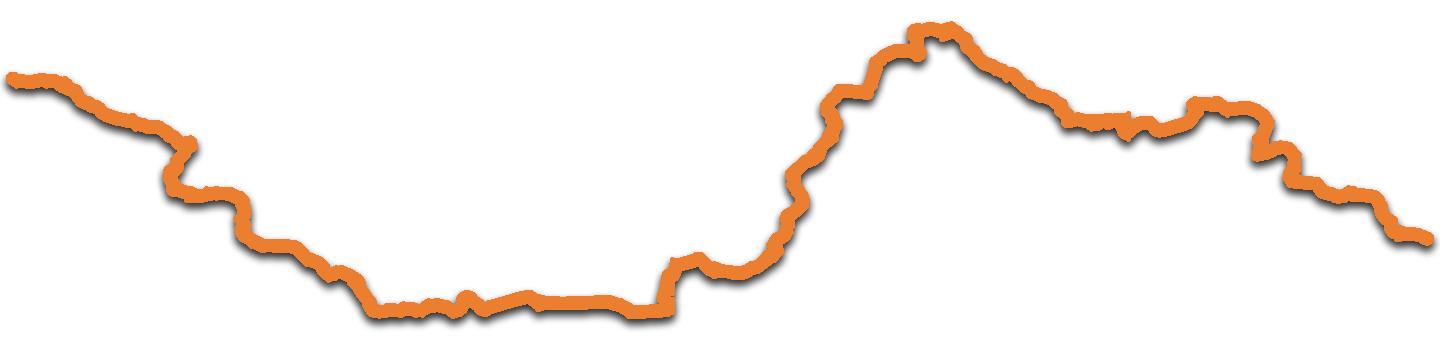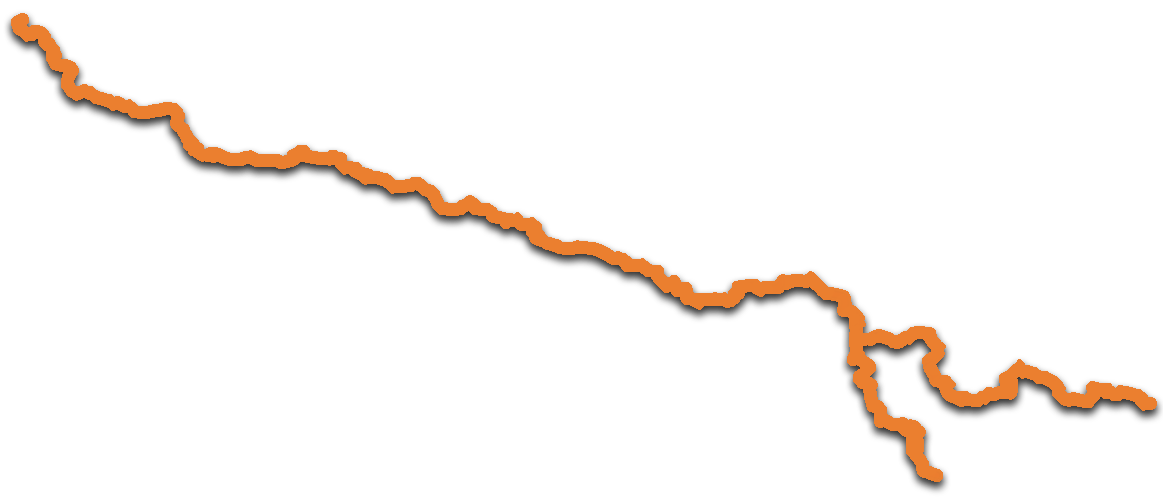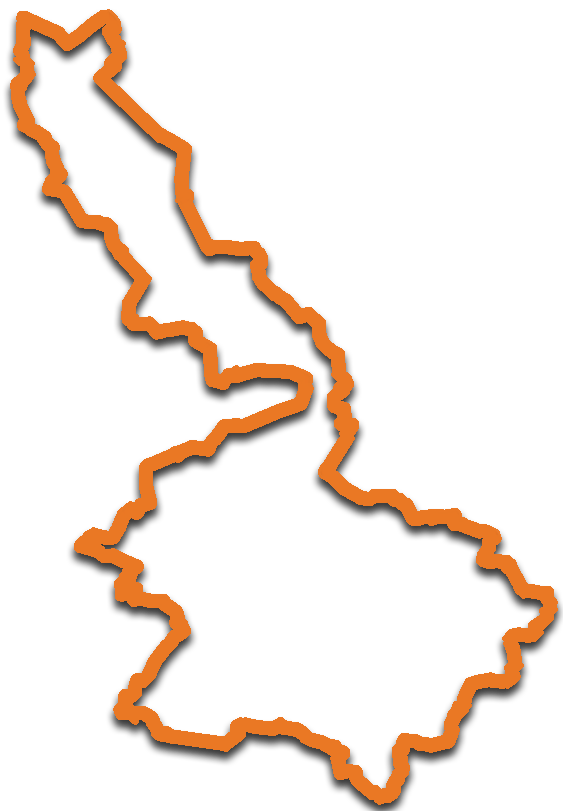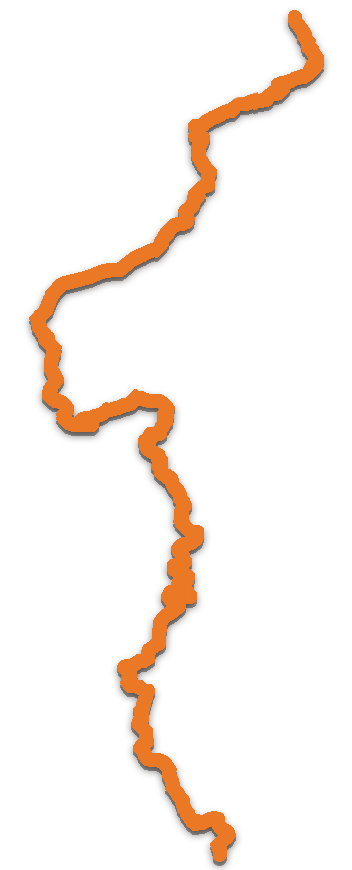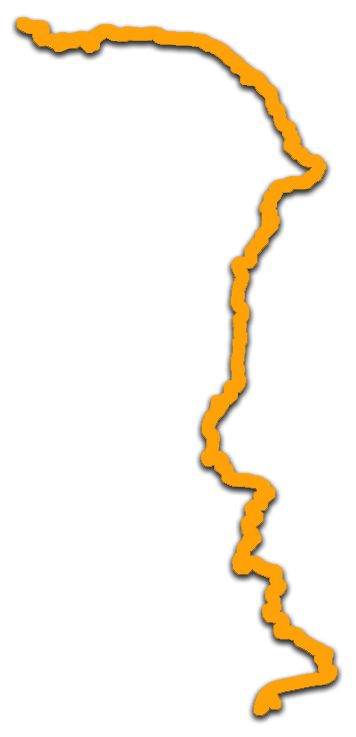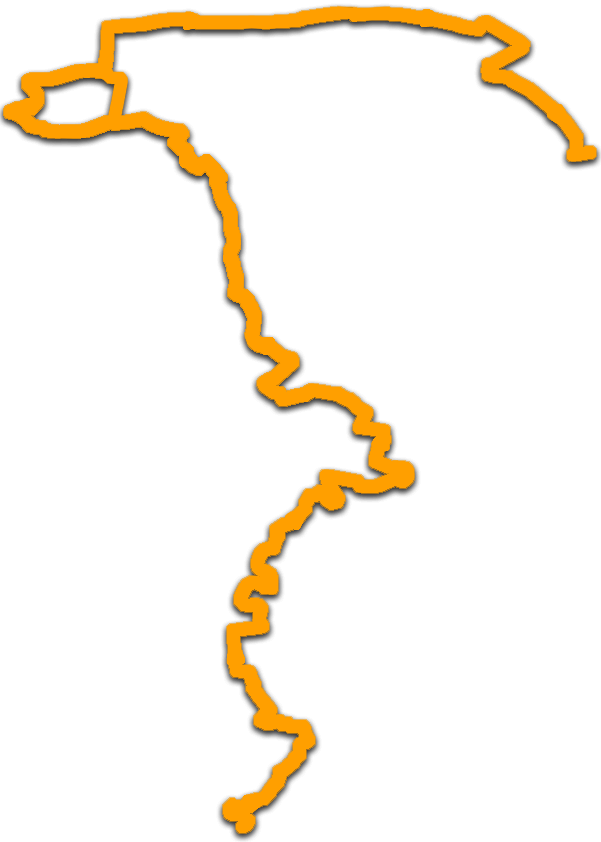LandesGartenSchau-Route
andesgartenschauen sind die kleinen Geschwister der großen Bundesgartenschauen. In Nordrhein-Westfalen finden seit 1970 in unregelmäßigen Abständen Landesgartenschauen statt. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, die Lebensqualität in den Städten zu verbessern und/oder regionalpolitische Entwicklungsziele zu verfolgen. Die 168 km lange LGS-Route verbindet als Radtour gleich sieben prachtvolle westfälische Parkanlagen, in denen einmal eine Landesgartenschau stattgefunden hat. Da jede Gartenschau unter einem anderen noch heute sichtbaren Motto stand, unterscheiden sich die kunstvoll angelegten Parks untereinander sehr stark. Jeder Park ist individuell und besonders. Blumen und Pflanzen sind aber der gemeinsame Nenner. So wird die Radtour im Sommer für Blumenliebhaber zum Genuss. Die Route beginnt im Zentrum Paderborns und verläuft über Bad Lippspringe (Ausrichter der LGS 2017) bis in den Stadtteil Schloß Neuhaus, wo im Schloss- und Auenpark 1994 die Landesgartenschau stattfand. Über den Gartenschaupark Rietberg (LGS 2008) geht es zum Flora-Westfalica-Park in Rheda-Wiedenbrück (LGS 1988), entlang der Werse zum Vier-Jahreszeiten-Park Oelde (LGS 2001) und über den Maximilianpark Hamm (LGS 1984) zum Seepark Lünen (LGS 1996).
Der Fernradweg endet schließlich in der Innenstadt von Lünen. Die Strecke ist in beiden Richtungen durch das Logo mit der stilisierten orange-roten Blume ausgeflaggt und wird von der Touristikzentrale Paderborner Land e. V. sowie vom Arbeitskreis LGS-Route betreut.
Charakteristik:
Die LandesGartenSchau-Route ist fast ausnahmslos flach und daher vom Schwierigkeitsgrad leicht. Nur zwischen Stromberg und Oelde gibt es mäßige Steigungen zu erklimmen. Gut die Hälfte der Strecke ist asphaltiert, der Rest besteht aus wasserabweisenden Schotter, der sehr gut mit dem Rad zu befahren ist. Meist führt die Wegstrecke über wenig befahrene Nebenstraßen und gut ausgebaute Feldwege und ist auch für Familien mit Kindern gut befahrbar.
Ortschaften entlang der Route
Paderborn / Bad Lippspringe / Delbrück / Rietberg / Rheda / Wiedenbrück / Oelde / Beckum / Wadersloh / Lippetal / Hamm / Bergkamen / Lünen
Paderborn
ie Universitätsstadt Paderborn ist das wirtschaftliche, kulturelle und geografische Zentrum des Paderborner Landes. In der ostwestfälischen, katholisch geprägten Großstadt prallen Geschichte und Gegenwart, Mittelalter und Hightech unmittelbar aufeinander. Paderborn entstand vor über 1200 Jahren. Nach der Unterwerfung der Sachsen ließ Karl der Große im Jahre 777 an den Quellen der Pader eine Pfalz und gleich daneben einen Dom erbauen. Hier traf er sich zwanzig Jahre später mit Papst Leo III., um seine Kaiserkrönung zu besprechen. Reste der alten Kaiserpfalz sind bis heute erhalten. Der mächtige romanisch-gotische Dom, der in seiner heutigen Form aus dem 13. Jahrhundert stammt, bestimmt die weitläufige und dennoch gemütliche Innenstadt. Das Schloss Neuhaus gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Weserrenaissance und diente einst als Residenz für die Fürstbischöfe von Paderborn. Die Innenstadt hat unter den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges stark gelitten. Es gelang dennoch, einige historische Gebäude wieder aufzubauen. So zählen das Alte Rathaus, das Gymnasium Theorianum und die Bartholomäuskapelle zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Paderborns. Und natürlich gehört auch ein Abstecher zum Paderquellsees zum Pflichtprogramm eines jeden Besuchers. Die Stadt bietet ein breites Spektrum an interessanten Museen, darunter mehrere bedeutende Kunstausstellungen. Ein besonderes musealisches Highlight ist das Heinz Nixdorf MuseumsForum, das momentan größte Computermuseum der Welt.
Sehenswertes:
Stolz, mächtig und stadtprägend steht im Zentrum Paderborns der Hohe Dom St. Maria, St. Liborius und St. Kilian. Er ist die Bischofs- und Kathedralkirche des Erzbistums Paderborn.
Ein erstes Gotteshaus wurde bereits 776 durch Karl des Großen gleich neben dessen damaliger Königpfalz erbaut. Als Karl im Jahre 799 mit Papst Leo III. hier zusammentraf, wurde dabei nicht nur Karls Ernennung zum Kaiser beschlossen, sondern auch das Erzbistum Paderborn gegründet.
Der heutige Dom entstand im Wesentlichen im 13. Jahrhundert, wobei auch Teile des Vorgängerbaus aus dem 11. und 12. Jahrhundert integriert wurden. Die dreischiffige Halle ist über 100 Meter lang und besitzt zwei Querhäuser. Das Langhaus gilt in seiner Ausführung als prägend für die gesamte Region. In der Krypta werden die Gebeine des hl. Liborius aufbewahrt. Mit einer Länge von 32 Metern gehört sie zu den größten Krypten Deutschlands. Daneben befindet sich die 1935 neu errichtete Bischofsgruft. Auffällig ist der 93 Meter hohe, wuchtige Westturm, der von zwei kleineren Rundtürmen flankiert wird. Er überragt die gesamte Innenstadt Paderborns.
Der Sakralbau beherbergt eine Vielzahl wertvoller Einrichtungsgegenstände, darunter das Paradiesportal (vor 1240), die Kanzel (1736) und das Grabmahl des Fürstbischofs Dietrich IV. von Fürstenberg (1618). Zu den sehenswerten sakralen Kunstwerken gehört der gotische Hochaltar (15. Jhd.), die Doppelmadonna (um 1480), eine mittelalterliche Piéta (um 1380) sowie zwei Relieffriese.
Das im 16. Jahrhundert entstandene berühmte Drei-Hasen-Fenster befindet sich im Kreuzgang.
Als man 1964 bei Grabungen auf die Grundmauern der Kaiserpfalz Karls des Großen stieß, handelte sich dabei um eine archäologische Sensation. Die Grundmauern der Pfalzanlage stammten sowohl aus karolingischer als auch aus ottonischer Zeit. Von hier aus wurde einst Weltpolitik betrieben. Die Mauerreste waren so gut erhalten, dass man die historischen Bausubstanz für den rekonstruierten Wiederaufbau nutzte. So kann man heute sehr gut nachvollziehen, wie die originale Kaiserpfalz damals ausgesehen hat. Die Gebäude beherbergen heute ein Museum, in dem Funde aus dem frühen Mittelalter ausgestellt werden.
Die kleine Bartholomäuskapelle an der Kaiserpfalz gilt als bedeutende kunst- und baugeschichtliche Kostbarkeit. Sie wurde 1017 durch Bischof Meinwerk im byzantinischen angelehnten Stil erbaut und gilt als die älteste Hallenkirche Deutschlands. Das Gotteshaus mit dem von Säulen getragene Gewölbe ist bis heute nahezu unverändert erhalten.
Am Zusammenfluss von Lippe, Pader und Alme steht mit dem Schloss Neuhaus eines der bedeutendsten Bauwerke der Weserrenaissance. Die prachtvolle Vierflügelanlage wird von dreigeschossigen Rundtürmen flankiert. Eine Wassergräfte umgibt das Prunkhaus.
Bereits im 11. Jahrhundert hatten die Bischöfe von Paderborn an dieser Stelle ein ‚festes Haus‘ erbauen lassen. 1370 wurde Schloss Neuhaus zur bischöflichen Residenz und blieb dieses bis zum Reichsdeputationshauptabschluss im Jahre 1803. In der Folgezeit wurde das Schloss überwiegend militärisch genutzt, bis die damalige Gemeinde Schloss Neuhaus im Jahre 1957 die gesamte Schlossanlage übernahm, die darin eine Schule unterbrachte. Als Paderborn 1994 die Landesgartenschau ausrichtete, wurde um das Schloss der so genannte ‚Schloss- und Auenpark‘ angelegt, der auch heute noch im Sommer für Open-Air-Veranstaltungen genutzt wird. Das Renaissanceschloss wird heute häufig für Hochzeiten genutzt.
Fürstbischof Clemens August ließ im 18. Jahrhundert die Wirtschaftsgebäude im barocken Stil erneuern. So entstand zwischen 1729 und 1732 der große Marstall, in dem mehr als 100 Pferde Platz fanden.
Bis 1990 wurde das Gebäude noch durch eine britische Garnison genutzt. Nach einer umfassenden Sanierung ist im Marstall heute das Historische Museum untergebracht. Neben archäologischen Fundstücken, Dokumenten und Alltagsgegenständen aus der Geschichte des Stadtteils Schloß Neuhaus geht das Museum auch besonders auf die Fürstbischöfliche Residenz sowie auf die Garnisonsgeschichte des Ortes ein. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die umfangreiche Glas- und Keramiksammlung Nachtmann. Daneben finden auch häufig Sonderausstellungen statt.
Neben dem Kirchturm des Paderborner Domes befindet sich das Erzbischöfliche Diözesanmuseum. Es ist das älteste Museum dieser Art im deutschsprachigen Raum. Bereits 1853 wurde die umfangreiche Sammlung, die aus rund 8000 Werken sakraler Kunst besteht, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Ausstellung beschränkt sich allerdings auf rund 1000 Kunstwerke, die ständig ausgestellt werden. Als wertvollste Skulptur gilt eine Madonna aus der Mitte des 11. Jahrhunderts, die eine der ältesten Madonnendarstellungen in der abendländischen Kunst darstellt. Neben der ständigen Ausstellung werden im Museum auch regelmäßig Wechselausstellungen präsentiert.
Das alte Rathaus von Paderborn wurde zwischen 1613 und 1620 im Stil der Weser-Renaissance erbaut, wobei man die Bausubstanz des Vorgängergebäudes aus dem 15. Jahrhundert mit einbezog. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Rathaus zweimal umgebaut und vergrößert. Dabei entstanden der große Saal im Obergeschoss und das repräsentative Treppenhaus. Das große Ratsgebäude bot zwischenzeitlich auch Platz für das Zollamt, die Stadtwaage, die Polizei, die Feuerwehr, die Sparkasse und für ein Museum. Nachdem das historische Gebäude im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden war, richtete man es bis 1958 wieder vollständig her. Neben dem Dom gilt das Rathaus als Wahrzeichen der Stadt Paderborn.
Das Abdinghofkloster St. Peter und Paul wurde als Benediktinerabtei im Jahre 1015 gegründet. Mehrfach fiel es während des Mittelalters bei großen Stadtbränden dem Feuer zum Opfer. Letztmalig baute man es im 12. Jahrhundert wieder auf. Nach der Auflösung des Klosters im Zuge der Säkularisierung wurden die Gebäude zunächst als Kaserne genutzt. Später übernahm die evangelisch-lutherische Gemeinde das Gotteshaus als erste protestantische Kirche im ansonsten erzkatholischen Paderborn. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Kirche und die Konventgebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Bis 1952 erfolgte der Wiederaufbau der Abdinghofkirche, die auch heute noch als Hauptkirche der evangelischen Gemeinde Paderborn dient.
Das ehemalige Abdinghofkloster wurde im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört. Auf den historischen Fundamenten wurde dann die Städtische Galerie errichtet, die im Jahre 2001 durch einen modernen Anbau erweitert wurde. Die Galerie beherbergt eine umfangreiche Sammlung von graphischen und fotographischen Arbeiten aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die in regelmäßig wechselnden Ausstellungen dem Publikum präsentiert werden.
Das Museum für sakrale Kunst zeigt die private Kollektion des Künstlers Bernd Cassau in seinem eigenen Haus. In jahrzehntelanger Sammelleidenschaft trug Cassau zahlreiche historische Kelche, Kreuze und Monstranzen zusammen, die durch eigene Werke ergänzt werden. Die würdevolle Ausstellung zeigt die bestechende Schönheit und die beeindruckende Vielfalt in der sakralen Kunst und bietet darüber hinaus einen Ort der Besinnung, der Stille und der Andacht.
Das ‚Theo‘, wie das Gymnasium in Paderborn umgangssprachlich heißt, wurde bereits 799 als Domschule gegründet und gehört damit zu den ältesten noch bestehenden Schulen Deutschlands. Es steht in unmittelbarer Nähe des Rathauses mitten in der Innenstadt. Das heutige Studiengebäude entstand zwischen 1612 und 1614 und diente bis zu 1.000 Schülern gleichzeitig als Lernort. Bedeutende Schulleiter waren der Mathematiker Reinherr von Paderborn (um 1140 – um1190) sowie der spätere Paderborner Bischof und Kardinal Thomas Oliver (um 1170 – 1227).
Paderborn bedeutet ‚Paderbrunnen‘, denn mitten in der Stadt entspringt das Flüsschen Pader. Die Quelle gehört zu den wasserreichsten in Deutschland, doch schon nach vier Kilometern mündet der Fluss bei Schloß Neuhaus in die Lippe. Obwohl diese an diesem Ort viel weniger Wasser führt, verliert die Pader bei dem Zusammenfluss ihren Namen. Damit gilt die Pader als der kürzeste Fluss Deutschlands.
Der Quellbereich der Pader besteht eigentlich aus 200 verschiedenen Einzelquellen, die rund 5000 Liter Wasser in der Sekunde ausschütten. Die Geländekante, aus der das Wasser austritt, lag anfänglich knapp außerhalb der befestigten Stadt Paderborn. Erst nach einer Erweiterung der Stadtmauer im 13. Jahrhundert wurde der Quellteich Teil der Innenstadt. Nachdem im Zweiten Weltkrieg weite Teile der Innenstadt zerstört wurden, legte man das Quellgebiet der Pader als Erholungsbereich neu an.
Das weltgrößte Computermuseum befindet sich in Paderborn und ist dem großen Sohn der Stadt, Heinz Nixdorf (1925 – 1986), gewidmet. Nixdorf war Computerpionier und Unternehmer. Er gilt als Wegbereiter der dezentralen Datenverarbeitung. Seine 1952 gegründete Computerfirma ging in der Nixdorf AG auf, die sich zum weltweit erfolgreich operierenden Elektronikkonzern entwickelte.
Das Heinz Nixdorf MuseumsForum versteht sich als lebendiger musealer Veranstaltungsort. Hier wird die 5000jährige Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnik beschrieben. Diese fand ihren Anfang in der ersten Schrift in Mesopotanien. Ausgehend von dieser Keilschrift folgt die Ausstellung der Entwicklung über den klassischen Buchdruck bis zu den Schreib- und Rechenmaschinen sowie den Registrierkassen der jüngeren Vergangenheit.
Aber hauptsächlich beschäftigt sich das Museum mit der Entwicklung des Computers. Themenschwerpunkte sind die Erfindung und der frühe Gebrauch durch Spezialisten, der Computer in Wirtschaft und Beruf und der Computer für Alle. Man wagt einen Ausblick in die globale digitale Zukunft, präsentiert eine Galerie der Computerpioniere und geht natürlich ausführlich auf das Leben und das Werk von Heinz Nixdorf ein.
Die erste Domschule wurde in Paderborn bereits 799 gegründet. Das Museum beschreibt als die über 1.200jährige Geschichte des Paderborner Schulwesens. Neben einem rekonstruiertem Klassenzimmer, das einen Eindruck vom Unterricht im Jahre 1900 vermittelt, beschäftigt sich das Museum mit der Entstehung des Schulbuches und beschreibt die Strafenvielfalt, dokumentiert alte Schulgebäude und stellt bekannte und bedeutende Lehrerpersönlichkeiten sowie berühmt gewordene Paderborner Schüler vor.
Das Adam-und-Eva-Haus stammt noch aus dem 16. Jahrhundert und gehört zu den schönsten erhaltenen Fachwerkshäusern Paderborns. Es beherbergt heute das Museum für Stadtgeschichte, das in seiner Sammlung sowohl frühgeschichtliche Funde als auch typische Gebrauchsgegenstände, Möbel und Dokumente aus der jüngeren Vergangenheit präsentiert. Die Sammlung wird komplettiert mit Gemälden und Graphiken regionaler Künstler.
Im Schlosspark von Schloss Neuhaus wurde 1825 eine Reithalle für die hier stationierte preußische Garnison erbaut. Es versprüht den reizvollen Charme eines historischen Biedermeiergebäudes und beherbergt heute eine Abteilung der Städtischen Galerie Paderborn. Hier werden regelmäßig wechselnde Ausstellungen mit Gemälden und Graphiken vornehmlich des 16. bis 20. Jahrhunderts gezeigt. Hinter der Szenerie: Der Dachdeckermord Im 17. Jahrhundert, als das prachtvolle Schloss Neuhaus als fürstliche Residenz für die Paderborner Bischöfe diente, wurden zum adligen Amüsement häufig Jagdgesellschaften gegeben. Als Bischof Ferdinand von Fürstenberg einmal zur Jagd einlud, nahm auch ein junger, offensichtlich unreifer Verwandter daran teil. Der junge Mann hatte an diesem Tage einfach kein Glück gehabt – er erlegte kein einziges Tier. Entsprechend frustriert und ungehalten traf er nach dem Halali wieder auf dem Wasserschloss ein. Da sah er einen Dachdecker, der seine Arbeit in luftiger Höhe kurz unterbrochen hatte, um den Einmarsch der zurückkehrenden Jagdgesellschaft zu beobachten. Aus seiner verärgerten Unzufriedenheit heraus zielte er kurzerhand auf den armen Handwerker, um allen Beteiligten zu beweisen, welch außergewöhnlich brillanter Schütze er doch eigentlich sei – er traf ihn tatsächlich tödlich! Als man den übermütigen Schützen verhaften wollte, entzog sich dieser auf seinem Pferd und floh im rasanten Galopp! Erst Jahre später, als er naiv glaubte, dass Gras über die Sache gewachsen war, kehrte er auf das Schloss zurück. Er nahm an, dass die Tötung eines niederen Burschen schon keine gravierende Bestrafung nach sich ziehen würde. Eine solche Kleinigkeit würde man ihm, der er ja schließlich ein höher geborener Verwandter des Bischofs war, schon nicht nachtragen – und schon gar nicht nach der nun vergangenen Zeit. Doch da irrte er sich gewaltig! Der Bischof ließ ihn festnehmen und er wurde zum Tode verurteilt. Nur wenig später wurde das Urteil auf der Wewelsburg vollstreckt. Noch heute erinnert eine liegende Steinfigur am Dachfirst des Westgiebels an den ermordeten Dachdecker.
Mehr als 120 Traktoren, davon gleich mehrere der legendäre Lanz-Bulldogs, sind im Deutschen Traktoren- und Modellauto-Museum zu bewundern. Die Ausstellung zeigt die motorisierte Entwicklung in der Landtechnik vom Dampfmaschinengerät der 1920er Jahre bis zu den Treckern der Nachkriegszeit. Daneben werden eine alte Tankstelle aus den 1920er Jahren sowie eine historische Schmiede präsentiert. Besonders beeindruckend ist die umfangreiche Sammlung von rund 10.000 Modellfahrzeugen, die PKW’s, LKW’s und – natürlich – Traktoren umfasst.
Ursprünglich diente die Grabeskirche in Jerusalem als Vorbild für die 1036 geweihte Busdorfkirche. Die beiden Rundtürme und der Westflügel blieben von diesem ersten Kirchenbau noch erhalten. Die dreischiffige Halle wurde erst Ende des 13. Jahrhunderts fertig gestellt. Kirchturm und Vorhalle stammen aus dem 17. Jahrhundert. Besondere Einrichtungsgegenstände sind ein hölzernes Kruzifix (um 1280), das Sakramentshäuschen und der Taufstein (beides Spätgotik) sowie eine Reihe von Epitaphien.
Die barocke Marktkirche wurde zwischen 1682 und 1692 als Jesuitenkirche St. Franz Xaver errichtet. Der Jesuitenorden war im späten 16. Jahrhundert nach Paderborn gekommen und hatte zunächst die Bartholomäuskirche und die später abgebrochene Johanniskirche genutzt. Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg stiftete dem Orden schließlich das neue Gotteshaus. Im Jahre 1773 jedoch wurde der Konvent aufgehoben und aus der Jesuitenkirche wurde eine katholische Pfarrkirche. Von der reichen barocken Innenausstattung sind leider nur die Kanzel und die hängende Madonna erhalten geblieben. Sie waren während des Zweiten Weltkrieges ausgelagert worden. Der Rest des Inventars ging verloren, als die Kirche bis auf die Außenmauern zerstört wurde. Bis 1958 dauerte der Wiederaufbau. Seit 2003 schmückt der rekonstruierte barocke Hochaltar wieder den Innenraum der Marktkirche.
Der Ursprung der alten Gaukirche St. Ulrich ist heute nicht mehr bekannt. Möglicherweise wurde sie im 9. Jahrhundert für Bischof Badurad erbaut, um einen von vom Volk getrennten Gottesdienst feiern zu können. Belege gibt es hierfür jedoch nicht. Im 12. Jahrhundert jedenfalls diente das Gotteshaus als Pfarrkirche für den Padergau – daher ihr Name. Vom Stil her wird eine Bauzeit um 1275 vermutet. Wahrscheinlich gab es auch bereits einen Vorgängerbau. Im Laufe der Geschichte gab es mehrere Umbauten an der Gaukirche. Die wesentlichsten Veränderungen wurden Mitte des 18. Jahrhunderts durchgeführt, als die hübsche barocke Fassade am Hauptportal entstand. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gotteshaus erheblich beschädigt. Beim Wiederaufbau erhielt der achteckige Kirchturm sein heutiges Zeltdach.
Radrouten die durch Paderborn führen:
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Kaiser-Route Aachen-Paderborn
Paderborner Land Route
Bad Lippspringe
ie Kurstadt liegt südlich des Teutoburger Waldes und an den Ausläufern des Eggegebirges an der Heidelandschaft der Senne. Hier herrscht ein ausgesprochen reizarmes Heilklima mit ausgeglichenen Feuchtigkeitswerten – so nennt sich Bad Lippspringe auch die ‚grüne Lunge Ostwestfalens‘. Bad Lippspringe ist seit 1982 ‚Staatlich anerkanntes Heilbad‘ und ‚Heilklimatischer Kurort‘. zusätzlich erhielt die Stadt 2005 das Prädikat “Premium Class“ zuerkannt. Gleich drei Kurgärten und der 240 ha große Kurwald laden zum Flanieren, Wandern und Verweilen ein. Berühmt geworden ist Bad Lippspringe durch seine verschiedenen Heilquellen, die die über 175-jährige Bad-Tradition begründeten. Zu ihnen zählen die Arminiusquelle, die Liboriusquelle und die 27,9°C warme Martinusquelle. Papst Pius X. war einst der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle. Die größte Quelle aber ist die der Lippe. Sie gehört zu den wasserreichsten Quellen Deutschlands. Der rechte Nebenfluss des Rheines beginnt hier seine 220 km lange Reise nach Westen. An der Lippequelle hielt Karl der Große im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen ab. In diesem Zusammenhang wurde der Ort erstmals urkundlich als ‚Lippiogyspringiae‘ erwähnt. Die Burg, von der heute nur noch eine Ruine im Kurpark erhalten blieb, entstammt vermutlich dem frühen 13. Jahrhundert. Um 1380 wurde die Stadtmauer um die Altstadt erbaut. Von ihr sind aber nur noch wenige Reste erhalten.
Im Jahr 2017 wird in Bad Lippspringe die Landesgartenschau stattfinden.
Sehenswertes:
 Die Ruine der Lippspringer Burg ist eines der Wahrzeichen der Kurstadt und steht heute im Kurpark gleich neben der Lippequelle. Von der einst stolzen Wasserburg, die ursprünglich aus einer Kernburg und einer Vorburg bestand, ist bis auf die Reste des Amtshauses, eine Umfassungsmauer und den historischen Burgkeller nicht mehr viel erhalten. Dort, wo früher das Hauptgebäude stand, befindet sich heute das Kongresshaus. Die Burg Lippspringe wurde 1312 erstmals erwähnt. Damals befand sich das Gemäuer im Besitz des Paderborner Domkapitels und diente als Wohnsitz für Burgmannen, die als Ritter und adlige Ministeriale Verteidigungsaufgaben für die Burggrafen erfüllten. Die Burg wurde bei verschiedenen Fehden immer wieder belagert und beschädigt. Besonders stark wurde sie im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Burg schließlich endgültig aufgegeben. Die Mauern wurden weitgehend abgetragen und die Wassergräben zugeschüttet.
Die Ruine der Lippspringer Burg ist eines der Wahrzeichen der Kurstadt und steht heute im Kurpark gleich neben der Lippequelle. Von der einst stolzen Wasserburg, die ursprünglich aus einer Kernburg und einer Vorburg bestand, ist bis auf die Reste des Amtshauses, eine Umfassungsmauer und den historischen Burgkeller nicht mehr viel erhalten. Dort, wo früher das Hauptgebäude stand, befindet sich heute das Kongresshaus. Die Burg Lippspringe wurde 1312 erstmals erwähnt. Damals befand sich das Gemäuer im Besitz des Paderborner Domkapitels und diente als Wohnsitz für Burgmannen, die als Ritter und adlige Ministeriale Verteidigungsaufgaben für die Burggrafen erfüllten. Die Burg wurde bei verschiedenen Fehden immer wieder belagert und beschädigt. Besonders stark wurde sie im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Burg schließlich endgültig aufgegeben. Die Mauern wurden weitgehend abgetragen und die Wassergräben zugeschüttet.
 Gleich neben der Burgruine im Kurpark von Bad Lippspringe befindet sich der Quellteich der Lippe, im Volksmund auch ‚Odins Auge‘ genannt. Denn glaubt man der Sage, so warf hier einst der germanische Gott Odin sein Auge in die trockene Einöde, um diese durch Wasser in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Belegt dagegen ist, dass Karl der Große hier im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen abhielt. Mit einer Schüttung von 740 Litern in der Sekunde gehört die Lippequelle zu den größten Quellen Deutschlands. Von hier aus beginnt der 220 Kilometer lange Weg des Wasserlaufes, der schließlich bei Wesel mit der Mündung in den Rhein endet.
Gleich neben der Burgruine im Kurpark von Bad Lippspringe befindet sich der Quellteich der Lippe, im Volksmund auch ‚Odins Auge‘ genannt. Denn glaubt man der Sage, so warf hier einst der germanische Gott Odin sein Auge in die trockene Einöde, um diese durch Wasser in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Belegt dagegen ist, dass Karl der Große hier im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen abhielt. Mit einer Schüttung von 740 Litern in der Sekunde gehört die Lippequelle zu den größten Quellen Deutschlands. Von hier aus beginnt der 220 Kilometer lange Weg des Wasserlaufes, der schließlich bei Wesel mit der Mündung in den Rhein endet.
Gerade einmal 25 Meter neben dem Lippequellteich befindet sich die Arminiusquelle. Die warme, rötliche Calcium-Sulfat-Hydrogen-Carbonat-Therme mit einer Temperatur von 20,5°C galt lange als Nebenquelle der Lippe, besitzt aber einen eigenständigen Wasserursprung.
 Am Rande des Kurparks befindet sich das zweistöckige, denkmalgeschützte Prinzenpalais. Es war 1855 als Kurhaus erbaut worden, diente aber zunächst als Herberge dem Herzog von Nassau, der regelmäßig in die Senne zum Jagen kam. Im Zuge der Weltausstellung ‚Expo 2000‘ richtete man im Prinzenpalais das Informations- und Dokumentationszentrum ‚Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne‘ ein.
Am Rande des Kurparks befindet sich das zweistöckige, denkmalgeschützte Prinzenpalais. Es war 1855 als Kurhaus erbaut worden, diente aber zunächst als Herberge dem Herzog von Nassau, der regelmäßig in die Senne zum Jagen kam. Im Zuge der Weltausstellung ‚Expo 2000‘ richtete man im Prinzenpalais das Informations- und Dokumentationszentrum ‚Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne‘ ein.
Gleich neben der Kirche St. Martin befindet sich das Haus Hartmann. Es beherbergt neben einem Jugendtreff auch eine heimatkundliche Ausstellung. Das vom Heimatverein betriebene Museum beleuchtet die wechselvolle Geschichte der Stadt Bad Lippspringe. Die Schwerpunkte der Ausstellung gliedern sich in fünf Abschnitte: die Erdgeschichte, Siedlungen in der Steinzeit, das Leben im Mittelalter, die jüngere Geschichte sowie die Geschichte des Bades. Ein Modell zeigt das Rathaus von 1802 und eines die Stadt, so wie sie im Jahre 1600 ausgesehen hat.
 In Bad Lippspringe gibt es gleich drei Kurparks. Der 6,2 ha große Arminuspark besitzt einen sehr alten Baumbestand und wurde 1840 in Anlehnung an Pläne des berühmten Landschaftsplaner Peter Josef Lenné angelegt. Im Zuge der ‚Expo 2000‘ wurde das Areal zu einem so genannten ‘Allergologischen Kommunikationspark‘ umgestaltet. Die Lippepromenade führt entlang des Lippequellteiches zur Burgruine. Gegenüber befindet sich die Arminiusquelle.
In Bad Lippspringe gibt es gleich drei Kurparks. Der 6,2 ha große Arminuspark besitzt einen sehr alten Baumbestand und wurde 1840 in Anlehnung an Pläne des berühmten Landschaftsplaner Peter Josef Lenné angelegt. Im Zuge der ‚Expo 2000‘ wurde das Areal zu einem so genannten ‘Allergologischen Kommunikationspark‘ umgestaltet. Die Lippepromenade führt entlang des Lippequellteiches zur Burgruine. Gegenüber befindet sich die Arminiusquelle.
Im Nordosten schließt sich direkt der 2,5 ha große Jordanpark an. In dem um 1900 angelegten waldartigen Park entspringt das kleine Flüsschen Jordan.
Im Gegensatz zum Arminiuspark und Jordanpark ist der nach Karl dem Großen benannte Kaiser-Karls-Park nicht frei zugänglich. Er wurde 1951 als Ersatzpark im Nordwesten der Stadt angelegt, da der Arminiuspark durch die britische Besatzungsmacht beschlagnahmt worden war. Ein besonderer Blickfang ist die große Wasserfontäne, die am Abend bunt angestrahlt wird. Der Park ist gärtnerisch sehr aufwändig mit farbigen Blumenrabatten, blühenden Büschen und Brunnenanlagen gestaltet. Besonders im Mai und Juni imponiert der Park, der als der Schönste der drei Kurparks gilt, mit seiner überbordenden Blütenpracht. Fahrräder sind im Kaiser-Karls-Park nicht gestattet.
Teile des Kurparkes und des angrenzenden Kurwaldes gehören zum Kernbereich der 2017 hier stattfindenden Landesgartenschau.
 Die Liborius-Heilquelle wird durch ein neugotisches Brunnenhaus eingefasst. Die schmucke Trinkhalle entstand zwischen 1905 und 1910 und fällt durch die reich gegliederte Fensterfront auf. Durch das Glasdach wirkt der innere Saal mit seinen Säulen sehr hell. Über dem Wasserauswurf der Heilquelle steht eine Statue des hl. Liborius. Der Bischof von Le Mans lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Seine Reliquien werden in Paderborn bewahrt, was zu der alten Städtefreundschaft zwischen Paderborn und Le Mans führte. Von Paderborn ging die weltweite Heiligenverehrung Liborius aus. Der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle war Papst Pius X. (1835 – 1914). Das Wappen prangt noch heute an der Front des Brunnenhauses.
Die Liborius-Heilquelle wird durch ein neugotisches Brunnenhaus eingefasst. Die schmucke Trinkhalle entstand zwischen 1905 und 1910 und fällt durch die reich gegliederte Fensterfront auf. Durch das Glasdach wirkt der innere Saal mit seinen Säulen sehr hell. Über dem Wasserauswurf der Heilquelle steht eine Statue des hl. Liborius. Der Bischof von Le Mans lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Seine Reliquien werden in Paderborn bewahrt, was zu der alten Städtefreundschaft zwischen Paderborn und Le Mans führte. Von Paderborn ging die weltweite Heiligenverehrung Liborius aus. Der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle war Papst Pius X. (1835 – 1914). Das Wappen prangt noch heute an der Front des Brunnenhauses.
Der uralte Gutshof ist schon rund 1000 Jahre alt. Bereits im Jahre 1036 taucht er in einem alten Dokument auf. Das heutige Herrenhaus wurde um 1600 erbaut. Die Wirtschaftsgebäude entstanden vom frühen 17. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert. Das landwirtschaftliche Anwesen befindet sich auch heute im privaten Besitz und kann daher nicht besichtigt werden.
Radrouten die durch Bad Lippspringe führen:
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Paderborner Land Route
Delbrück
n der flachen Landschaft zwischen Lippe und Ems liegt Delbrück. Sie ist die zweitgrößte Stadt im Kreis Paderborn. Neben der Kernstadt besitzt Delbrück neun Stadtteile und wirbt daher mit dem Slogan ‚Zehn Orte – eine Stadt‘. Erste Siedlungsspuren lassen bereits auf eine Besiedlung vor 3000 Jahren schließen. In Anreppen befand sich einst ein römisches Versorgungslager, in dem kurzzeitig bis zu 6000 Soldaten stationiert waren. Delbrück selber wurde im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt und besaß bereits im 15. Jahrhundert weitreichende politische und wirtschaftliche Freiheiten. Das Wahrzeichen ist der schiefe Turm der romanischen Kirche St. Johannes Baptist. Auffällig ist die erhaltene historische Ringbebauung um die zentrale Pfarrkirche. Die Stadt ist Namengeberin für das Delbrücker Land, einem Paradies für Radfahrer. Die platte Landschaft besitzt eine maximale Höhendifferenz von insgesamt nur 37 Metern und bietet zehn kleinere und mit der 33 km langen Spargelroute und dem 45 km langen Kapellenweg zwei längere Radtouren an.
Sehenswertes:
Der schiefe Kirchturm der katholischen Pfarrkirche Johannes Baptist ist das Wahrzeichen der Stadt Delbrück. Die hölzerne Turmspritze hat sich witterungsbedingt im Laufe der Jahrhunderte beträchtlich geneigt.
Das Gotteshaus entstand als massive Wehrkirche um 1180. Möglicherweise stand hier bereits ein Vorgängerbau an gleicher Stelle. 1340 erhielt der romanische Bau ein gotisches Schiff und einen gotischen Chor. Der Turmhelm entstand gegen 1400.
Die bedeutendsten Kirchenschätze stammen zumeist aus der Zeit des Barock, wie der Hochaltar, die Doppelmadonna und die Figur der hl. Agatha. Dagegen wurde die wertvolle Pietà bereits gegen 1400 erschaffen.
Auffällig ist die erhaltene historische Kirchenringbebauung um die zentrale Pfarrkirche. Die Fachwerkgebäude stammen alle aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Das Pfarrhaus wurde 1716 nach Pläne des berühmten Barockbaumeisters Johann Conrad Schlaun (1695 – 1773) erbaut. Das Fachwerkgebäude mit dem Mansardendach befindet sich knapp außerhalb der Kirchringbebauung.
Am Kirchplatz, mitten im Städtchen Delbrück, steht das Heimathaus. Der hiesige Heimatverein zeigt in zwei Räumen Gegenstände und Dokumente aus der Geschichte Delbrücks, darunter historische Trachten und alte Fahnen. Außerdem unterhält der Karnevalsverein ‚Eintracht‘ hier im Gebäude ein eigenes Museumsstübchen und auch die ‚Johannes-Schützenbruderschaft‘ zeigt in seinem Schützenzimmer eine kleine Ausstellung.
Im oberen Stockwerk des Feuerwehr-Gerätehauses im Stadtteil Ostenland hat der Heimatverein ein kleines Museum eingerichtet. Neben geologischen Fundstücken werden in der Ausstellung heimatkundliche Gegenstände, Trachten und Dokumente aus der Geschichte der ehemals selbstständigen Gemeinde Ostenlands präsentiert. Das Museum kann nur auf vorherige Anfrage besichtigt werden.
Die romanische Gewölbebasilika in Boke stammt vermutlich aus dem 12. Jahrhundert. Sie beherbergt die Reliquien des hl. Landelin von Crespin, dem auch die Kirche geweiht ist. Landelin von Crespin lebte im 7. Jahrhundert und war Klostergründer und Abt im Hennegau. Wahrscheinlich stand zuvor an der Position der heutigen Kirche bereits zuvor ein Vorgängerbau. Im Inneren der Bruchsteinkirche wurden in den 1960er Jahren Fresken freigelegt, die noch aus romanischer Zeit stammen. Zu der Ausstattung gehört ein Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, eine Pietà (um 1430), ein Sandsteinrelief (um 1560), eine Doppelmadonna (um 1700) und die barocke Orgel. Die älteste Glocke wurde im Jahre 1669 gegossen.
Der auch kurz ‚Boker Kanal‘ genannte Wasserlauf ist ein 1853 fertig gestellter künstlicher Bewässerungskanal. Er gilt als wichtiges Kulturdenkmal Ostwestfalen und führt über 32 Kilometer von Schloß Neuhaus durch die Boker Heide bis auf die Höhe von Lippstadt. Dabei verläuft er parallel zur Lippe, die den Kanal auch mit Wasser versorgt. 16 immer noch funktionsfähige Wehre regulieren den Wasserstand des Kanals. Drei Überführungen leiten den Wasserweg über natürliche Flussläufe. Ziel beim Bau des Kanals war, die sandig-karge und trockene Heidelandschaft für die Landwirtschaft zu kultivieren. Die historischen Wasser-Entnahmerechte besitzen auch heute noch ihre Gültigkeit, obwohl der Boker-Heide-Kanal inzwischen fast nur noch der Grundwasserregulierung dient.
Direkt am südlichen Ufer der heutigen Lippe bei Anreppen befand sich einst ein 23 ha großes Römerlager. Es beschrieb die Form eines unregelmäßigen Längsovals und wurde 1968 wiederentdeckt. Eine Holz-Erde-Mauer diente der Befestigung. Zusätzlich wurde das Lager von Gräben gesichert. Man nimmt an, dass es sich bei dem Lager um eine Versorgungsbasis handelte, denn neben dem Kommandohaus, einigen repräsentativen Wohngebäuden, einer Therme und den Mannschaftsunterkünften konnten ungewöhnlich viele Vorratsspeicher nachgewiesen werden.
Vermutlich war das Lager Anreppen nicht sehr lange in Betrieb. Es wurde römischen Quellen zufolge im Jahre 4 n. Chr. erbaut, wobei wohl bereits zuvor an gleicher Stelle eine militärische Anlage bestand. Wahrscheinlich wurde das Lager bereits im Jahre 9 n. Chr. nach der vernichtenden Niederlage der Römer gegen die Germanen in der Varusschlacht wieder aufgegeben. Zwischenzeitlich waren hier rund 6000 Soldaten stationiert.
Ein archäologischer Lehrpfad führt von der Informationshütte aus zu den ehemaligen Bauten des Römerlagers.
Die vermutlich aus fränkisch-sächsischer Zeit stammende mittelalterliche Wallanlage wurde 1867 bei Grabungen wiederentdeckt. Die Fliehburg besaß einen rechteckigen Grundriss von 65 x 90 m und hatte im Westen einen durch einen Graben geschützten Zugang.
Auf einer Fläche von 8 ha werden im privat geführten Tierpark Nadermann in modernen Tiergehegen rund 650 Tiere aus allen Erdteilen präsentiert, darunter verschiedene Raubtierarten, wie Löwen, Jaguare, Geparde und Ozelote, und Kamelarten, wie Dromedare und Trampeltiere. Innerhalb des Zoos stellt ein Kamel-Museum das Leben und die Lebensräume dieser gemütlichen Tiergattung näher vor. Sehr beliebt bei den Kindern ist der Streichelzoo und die verschiedenen Fahrgeschäfte, die den aufregenden Zoobesuch abrunden.
Das Gastliche Dorf besteht aus mehreren Bauernhöfen aus dem 16. und 18. Jahrhundert. Sie wurden an ihren ursprünglichen Standorten abgebaut und hier wieder originalgetreu wiederhergestellt, wo sie gemeinsam mit einem Backhaus und einer Hirtenkapelle ein bemerkenswertes Ensemble darstellen. Das Gelände besitzt einen hübschen Bauerngarten und lädt sowohl zu einem kleinen Rundgang als auch zum Verweilen in einer Kaffeestube oder im Biergarten ein.
Die romanische Gewölbebasilika wurde vermutlich im 12. Jahrhundert als Nachfolgekirche eines älteren Gotteshauses erbaut. Im späten 19. Jahrhundert wurde die Bruchsteinkirche um ein Querhaus und einen Chor mit Apsis erweitert. Bei Renovierungen in den 1960er Jahren entdeckte man im Bereich des Südportals Wand- und Gewölbemalereien, von denen sich allerdings nur Fragmente erhalten hatten. Zu der Ausstattung gehört ein romanischer Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, eine Pietà (um 1430), ein Sandsteinrelief, das Jesu im Grab darstellt (um 1560), eine Doppelmadonna mit Strahlenkranz (um 1700) sowie eine barocke Orgel.
Im südlichen Querhaus werden in einem goldenen Schrein die Reliquien des hl. Landelinius bewahrt.
Radrouten die durch Delbrück führen:
EmsRadweg
Römer-Lippe-Route
LandesGartenSchauRoute
Paderborner Land Route
Rietberg
er staatlich anerkannte Erholungsort liegt am Oberlauf der Ems. Aufgrund seiner sieben Stadtteile wählte man den Slogan ‚Siebenmal sympathisch‘. Die ‚Stadt der schönen Giebel‘ besitzt einen wunderschönen historischen Stadtkern mit zahlreichen liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern. Das Wahrzeichen der Stadt ist das mitten im Zentrum stehende Rathaus. Rietberg war einst Landeshauptstadt und Grafschaftsresidenz. Der bekannteste Landesvater war Fürst Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (1711 – 1794), gleichzeitig Staatskanzler der österreichischen Kaiserin Maria Theresia und Gründer des österreichischen Staatsrats. Im Jahre 2008 hatte Rietberg die Landesgartenschau ausgerichtet. Der Gartenschaupark mit der größten spielbaren Freiluftorgel Europas, einem Hochseilgarten und mehreren Spiellandschaften ist auch heute noch ein beliebter Ausflugsort. Ein berühmter Sohn der Stadt ist der Künstler und Kunsthistoriker Wilfried Koch. Ihm sind die Ausstellung im Kunsthaus sowie ein Skulpturengarten gewidmet. Mit den Rietberger Emsniederungen, dem Emssee und den Rietberger Fischteichen befinden sich gleich mehrere bedeutende Naturschutzgebiete auf dem Gemeindegebiet, in denen viele bedrohte Vogelarten ihr Zuhause gefunden haben.
Für Radler ist die ländliche Umgebung Rietbergs ein Paradies. Mehrere Rundtouren, die jeweils am Rathaus beginnen, führen in das grüne Umland der beschaulichen Stadt.
Sehenswertes:
Der 1929 in Duisburg geborene Künstler Wilfried Koch lebt seit 1971 in Rietberg. Zu seinem Werk gehören über 1000 Portraits, zahlreiche Zeichnungen, Gemälde und Bronzeskulpturen. Als Kunsthistoriker erwarb er sich einen bedeutenden Ruf. Seine Bücher über Baustilkunde gelten als Standartwerke für Architekten und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Darüber hinaus machte er sich auch als professioneller konzertanter Flötist einen Namen. In einem schmucken Ackerbürgerhaus aus dem Jahre 1767 wird das malerische und zeichnerische Werk Kochs in wechselnden Ausstellungen gezeigt. In dem Museum finden auch kleinere Veranstaltungen, wie Vorträge, Lesungen und Konzerte statt.
2007 erwarb die Stadt Rietberg den Klostergarten des ehemaligen Franziskanerklosters und richtete dort einen Skulpturenpark mit Werken des ortsansässigen Künstler Wilfried Koch ein. Noch bis 1975 hatte dieser den Franziskanermönchen gedient und fiel danach in einen Dornröschenschlaf. Heute stehen hier 11 Bronzeskulpturen von Koch. 8 weitere seiner Plastiken stehen im Garten des nicht weit entfernten Kunsthauses. Der 1929 geborene Künstler Willfried Koch lebt seit 1971 in Rietberg. Zu seinem Werk gehören über 1000 Portraits, zahlreiche Zeichnungen und Gemälde. Seit 1982 betätigt er sich verstärkt auch als Bildhauer. Als Kunsthistoriker erwarb er sich einen bedeutenden Ruf. Seine Bücher über Baustilkunde gelten als Standartwerke für Architekten und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und besitzen eine Gesamtauflage von über 1 Million Exemplaren. Wilfried Koch ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste.
Im Jahre 2008 fand in Rietberg die Landesgartenschau statt. In einem 40 ha großen Park entstand ein Blumen-, Blüten-und Gartenparadies mit Themengärten, Mitmachelementen, Spiellandschaften und Spielplätzen für Kinder, einem Hochseilklettergarten, einem Fitnessparcours und zwei Veranstaltungsstätten. Hier steht die größte spielbare Freiluftorgel Europas und zwei Seen bieten mediterrane Strandatmosphäre. Das Areal zieht sich vom Süden der Stadt zum historischen Stadtkern und entlang der Rietberger Emsniederung bis nach Neuenkirchen.
2011 wurde der Klimapark Rietberg eröffnet. Das Informations- und Technologiezentrum bietet interessante Informationen zum Thema Klimaschutz, Klimawandel und Klimaanpassung.
Fahrräder dürfen leider nicht auf das Gelände.
Das Wahrzeichen der Stadt ist das Rathaus. Es steht mitten in der historischen Altstadt und wurde 1805 als zweistöckiges Fachwerkgebäude erbaut. Der markante geschlossene Treppenaufgang wurde 1915 ergänzt. Das baufällige Gebäude wurde allerdings 1977 abgetragen und danach in ursprünglicher Form wiederaufgebaut.
Das Langhaus der dreischiffigen Hallenkirche ist noch gar nicht so alt. Es entstand erst 1896 im neugotischen Stil. Dagegen blieben der mittelalterliche Westturm sowie der Chor noch vom Vorgängerbau erhalten. Sehenswerte Einrichtungsgegenstände in der katholischen Pfarrkirche sind der ehemalige Hochaltar und die Figuren Maria und Johannes (um 1720), die Kanzel aus dem frühen 18. Jahrhundert und der Taufstein von 1515.
Das um 1626 erbaute Fachwerkgebäude diente ursprünglich als Hofbeamtenhaus. Hier erblickte der bekannte Barockbaumeister Franz Christoph Nagel (1699 – 1764) das Licht des Lebens. Später diente das stattliche Gebäude als Brauerei, Gasthof und Posthalterei, ehe es 1903 zur evangelischen Kirche umgebaut wurde.
In einem hübschen Ackerbürgerhaus in der Altstadt von Rietberg befindet sich heute das Heimathaus. Das Fachwerk-Dielenhaus, in dem die originale Raumaufteilung noch erhalten geblieben ist, besitzt zur Straße hin eine für die Stadt typische Utlucht. Eine Utlucht (auch Auslucht) ist ein bis zum Boden reichender Erker an der Gebäudefront. Das Heimatmuseum präsentiert eine umfangreiche Vogelsammlung sowie typische Beispiele der westfälisch-ländlichen Wohnkultur im 19. Jahrhundert. Das historische Gebäude wird teilweise noch als privates Wohnhaus mitbenutzt.
Noch bis zum Jahre 1979 waren die Klostergebäude mitsamt der Kirche St. Katherina durch die Franziskaner genutzt worden. Die Klosterkirche wurde zwischen 1618 und 1629 auf dem Platz einer alten Burg im gotischen Stil erbaut und 1725 noch einmal erweitert. In der Krypta sind die Mitglieder des Grafenhauses Kaunitz – Rietberg beigesetzt. Sehenswert sind der Hochaltar von 1629 sowie die für Franziskanerkirchen typischen Seitenaltäre. Der Großteil des Inventars, wie der kunstvolle Orgelprospekt und das barocke Chorgestühl stammt aus dem 18. Jahrhundert. Auch der außerhalb der Kirche befindliche Kreuzgang stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert, ist aber heute durch eine Trennmauer unterbrochen. Die Klostergebäude werden gegenwärtig durch das Jugendwerk der katholischen Kirche genutzt, die ehemalige Klosterkirche dient der katholische Gemeinde als Gotteshaus.
Die stolze Dreiflügelanlage wurde 1743 als Lateinschule errichtet. Das Gebäude ist eines der ältesten und hübschesten Häuser der Stadt Rietberg. Nach einer grundlegenden Sanierung wird es heute als Bibliothek genutzt.
Das Herrschaftliche Haus entstand zwischen 1744 und 1746 als zweistöckige Dreiflügelanlage im barocken Stil. Das stattliche gelb verputzte Gebäude diente als Sitz der gräflichen Regierung und als Wohnstätte für den höchsten Verwaltungsbeamten der Grafschaft. Im Vorgängergebäude hatte sich die gräfliche Münzprägestätte befunden, denn Rietberg war vor 400 Jahren das Münzrecht verliehen worden.
An der Auffahrt des inzwischen abgetragenen Schlosses entstand zwischen 1747 und 1753 die Johanneskapelle. Das gräflich gestiftete weißverputzte Gotteshaus gehört zu den bedeutendsten spätbarocken Zentralbauten Westfalens. Der Brückenheilige St. Johannes von Nepomuk, dem die Kapelle 1748 geweiht wurde, wird seit dem 18. Jahrhundert auch als Patron der Grafschaft Rietberg verehrt.
Das Rietberger Drostenhaus entstand um 1640. Das hübsche Fachwerkhaus wurde aber seitdem mehrfach verändert, erweitert und erneuert. Die letzte umfangreiche Renovierung hatte 1951 stattgefunden. Doch Anfang des Jahrtausends war das einst stolze Patriziergebäude stark heruntergekommen und musste daher erneut von Grund auf renoviert werden. Nachdem die rund 1.700 m² große Gartenfläche im Jahre 2008 nach barocken Vorbildern wieder neu angelegt worden war, wurde ein Jahr später auch das Drostenhaus wieder bezugsfertig. Der Drostengarten ist öffentlich zugänglich. Das historische Gebäude wurde im Laufe seiner Geschichte von zwei Drosten sowie mehreren hochrangigen Beamten bewohnt.
Das Bibeldorf der evangelischen Kirchengemeinde versteht sich als pädagogischer und erlebnisorientierter Lernort. Hier soll der Besucher die Welt der Bibel und das alltägliche Leben zur Zeit der Bibelentstehung hautnah selber erfahren. Das Bibeldorf mit seinem Freilichtmuseum zählt alljährlich über 10.000 Gäste.
In einem 1845 errichteten schmucken Fachwerkhaus im Rietberger Stadtteil Mastholt ist seit 1990 ein kleines Heimatmuseum eingerichtet. Zuvor war das Gebäude durch Mitglieder des Heimatvereins und durch Mastholter Bürger grundlegend saniert worden. Das Museum zeigt typische Beispiele der früheren ländlichen Wohnkultur. Im Außenbereich vermitteln die Remise, der Ziehbrunnen, der Brotbackofen, ein typischer westfälischer Bauerngarten und das stille Örtchen einen Eindruck vom damaligen Leben. Das Museum ist nur auf Voranmeldung zu besichtigen.
Radrouten die durch Rietberg führen:
EmsRadweg
LandesGartenSchauRoute
Radroute Historische Stadtkerne
Rheda
heda-Wiedenbrück ist eine Doppelstadt im östlichen Westfalen, die im Jahre 1970 durch die Zusammenlegung der vormals selbstständigen Städte Rheda und Wiedenbrück entstand. Die Ems verbindet beide Stadtteile. In der Emsaue zwischen Rheda und Osnabrück fand 1988 die Landesgartenschau statt. Heute wird der frei zugängliche Landschaftspark ‚Flora-Westfalica-Park’ genannt. Der Stadtteil Rheda wird geprägt durch sein prächtiges Wasserschloss. Der älteste Teil des auf einem großen Erdhügel errichteten fürstlichen Anwesens ist der wuchtige romanische Torturm, der noch aus der Stauferzeit stammt. Danach haben mehrere Epochen, wie Renaissance und Barock, ihre baulichen Spuren hinterlassen. Leider sind im Zuge der baulichen Neugestaltung der des Zentrums Anfang der 1970er Jahre einige historische Bauten unwiederbringlich verloren gegangen. Dennoch blieben einige schmale Gässchen abseits des Verkaufstreibens mit Fachwerkhäuschen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert im ursprünglichen Zustand erhalten.
Sehenswertes:
 Die fürstliche Residenz Schloss Rheda gehört zu den schönsten Wasserschlössern Westfalens. Das Anwesen wurde auf einem riesigen aufgeschütteten Erdhügel, einer Motte, errichtet. Die Bausubstanz entstammt verschiedenen Epochen. Der wuchtige ehemalige Torturm beherbergt eine Doppelkapelle und stammt noch aus der Stauferzeit. Nach 1400 wurde der ‚lange Turm’ im Osten der Anlage errichtet. Der südliche Flügel mit der zum Innenhof offenen Galerie wurde im Renaissancestil erbaut. Die daneben liegende Torhalle entstammt dem 18. Jahrhundert, wie auch der repräsentative Haupttrakt in seinen zurückhaltenden barocken Formen. Das Schloss wird noch heute von der Fürstenfamilie zu Bentheim-Tecklenburg bewohnt, ist aber im Zuge von Gruppenführungen zu besichtigen. Dabei werden auch der Weiße Saal und die Tapetenzimmer im Barocktrakt sowie das Spielzeug- und Kutschenmuseum gezeigt. Die Orangerie im Schlosspark steht für standesamtliche Trauungen zur Verfügung und kann, ebenso wie die Schlossmühle, für Veranstaltungen angemietet werden. In der Schlossmühle befindet sich heute ein Café.
Die fürstliche Residenz Schloss Rheda gehört zu den schönsten Wasserschlössern Westfalens. Das Anwesen wurde auf einem riesigen aufgeschütteten Erdhügel, einer Motte, errichtet. Die Bausubstanz entstammt verschiedenen Epochen. Der wuchtige ehemalige Torturm beherbergt eine Doppelkapelle und stammt noch aus der Stauferzeit. Nach 1400 wurde der ‚lange Turm’ im Osten der Anlage errichtet. Der südliche Flügel mit der zum Innenhof offenen Galerie wurde im Renaissancestil erbaut. Die daneben liegende Torhalle entstammt dem 18. Jahrhundert, wie auch der repräsentative Haupttrakt in seinen zurückhaltenden barocken Formen. Das Schloss wird noch heute von der Fürstenfamilie zu Bentheim-Tecklenburg bewohnt, ist aber im Zuge von Gruppenführungen zu besichtigen. Dabei werden auch der Weiße Saal und die Tapetenzimmer im Barocktrakt sowie das Spielzeug- und Kutschenmuseum gezeigt. Die Orangerie im Schlosspark steht für standesamtliche Trauungen zur Verfügung und kann, ebenso wie die Schlossmühle, für Veranstaltungen angemietet werden. In der Schlossmühle befindet sich heute ein Café.
Geschichtlicher Ablauf
|
11.Jhd. |
Auf einer riesigen Motte wird eine Burg zur Sicherung des Emsüberganges errichtet. |
|
12./13. Jhd. |
Das Anwesen kam an den Edelherren Bernhard II. zur Lippe. Dessen Sohn Hermann II. zur Lippe baut die Burg zur Familienresidenz aus. Der romanische Torturm mit seiner Doppelkapelle stammt noch aus dieser Zeit. |
|
1365 |
Durch Heirat fällt die Burg dem Haus Tecklenburg zu. Rheda wurde nur als Nebensitz genutzt. |
|
Nach 1400 |
Bau des Wohnturmes, auch ‚langer Turm’ genannt, im Osten der Anlage. |
|
16. Jhd. |
Graf Konrad von Tecklenburg führt die protestantische Lehre in Rheda ein. |
|
1557 |
Die Grafen von Bentheim erben die Herrschaft Rheda. |
|
17. Jhd. |
Ausbau des Schlosses zur gräflichen und später fürstlichen Residenz durch die Familie Bentheim-Tecklenburg. Der südliche Renaissanceflügel entsteht mit der offenen Galerie zum Innenhof und dem doppelgeschossigen Erker. |
|
1719 |
Bau der Torhalle zwischen Stauferkapelle und dem Renaissanceflügel. Dieses Tor löste den vorherigen Haupteingang unterhalb der Kapelle ab, der daraufhin zugemauert wurde. |
|
1745-56 |
Bau des repräsentativen Barocktraktes mit Mittelrisalit und Freitreppe. |
|
1780 |
Das Hoftheater entsteht. |
|
1808 |
Die Herrschaft Rheda wird dem Großherzogtum Berg zugeschlagen. |
|
1817 |
Graf Emil Friedrich zu Bentheim-Tecklenburg wird von König Friedrich Wilhelm III. in den erblichen preußischen Fürstenstand erhoben. |
In einem 1734 erbauten Vierständerbau befindet sich heute das Leineweber- und Trachtenmuseum. Es zeigt eine private Sammlung von alten Geräten des Leineweberhandwerks sowie eine stattliche Anzahl historischer Trachten und Hauben. Ein funktionstüchtiger Webstuhl veranschaulicht die Arbeit der damaligen Zeit.
Die Stadtkirche gilt als eine der frühesten protestantischen Kirchenbauten Westfalens. Nachdem in Rheda 1527 die Reformation eingeführt wurde, erweiterte man ab 1611 eine Vorgängerkapelle zu einer dreischiffigen Hallenkirche mit gotischen Elementen. Der Westturm wurde 1654 fertig gestellt. Bemerkenswert an der Inneneinrichtung sind ein achteckiges Taufbecken von 1567, zwei Epitaphien, sowie Teile eines Chorgestühls aus dem anfänglichen 17. Jahrhundert.
Die katholische Kirche St. Johannes Baptist ist ein moderner Kirchenbau aus roten Backsteinen mit einem schmalen Betonturm. Das Gotteshaus entstand zwischen 1964 und 66 als Vikarie nach Plänen von Gottfried Böhm und vertritt eine neuzeitliche Architektur, die sich von der Sakralbauten der Vergangenheit selbstbewusst abhebt. Im Jahre 1974 wurde die Kirche zur eigenständigen Pfarrgemeinde erhoben.
 Die katholische Pfarrkirche St. Clemens wurde 1910 im neuromanischen Stil fertig gestellt. Auffällig sind ihre mächtigen Doppeltürme mit ihren leicht gewölbten Spitzhauben. Bemerkenswert ist die Orgel des Gotteshauses. Sie wurde zwar erst 1984 hergestellt, aber in das Hauptgehäuse der alten barocken Orgel aus dem 17. Jahrhundert eingepasst, so dass ein modernes Musikinstrument in einer historischen Verschalung entstand.
Die katholische Pfarrkirche St. Clemens wurde 1910 im neuromanischen Stil fertig gestellt. Auffällig sind ihre mächtigen Doppeltürme mit ihren leicht gewölbten Spitzhauben. Bemerkenswert ist die Orgel des Gotteshauses. Sie wurde zwar erst 1984 hergestellt, aber in das Hauptgehäuse der alten barocken Orgel aus dem 17. Jahrhundert eingepasst, so dass ein modernes Musikinstrument in einer historischen Verschalung entstand. Unweit des fürstlichen Wasserschlosses Rheda befindet sich, von Bäumen umringt, ein fast 300 Jahre altes kleines Fachwerkgebäude, das Bleichhäuschen. Wo früher Wäsche gebleicht wurde, entstand 1990 ein offenes Atelier in Form einer Künstlerwerkstatt. Hier kann man Künstlern bei der Arbeit zusehen, und es finden Kunstkurse, Projekte und Ausstellungen statt.
 Die Landesgartenschau fand im Jahre 1988 in den Emsauen von Rheda-Wiedenbrück statt. Das weitläufige Parkgelände, welches sich zwischen den beiden Stadtkernen Rheda und Wiedenbrück befindet, umfasst eine Größe von 60 ha und wird heute ‚Flora Westfalica’ genannt. Zu dem Landschaftspark gehört auch ein Abschnitt des Schlossgartens Rheda. Die Parkanlagen sind allesamt frei zugänglich. Besonderer Anziehungspunkt für Kinder ist der Wasserspielgarten, in dem man in großen Bottichen über einen See schippern und in einem Tiergehege Ziegen, Heidschnucken und Schweine beobachten kann.
Die Landesgartenschau fand im Jahre 1988 in den Emsauen von Rheda-Wiedenbrück statt. Das weitläufige Parkgelände, welches sich zwischen den beiden Stadtkernen Rheda und Wiedenbrück befindet, umfasst eine Größe von 60 ha und wird heute ‚Flora Westfalica’ genannt. Zu dem Landschaftspark gehört auch ein Abschnitt des Schlossgartens Rheda. Die Parkanlagen sind allesamt frei zugänglich. Besonderer Anziehungspunkt für Kinder ist der Wasserspielgarten, in dem man in großen Bottichen über einen See schippern und in einem Tiergehege Ziegen, Heidschnucken und Schweine beobachten kann. Radrouten die durch Rheda führen:
Wiedenbrück
heda-Wiedenbrück ist eine Doppelstadt im östlichen Westfalen, die im Jahre 1970 durch die Zusammenlegung der vormals selbstständigen Städte Rheda und Wiedenbrück entstand. Die Ems verbindet beide Stadtteile. In der Emsaue zwischen Rheda und Wiedenbrück fand 1988 die Landesgartenschau statt. Heute wird der frei zugängliche Landschaftspark ‚Flora-Westfalica-Park’ genannt. Wiedenbrück wurde erstmals 785 urkundlich erwähnt. Im Jahre 952 erhielt es durch Kaiser Otto das Markt-, Münz- und Zollrecht. Möglicherweise hat es hier einen Königshof gegeben. Von der mittelalterlichen Stadtbefestigung blieb jedoch nur die Ruine des so genannten Pulverturms erhalten. Dafür bewahrte man einen wesentlichen Teil der historisch gewachsenen Innenstadt mit seinen reich verzierten Fachwerk- und Dielenhäusern. Die sehenswerte Altstadt gruppiert sich um das Alte Rathaus von 1619 und den Marktplatz herum. Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Wiedenbrück zu einer Künstlerstadt. Zeitweilig wurden in 30 Werkstätten und Ateliers Ausstattungsgegenstände und sakrale Kunstwerke für die neu errichteten Kirchen im weiteren Umkreis geschaffen. Für diese kunsthandwerklichen Arbeiten wurde der Begriff ‚Wiedenbrücker Schule’ geprägt.
Sehenswertes:
Die St.-Aegidius-Kirche in Wiedenbrück besitzt eine lange Geschichte. Wiedenbrück gehörte zu den Urpfarren des Bistums Osnabrücks und war Zentrum der christlichen Missionierung des Emslandes. Um 785 wurde bereits eine erste Kapelle gebaut, mehrere Kirchenneu- und Umbauten folgten. Die heutige Pfarrkirche ist im unteren Teil noch romanisch gestaltet und schließt im oberen Teil mit gotischen Elementen ab. Der 54 m hohe Turm entstand erst Mitte des 19. Jahrhunderts, nachdem der alte wegen Baufälligkeit abgebrochen worden war. Er dominiert das äußere Erscheinungsbild des Gotteshauses und wird von einer neobarocken Haube bekrönt.
Die katholische Pfarrkirche befindet sich im Ortskern von Wiedenbrück. Sie wurde den Heiligen Ursula und Maria geweiht und wird von den Mönchen des angrenzenden Franziskanerklosters betreut, daher sind für das Gotteshaus auch die Namen Franziskanerkirche, Paterskirche und St-Ursula-Kirche gebräuchlich. Die heutige Marienkirche besaß einen romanischen Vorgängerbau aus dem 12. Jahrhundert, auf dessen Resten sie 1470 errichtet wurde. Noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde sie vom Jesuitenorden genutzt, ehe sie 1644 mit der Gründung des Klosters den Franziskanern übertragen wurde. Kurz darauf entstand der über die Strasse führende markante Verbindungsbogen, der Klostergebäude und Kirche miteinander verbindet. Trotz des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803, der zur Auflösung der meisten Klöster führte, blieb das Franziskanerkloster in seiner Funktion erhalten und wurde Ende des 19. Jahrhunderts sogar noch ausgebaut. Heute beherbergt das Franziskanerkloster Wiedenbrück ein bundesweites Noviziat. Junge Männer, die dem Franziskanerorden beitreten, verbringen hier ihre ersten Jahre.
 Das historische Rathaus von Wiedenbrück befindet sich direkt am Marktplatz. Der zweistöckige Fachwerkbau mit seinem Krüppelwalmdach entstand 1619 und wurde im Jahre 1790 noch einmal umgebaut. Dabei erhielt es seine marktseitige Fassade, über dessen Portal sich das Wappen des Fürstbischofs von Osnabrück befindet. Noch heute dient das Rathaus der Stadtverwaltung und für standesamtliche Trauungen. Um das Alte Rathaus und den Marktplatz herum gruppiert sich die sehenswerte Altstadt mit ihren vielen reich verzierten Fachwerkhäuschen. Charakteristisch für Wiedenbrück sind die so genannten Dielenhäuser. Ihre wuchtigen, der Straße zugewandten Tore erstrecken sich über zwei Stockwerke und bilden den Zugang in den hohen Dielenraum.
Das historische Rathaus von Wiedenbrück befindet sich direkt am Marktplatz. Der zweistöckige Fachwerkbau mit seinem Krüppelwalmdach entstand 1619 und wurde im Jahre 1790 noch einmal umgebaut. Dabei erhielt es seine marktseitige Fassade, über dessen Portal sich das Wappen des Fürstbischofs von Osnabrück befindet. Noch heute dient das Rathaus der Stadtverwaltung und für standesamtliche Trauungen. Um das Alte Rathaus und den Marktplatz herum gruppiert sich die sehenswerte Altstadt mit ihren vielen reich verzierten Fachwerkhäuschen. Charakteristisch für Wiedenbrück sind die so genannten Dielenhäuser. Ihre wuchtigen, der Straße zugewandten Tore erstrecken sich über zwei Stockwerke und bilden den Zugang in den hohen Dielenraum. Das einzige Relikt der ehemaligen mittelalterlichen Stadtmauer von Wiedenbrück ist der so genannte Pulverturm. Aber auch von ihm ist nur noch eine Ruine erhalten. Einige Schießscharten zeugen noch von seiner ehemaligen Wehrhaftigkeit. Aus Backsteinen errichtet, war der Turm einst doppelt so hoch und nach oben hin geschlossen. Der Pulverturm liegt direkt an der Ems und am Mühlenwall und stammt aus dem 15. oder frühen 16. Jahrhundert. Ein genaueres Datum seiner Erbauung ist nicht bekannt. Entgegen seinem Namen wurde er aber wohl nie als Lagerstätte für Schießpulver genutzt.
Nach 1850 kam es, bedingt durch die stark steigende Bevölkerungszahl, zu einem vermehrten Bau von Kirchen. Kleine Gotteshäuser wurden vergrößert, neue Pfarren wurden zusätzlich geschaffen, um alle Gemeindeglieder aufnehmen zu können. Aber die neuen Kirchen brauchten auch eine neue Ausstattung: Altäre und Altarbilder, Kanzeln, Chorgestühl und Beichtstühle, aber auch Kreuzwegbilder. So bildete sich ab 1864 in Wiedenbrück eine Ansammlung von Werkstätten und Ateliers, die dieser Nachfrage nachkamen und sich auf die Inneneinrichtung von Kirchen und auf sakrale Kunst spezialisierten. Zeitweilig firmierten in der Stadt 30 Werkstätten. Für diese kunsthandwerklichen Arbeiten bildete sich der Begriff ‚Wiedenbrücker Schule’. Sie machte Wiedenbrück weithin als Künstlerstadt berühmt und hatte seine Hochzeit bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Einer der bekanntesten und bedeutendsten Künstler der Wiedenbrücker Schule war Bernhard Hoetger. Er leitete zwei Jahre lang eine Werkstatt und machte sich dann später als Worpsweder Künstler und als Erbauer der Bremer Böttcherstrasse einen Namen. Beispiele für die Wiedenbrücker Schule finden sich auch in der St-Aegidius-Kirche und der St.-Marienkirche in Wiedenbrück sowie der St. Clemenskirche in Rheda. Das Wiedenbrücker Schule Museum geht auf diese kunsthandwerkliche Stilrichtung ein. Es beschreibt ihre Entwicklung, widmet sich den Künstlern und zeigt eine Vielzahl von Exponaten. Darüber hinaus hat auch der Bestand des ehemaligen Heimatmuseums Wiedenbrück mit seiner umfangreichen Ausstellung zur Stadtgeschichte in diesem Museum neue Präsentationsräume gefunden.
Ein Verstärkeramt hatte in der Anfangszeit der Telefontechnik die Aufgabe, die Lautstärke der eingehenden akustischen Signale zu erhöhen. Anfangs arbeitete man noch mit Röhrenverstärkern, später übernahmen andere Technologien und Gerätschaften diese Arbeit. Im Jahre 1995 wurde die Anlage abgeschaltet.
Heute erinnert in den alten Räumlichkeiten das Radio- und Telefonmuseum an diese alten Vermittlungstechniken und Übertragungsarten. In Wohnzimmern und Küchen, die im Stile der 30er und 50ger Jahre eingerichtet sind, finden sich alte Radios, Fernseher, Telefone und Tonbandgeräte.
Dem Museum ist ein Café angegliedert.
Der Gräftenhof Haus Aussel besteht schon seit dem 12. Jahrhundert. Damals diente er den Herren von Oldesloe als Burgmannshof. Sie waren im Dienst des Grafen von Rietberg. 1580 entstand das imposante Herrenhaus im Stil eines Adelspalais. Der aus rotem Backstein bestehende Fachwerkbau wurde mit überkragenden Geschossen errichtet. An den Hausecken lassen vier symmetrisch errichtete Ausluchten das Gebäude noch mächtiger und damit auch standesgemäßer erscheinen. Die Hofanlage besitzt noch zwei weitere Fachwerksbauten, die als Wirtschaftsgebäude genutzt wurden: das Bauhaus sowie das Brauhaus. Haus Aussel kann nur von außerhalb der Gräfte eingesehen werden. 1197 15. Jhd. Durch Erbschaft kommt der Besitz an die Herren von Hachmester. 16. Jhd. 1580 17. Jhd. 18. Jhd. 1830
Geschichtlicher Ablauf
Haus Aussel wird als Burgmannshof der Herren von Odesloe, die im Dienst des Grafen von Rietberg stehen, erwähnt.
Anfang des Jahrhunderts erwirbt Moritz I. von Amelunxen das Anwesen.
Bau des heute noch bestehenden Herrenhauses im Stile eines Adelspalais.
Durch Erbgang gelangt das Rittergut in den Besitz der Familie von Hanxthausen.
Die Familie Rübell von Biberach übernimmt Haus Aussel.
Verkauf an Conrad Schäfer, der es an die Familie Henckelmann vererbt. Lange Zeit wird das Gut landwirtschaftlich genutzt.
Radrouten die durch Wiedenbrück führen:
Werse Rad Weg
EmsRadweg
LandesGartenSchauRoute
Radroute Historische Stadtkerne
Oelde
elde ist ein kleines Städtchen mit einer netten Innenstadt. Die im 12. Jahrhundert erstmals erwähnte Ortschaft erhielt 1804 das Stadtrecht. Im Jahr 2001 fand hier die Landesgartenschau statt. Das Gelände wird heute als Vier-Jahreszeiten-Park genutzt. Im Ortsteil Stromberg befindet sich die Ruine einer alten Höhenburg. Auf dem Gelände des im 18. Jahrhundert abgetragenen burggräflichen Schlosses befindet sich auch die 1344 geweihte Kreuzkirche, eine im gotischen stil errichtete turmlose Wallfahrtskirche und das Malinckrodthaus, ein gut erhaltenes Burgmannshaus aus dem 15. Jahrhundert. Nordöstlich von Stromberg befindet sich das Rittergut Haus Nottbeck, in dem das Museum für Westfälische Literatur untergebracht ist.
Sehenswertes:
In einer waldreichen Umgebung liegt das Haus Geist. Vom ehemaligen prachtvollen Renaissanceschloss blieben leider nur noch einzelne Gebäude erhalten. Das Anwesen war auf zwei Inseln mit Haupt- und Vorburg errichtet worden. Von der ursprünglichen Bausubstanz des Schlosses aus dem 16. Jahrhunderts bestehen nur noch ein Torbogen sowie die Fundamente aus Bruchstein. Das Herrenhaus ist ein schlichter roter Backsteinbau mit Fensterrahmung aus hellem Sandstein. Der wuchtige Bau ragt direkt aus an der teichartig verbreiterten Gräfte. Auf der Vorburg fällt ein reich mit Sandsteinornamenten verziertes zweistöckiges Wirtschaftsgebäude auf, das noch aus dem 16. Jahrhundert stammt. Zu bestimmten Zeiten ist eine Teilbesichtigung möglich. 1560 -68 1593 Durch Heirat kommt das Anwesen an die Edelherren von Büren. 1640 1750-55 1773 1803 1806-09 1884
Geschichtlicher Ablauf
Bau der Wasserburg von Haus Geist durch Laurenz von Brachum für Franz von Loe.
Haus Geist wird an den Jesuitenorden vererbt. Dieser richtet in der Burg ein Koster ein.
Neubau des Nordflügels durch den Jesuiten Franz Pfisterer nach Plänen von Franz Christoph Nagel.
Auflösung des Klosters durch Papst Clemens XIV. Der Fürstbischof von Münster nimmt Haus Geist in Besitz und richtet auf dem Anwesen einen landwirtschaftlichen Betrieb ein.
Das Fürstbistum Münster wird aufgelöst und Haus Geist fällt an den Staat.
Abbruch des vierflügeligen Schlossbaus.
Nach einer umfangreichen Renovierung wird Haus Geist privat verpachtet.
 Haus Nottbeck ist ein alter Landsitz aus dem 14. Jahrhundert. Es befindet sich nordöstlich vom Oelder Ortsteil Stromberg inmitten einer dazugehörigen idyllischen Parklandschaft. Durch ein Fachwerktorhaus gelangt man auf den jederzeit geöffneten Innenhof. Auf der linken Seite befinden sich die ehemaligen Wirtschaftsgebäude, geradeaus befindet sich das zweistöckige klassizistische Herrenhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert, welches das 2001 eröffnete Museum für Westfälische Literatur beherbergt. Im Erdgeschoss wird die westfälische Literatur bis 1900 vorgestellt. Das Obergeschoß präsentiert regionale Schriftsteller der Gegenwart und der Keller gibt der Kinder- und Jugendliteratur einen Platz. Ziel für die Betreiber ist es, im Haus Nottbeck ein lebendiges Museum zu präsentieren. So finden in den Räumlichkeiten des Kulturgutes auch Lesungen, Konzerte und Ausstellungen statt. In den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden befindet sich heute eine Musik- und Theaterwerkstatt, an den Wochenenden hat auch das Kulturcafé geöffnet.
Haus Nottbeck ist ein alter Landsitz aus dem 14. Jahrhundert. Es befindet sich nordöstlich vom Oelder Ortsteil Stromberg inmitten einer dazugehörigen idyllischen Parklandschaft. Durch ein Fachwerktorhaus gelangt man auf den jederzeit geöffneten Innenhof. Auf der linken Seite befinden sich die ehemaligen Wirtschaftsgebäude, geradeaus befindet sich das zweistöckige klassizistische Herrenhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert, welches das 2001 eröffnete Museum für Westfälische Literatur beherbergt. Im Erdgeschoss wird die westfälische Literatur bis 1900 vorgestellt. Das Obergeschoß präsentiert regionale Schriftsteller der Gegenwart und der Keller gibt der Kinder- und Jugendliteratur einen Platz. Ziel für die Betreiber ist es, im Haus Nottbeck ein lebendiges Museum zu präsentieren. So finden in den Räumlichkeiten des Kulturgutes auch Lesungen, Konzerte und Ausstellungen statt. In den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden befindet sich heute eine Musik- und Theaterwerkstatt, an den Wochenenden hat auch das Kulturcafé geöffnet.
Geschichtlicher Ablauf
|
14.Jhd. |
Ursprung des Rittergutes Haus Nottbeck. |
|
1805 |
Neubau des Herrenhauses und der Nebengebäude im klassizistischem Stil. |
|
1987 |
Die letzte Besitzerin, Luise Eissen, vererbte Haus Nottbeck dem Kreis Warendorf mit der Auflage, das Anwesen zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. |
|
2001 |
Eröffnung des Museums für Westfälische Literatur. |
 Am Rande der Beckumer Berger erhob sich einst die mächtige Burg Stromberg über die Weite der Stromberger Schweiz. Sie war eine der wenigen Höhenburgen im Münsterland. Leider ist von der ehemaligen trutzigen Wehranlage nicht mehr viel erhalten, denn Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Burg, die sich auf einem 154 Meter hohen Kalkberg befand, zum größten Teil abgetragen. Einige Mauerreste mit einem Tordurchgang erinnern noch an die alte Festung. Daneben sind das Malinckrodthaus und der Paulusturm aus dem 15. Jahrhundert noch sehr gut erhalten. Durch den Turm schreitet der Besucher, um auf den Burgplatz zu kommen. Ihn ziert ein Wappenstein von 1564. Das wichtigste Bauwerk der Anlage ist jedoch die 1344 geweihte Kreuzkirche. Die im gotischen stil errichtete turmlose Wallfahrtskirche birgt das so genannte ‚Wunderbringende Kreuz’, welches inzwischen seit mehr als 800 Jahren verehrt wird. Es ist romanischen Ursprungs und zählt zu den ältesten Christusdarstellungen Westfalens. Jährlich werden rund 40.000 Pilger gezählt, die nach Stromberg kommen. Vor der steilen Treppe der Kirche befindet sich eine Freilichtbühne, auf der in den Sommermonaten Theateraufführungen für Kinder gegeben werden.
Am Rande der Beckumer Berger erhob sich einst die mächtige Burg Stromberg über die Weite der Stromberger Schweiz. Sie war eine der wenigen Höhenburgen im Münsterland. Leider ist von der ehemaligen trutzigen Wehranlage nicht mehr viel erhalten, denn Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Burg, die sich auf einem 154 Meter hohen Kalkberg befand, zum größten Teil abgetragen. Einige Mauerreste mit einem Tordurchgang erinnern noch an die alte Festung. Daneben sind das Malinckrodthaus und der Paulusturm aus dem 15. Jahrhundert noch sehr gut erhalten. Durch den Turm schreitet der Besucher, um auf den Burgplatz zu kommen. Ihn ziert ein Wappenstein von 1564. Das wichtigste Bauwerk der Anlage ist jedoch die 1344 geweihte Kreuzkirche. Die im gotischen stil errichtete turmlose Wallfahrtskirche birgt das so genannte ‚Wunderbringende Kreuz’, welches inzwischen seit mehr als 800 Jahren verehrt wird. Es ist romanischen Ursprungs und zählt zu den ältesten Christusdarstellungen Westfalens. Jährlich werden rund 40.000 Pilger gezählt, die nach Stromberg kommen. Vor der steilen Treppe der Kirche befindet sich eine Freilichtbühne, auf der in den Sommermonaten Theateraufführungen für Kinder gegeben werden.
Geschichtlicher Ablauf
|
966 |
Erstmalige urkundliche Erwähnung des Burggrafen von Stromberg. |
|
1177 |
Stromberg wird zur Landesburg der Bischöfe von Münster. Sie wurde dem Burgrafen Othalrich von Stromberg und seiner Frau Gisla als Lehen gegeben. |
|
13. Jhd. |
Nach dem Aussterben der Burggrafen von Stromberg fiel die Festung an die Herren von Rudenberg, die sich ihrerseits auch überwiegend Burggrafen von Stromberg nannten. |
|
1344 |
Bau der heute noch erhaltenen Wallfahrtskirche im Stil der Gotik. In ihr befindet sich das romanische ‚Wunderbringende Kreuz’ aus dem 12. Jahrhundert. |
|
1425 |
Nach dem Aussterben der männlichen Erbfolgelinie der burggräflichen Familie fiel Burg Stromberg dem Stift Münster zu. Bischof Heinrich ließ die Anlage wehrhafter ausbauen. |
|
1450 |
Eroberung durch Graf Johann von Hoja |
|
1456 |
Bau des Malinckrodthauses, des ältesten noch erhaltenen Burgmannshauses in Westfalen. |
|
1460 |
Erste Schleifung der Anlage durch Bischof Johann II. von Bayern. |
|
1780 |
Die Burgmauern des bis zum Dache noch stehenden burggräflichen Schlosses werden bis auf wenige Reste abgebrochen. Neben der Mauerruine blieben nur noch die Kirche, der Paulusturm sowie das Malingrodthaus erhalten. |
|
1960 |
Hinter der Kirche wurde ein durch Heinrich Lückenkötter gestalteter Kreuzweg errichtet. |
 Auf dem Burghof der im 18. Jahrhundert abgetragenen Burgruine Stromberg befindet sich etwas abgelegen am westlichen Rande des Burgplatzes das Malinckrodthaus. Das Burgmannshaus aus dem Jahre 1456 ist das älteste Bauwerk seiner Art in Westfalen und noch weitgehend im Ursprung erhalten. Die Burgmänner von Stromberg waren seinerzeit mitverantwortlich für die Landesverteidigung.
Auf dem Burghof der im 18. Jahrhundert abgetragenen Burgruine Stromberg befindet sich etwas abgelegen am westlichen Rande des Burgplatzes das Malinckrodthaus. Das Burgmannshaus aus dem Jahre 1456 ist das älteste Bauwerk seiner Art in Westfalen und noch weitgehend im Ursprung erhalten. Die Burgmänner von Stromberg waren seinerzeit mitverantwortlich für die Landesverteidigung.  Im Jahr 2001 fand in Oelde die viel beachtete Landesgartenschau statt. Der Vier-Jahreszeiten-Park ist aus dem Gelände hervorgegangen. Man ist bemüht, den Park zu jeder Jahreszeit attraktiv zu gestalten. Neben der umfangreichen Gartenlandschaft existieren mehrere Spielplätze und mit der Waldbühne einen viel genutzte Open-Air-Veranstaltungsort. Im Wald ist ein Entdeckungspfad mit Hängebrücke und Baumhäuser eingerichtet. Im Kindermuseum KLIPP KLAPP sollen die Kleinen spielerisch alle Gegenstände selber erproben und erforschen. Eine Wasserlandschaft und eine alte Wassermühle bilden die Highlights in diesem ungewöhnlichen Museum.
Im Jahr 2001 fand in Oelde die viel beachtete Landesgartenschau statt. Der Vier-Jahreszeiten-Park ist aus dem Gelände hervorgegangen. Man ist bemüht, den Park zu jeder Jahreszeit attraktiv zu gestalten. Neben der umfangreichen Gartenlandschaft existieren mehrere Spielplätze und mit der Waldbühne einen viel genutzte Open-Air-Veranstaltungsort. Im Wald ist ein Entdeckungspfad mit Hängebrücke und Baumhäuser eingerichtet. Im Kindermuseum KLIPP KLAPP sollen die Kleinen spielerisch alle Gegenstände selber erproben und erforschen. Eine Wasserlandschaft und eine alte Wassermühle bilden die Highlights in diesem ungewöhnlichen Museum.  Die Pfarrkirche Johannes der Täufer war ursprünglich eine im 14. Jahrhundert errichtete Hallenkirche, die aber im Jahre 1457 einem verheerenden Feuer zum Opfer fiel und dabei stark beschädigt wurde. Der Ostteil blieb bis heute erhalten, der Rest wurde wiederaufgebaut und in späterer Zeit mehrfach umgebaut. 1864 wurde das Kirchenhaus verlängert und bekam im Westen einen Turm. Bei der Ausstattung fallen besonders der spätgotische Taufstein und das Sakramenthäuschen von 1491 auf.
Die Pfarrkirche Johannes der Täufer war ursprünglich eine im 14. Jahrhundert errichtete Hallenkirche, die aber im Jahre 1457 einem verheerenden Feuer zum Opfer fiel und dabei stark beschädigt wurde. Der Ostteil blieb bis heute erhalten, der Rest wurde wiederaufgebaut und in späterer Zeit mehrfach umgebaut. 1864 wurde das Kirchenhaus verlängert und bekam im Westen einen Turm. Bei der Ausstattung fallen besonders der spätgotische Taufstein und das Sakramenthäuschen von 1491 auf. Die evangelische Stadtkirche wurde 1880 im neugotischen Stil erbaut. Die Saalkirche besitzt im Westen einen vierstöckigen Turm. Die Inneneinrichtung stammt weitgehend noch immer aus der Erstausstattung.
Auf dem Firmengelände der GEA Westfalia Seperator GmbH wurde das Deutsche Zentrifugenmuseum eingerichtet. Hier werden zahlreiche Maschinen ausgestellt, die mit Zentrifugaltechnik ausgerüstet sind. Zu bestaunen gibt es beispielsweise den allerersten Milchentrahmungs-Separator.
Die Brauerei Pott’s betreibt in Oelde eine Naturparkbrauerei. Man legt bei Pott’s Wert darauf, dem eigenen Bier keine haltbarmachende Zusätze hinzuzufügen. Dieses kann auch jedermann kontrollieren, denn die Brauerei ist als einzige in Europa frei zugänglich und man kann dort den Braumeistern bei ihrer Arbeit zuschauen. Zur Naturparkbrauerei gehört auch das Bier-Museum. Hier erfährt man alles über die westfälische Biertradition. Der Bierbrauer Georg Lechner hat innerhalb von 40 Jahren die mit 220.000 Exemplaren größte Kollektion westdeutscher Bier-Etiketten zusammengetragen. Zu den weiteren Exponaten gehören mehr als 1300 historische Bierkrüge und über 300 Bierflaschen.
Radrouten die durch Oelde führen:
Werse Rad Weg
100 Schlösser Route – Ostkurs
LandesGartenSchauRoute
Beckum
ie Stadt Beckum ist geprägt durch die Zementwirtschaft. Früher wurde hier in zwölf Gruben Zement abgebaut, doch die meisten sind inzwischen stillgelegt. Stattdessen entstanden Naherholungsgebiete wie der Freizeitpark Phoenix, der Badesee Tuttenbrock und das renaturierte ‚Biotop’ in den ehemaligen Steinbrüchen. Die ehemalige Kreisstadt liegt heute im südlichen Teil des Kreises Warendorf. Im Jahre 1224 wird Beckum erstmals als Stadt bezeichnet, im Mittelalter war die Stadt von einem wehrhaften Wall mit einer hohen Mauer umgeben. Auch das landwirtschaftlich genutzte Umland, die Feldmark, wurde durch Wallanlagen und Turmwarten geschützt. Von der Soestwarte, dem letztem Relikt dieser Landwehr und heutigem Aussichtsturm auf dem Höxberg, hat man einen weiten Blick in das südliche Umland. Hier in den Beckumer Bergen, einem sanfter Höhenzug im ansonsten recht flachen Münsterland, entspringen der Lippbach, der Kollenbach und der Siechenbach, die drei Quellflüsse der Werse. Im Stadtgebiet von Beckum vereinen sich die drei Bäche schließlich zur Werse, die 67 Kilometer später bei Münster-Gelmer in die Ems mündet. Die Innenstadt mit dem Alten Rathaus und dem Kreisständehaus besitzt noch einige historische Gebäude, doch leider ging in Folge dreier verheerender Stadtbrände in den Jahren 1655, 1657 und 1734 viel alte Bausubstanz unwiderruflich verloren. Sehenswert ist Beckums ‚schöne Tochter’, der nordöstlich gelegene Ortsteil Vellern.
Sehenswertes:
Das Alte Rathaus steht direkt am Marktplatz vom Beckum. Der zweistöckige Bau mit dem neugotischen Stufengiebel und dem fünfbögigen Arkadengang stammt im Kern noch aus dem 15. Jahrhundert. Sein äußeres Erscheinungsbild hat sich im Laufe der Zeit aber verändert. So erhielt das Gebäude erst 1879 sein zweiter Stockwerk und den markanten Giebel. Dieser wurde 1937 noch einmal stark vereinfacht. Neben dem mittleren Arkadenbogen befinden sich die Patrone von Stadt und Kirche, Sebastian und St. Stephanus. Seit 1986 beherbergt das Alte Rathaus nun das Stadtmuseum. Die Bogenhalle im Erdgeschoss zeugt noch von repräsentativen Empfängen. Daneben befinden sich hier ein Tante-Emma-Laden aus der Zeit von 1908 und das großzügige Arbeitszimmer eines Zementdirektors. Im ersten Stockwerk befindet sich der alte Sitzungssaal, der heute für Wechselausstellungen genutzt wird und im Obergeschoss wird ein Rundgang mit Exponaten aus der städtischen Vergangenheit Beckums präsentiert, darunter steinzeitliche Funde von 4000 v. Chr. und Grabbeilagen vom ‚Sachsenfürsten von Beckum’, die auf die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts datiert werden. In einem Raum befindet sich das Karnevalsmuseum, welches die besondere und umfangreiche Geschichte des heimischen Karnevalltreibens dokumentiert.
Der viereckige Buddenturm ist der letzte verbliebene Wachturm der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Von den ehemals vier Stadttoren und der Wehrmauer blieb ansonsten nichts erhalten. Der unweit des Westenfeuermarktes gelegene Buddenturm war erstmals 1455 urkundlich erwähnt worden. Er wurde in seiner Geschichte mehrfach umgebaut und war Mitte des 20. Jahrhundert in einem recht desolaten Zustand. 1962 bis 1964 wurde er vom Heimatverein Beckum grundlegend renoviert und dient heute als kleines Heimatmuseum. Im Erdgeschoss wird die heimatkundliche Sammlung des Vereins gezeigt, das Obergeschoss beherbergt eine Waffensammlung. Das mittlere Stockwerk dient verschiedenen Anlässen, wie zum Beispiel standesamtlichen Trauungen.
 Die St.-Stephanus-Kirche ist eine katholische Pfarr- und Probsteikirche im gotischen Stil. Der wuchtige Turm mit der markanten geschwungenen Haube stammt im unteren Teil bereits aus dem 12.Jahrhundert. Es hatte bereits drei Vorgängerbauten gegeben. 785 wurde die erste, im 10./11. Jahrhundert eine zweite Saalkirche errichtet. Die zweite Kirche brannte im 12. Jahrhundert nieder und wurde zum dritten Male wieder aufgebaut. Die Pfarrkirche wurde 1267 zur Stiftskirche des Kollegiatstiftes erhoben, der erst im Zuge der Säkularisierung wieder aufgehoben wurde. Seitdem war St. Stephanus wieder nur Pfarrkirche, ehe sie 1967 durch den Bischof von Münster, Joseph Höffner, zur Propsteikirche erhoben wurde. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Goldschrein der heiligen Prudentia im Inneren des Gotteshauses. Er wurde 1230 erschaffen und gilt als der bedeutendste romanische Reliquienschrein Westfalens.
Die St.-Stephanus-Kirche ist eine katholische Pfarr- und Probsteikirche im gotischen Stil. Der wuchtige Turm mit der markanten geschwungenen Haube stammt im unteren Teil bereits aus dem 12.Jahrhundert. Es hatte bereits drei Vorgängerbauten gegeben. 785 wurde die erste, im 10./11. Jahrhundert eine zweite Saalkirche errichtet. Die zweite Kirche brannte im 12. Jahrhundert nieder und wurde zum dritten Male wieder aufgebaut. Die Pfarrkirche wurde 1267 zur Stiftskirche des Kollegiatstiftes erhoben, der erst im Zuge der Säkularisierung wieder aufgehoben wurde. Seitdem war St. Stephanus wieder nur Pfarrkirche, ehe sie 1967 durch den Bischof von Münster, Joseph Höffner, zur Propsteikirche erhoben wurde. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Goldschrein der heiligen Prudentia im Inneren des Gotteshauses. Er wurde 1230 erschaffen und gilt als der bedeutendste romanische Reliquienschrein Westfalens. Das Kloster Blumenthal war ein 1446 gegründetes Augustinerinnenkloster, bewohnt von überwiegend bürgerlichen Damen. Bei dem Stadtbrand von 1657 wurden die Klostergebäude ein Opfer der Flammen, sie wurden aber in der Folgezeit wieder aufgebaut. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Kloster im Jahre 1814 schließlich aufgehoben.
 Die Beckumer Berge sind eine sanfte Hügellandschaft im Süden von Beckum. Sie gehören zu den Höhenzügen im ansonsten flachen Münsterland. Die höchsten Erhebungen sind der westlich von Sünninghausen liegende Mackenberg mit 174 m über N.N. und der Höxberg mit 161 m über N.N., auf dem sich die Soestwarte befindet. In den Beckumer Bergen entspringen die drei Quellflüsse der Werse, Lippbach, Kollenbach und Siechenbach. Im Stadtgebiet von Beckum vereinigen sie sich zur Werse, die bei Münster-Gelmer in die Ems mündet. Nahe dem Hermannsberg befinden sich ein Germanenlager sowie einige Germanengräber. Diese Relikte aus frühmittelalterlicher Zeit sind als Kulturdenkmal geschützt.
Die Beckumer Berge sind eine sanfte Hügellandschaft im Süden von Beckum. Sie gehören zu den Höhenzügen im ansonsten flachen Münsterland. Die höchsten Erhebungen sind der westlich von Sünninghausen liegende Mackenberg mit 174 m über N.N. und der Höxberg mit 161 m über N.N., auf dem sich die Soestwarte befindet. In den Beckumer Bergen entspringen die drei Quellflüsse der Werse, Lippbach, Kollenbach und Siechenbach. Im Stadtgebiet von Beckum vereinigen sie sich zur Werse, die bei Münster-Gelmer in die Ems mündet. Nahe dem Hermannsberg befinden sich ein Germanenlager sowie einige Germanengräber. Diese Relikte aus frühmittelalterlicher Zeit sind als Kulturdenkmal geschützt. Die Soestwarte ist ein Aussichtsturm auf dem Höxberg im Süden der Stadt Beckum. Im Mittelalter wurde nicht nur die Stadt mit einer Mauer und Wachtürmen gesichert. Es gab auch einen doppelten Sicherungswall, der die Feldmark, das landwirtschaftlich genutzte Umland der Stadt, vor unliebsamen Besuchern schützen sollte. Dieser Schutzwall wurde Landwehr genannt. Insgesamt 22 Wachtürme umgaben einst die Stadt Beckum. Von denen blieb nur der Buddenturm als Wehrturm der Stadtmauer sowie die Soestwarte vom äußeren Sicherheitswall erhalten. Von hier aus hat man bei klarem Wetter einen wunderschönen Blick in das weite südliche Umland. Nicht weit entfernt von der Soestwarte befindet sich eine alte weiß verputzte Windmühle vom Typ Holländer.
Der Freizeitpark Phoenix ist ein Naherholungsgebiet in einem ehemaligen renaturierten Steinbruch im Osten der Stadt Beckum. Ein knapp 40.000 m² großer See mit Badestrand und Wasserspielzone bildet das Zentrum des Parks. Verschiedene Spielplätze für Kinder, Sportplätze für Beach-Volleyball und Badminton, eine Skateboardanlage, ein Minigolfparcour sowie ein Klettergelände des deutschen Alpenvereins werden für die Freizeitgestaltung angeboten. Eine Kalkstein-Steilwand wurde erhalten. Die hier sichtbaren und für die Region typischen Schichtungen geben einen Einblick in die erdgeschichtliche und geologische Struktur der Gegend.
Das Kreisständehaus in Beckum ist ein imposanter und repräsentativer Bau im Stil des Historismus. Er befindet sich in einer weitläufigen Parkanlage, der Westenfeuermark, durch die auch die noch junge Werse fließt. Das Gebäude wurde 1887 fertig gestellt als Sitz der Kreisverwaltung. Der Kreis Beckum hatte von 1803 bis 1809 und dann von1816 bis 1975 bestanden. Im Zuge der kommunalen Neuordnung wurde die Stadt Beckum schließlich dem Kreis Warendorf zugeordnet. Auch ist der Begriff ‚Ständehaus’ im eigentlichen Sinne irreführend, denn ein Ständeparlament hat hier nie getagt, wohl aber der Kreistag. Der zweistöckige Verwaltungsbau mit den neugotischen Stilelementen, in welchem auch der Landrat seinen Wohnsitz hatte, besitzt zwei im rechten Winkel zueinander liegende Flügel. Ein kleiner Rundturm schmückt die Nordseite und an der Parkseite zur Werse befindet sich ein Eckturm mit einer patinabelegten Pyramidenhaube. Heute dient das schlossartige Gebäude als städtisches Sozial- und Jugendamt und wird darüber hinaus auch als Ratssaal sowie für repräsentative Empfänge genutzt.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Beckum hängt unmittelbar mit dem Abbau des Zementes in den umliegenden Steinbrüchen zusammen. Zeitweilig wurde der Rohstoff in zehn Gruben gleichzeitig abgebaut. In der denkmalsgeschützten Köttings Mühle am Werseteich wurde 2010 ein kleines Zementmuseum eröffnet, welches auf die Geschichte des Baustoffes eingeht. Mittelpunkt der Ausstellung ist ein Zementlabor für die Bestimmung der Zementqualität.
 Nachdem die Zementfabriken einen wesentlichen Teil der Umgebung von Beckum ausgeschlachtet hatten, wurde nach Möglichkeiten gesucht, die entstandenen Halden möglicht sinnvoll zu nutzen. So entstand in unmittelbarerer Stadtnähe im Westen von Beckum sowie der Werse im Süden das so genannte Biotop. Durch Rekultivierung bzw. selbstständiger Renaturierung entstanden hier Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Grundwassereinbrüche ließen Wasserflächen entstehen und da es keine anderen Gewässer in der weiteren Umgebung gab, wurde das Gebiet ein Refugium für Brutvögel und durchziehende Wasservögel. Schilfflächen lockten Insekten und Amphibienarten, insbesondere Libellen an, so dass mit dem Biotop ein naturschutzwürdiges und landschaftlich besonders reizvolles Areal entstand.
Nachdem die Zementfabriken einen wesentlichen Teil der Umgebung von Beckum ausgeschlachtet hatten, wurde nach Möglichkeiten gesucht, die entstandenen Halden möglicht sinnvoll zu nutzen. So entstand in unmittelbarerer Stadtnähe im Westen von Beckum sowie der Werse im Süden das so genannte Biotop. Durch Rekultivierung bzw. selbstständiger Renaturierung entstanden hier Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Grundwassereinbrüche ließen Wasserflächen entstehen und da es keine anderen Gewässer in der weiteren Umgebung gab, wurde das Gebiet ein Refugium für Brutvögel und durchziehende Wasservögel. Schilfflächen lockten Insekten und Amphibienarten, insbesondere Libellen an, so dass mit dem Biotop ein naturschutzwürdiges und landschaftlich besonders reizvolles Areal entstand.  Der Ortsteil Vellern wird als die ‚schöne Tochter Beckums’ bezeichnet. Er liegt im Nordosten der ‚Mutter’ und breitete sich um die katholische Pfarrkirche St. Pankratius und seinem malerischen Kirchplatz aus. St. Pankratius war Eigenkirche des Stiftes Freckenhorst, wurde im 12. Jahrhundert gegründet und später gotisch erweitert. Der idyllische ländliche Dorfkern von Vellern ist historisch gewachsen und liegt direkt am Werse Rad Weg.
Der Ortsteil Vellern wird als die ‚schöne Tochter Beckums’ bezeichnet. Er liegt im Nordosten der ‚Mutter’ und breitete sich um die katholische Pfarrkirche St. Pankratius und seinem malerischen Kirchplatz aus. St. Pankratius war Eigenkirche des Stiftes Freckenhorst, wurde im 12. Jahrhundert gegründet und später gotisch erweitert. Der idyllische ländliche Dorfkern von Vellern ist historisch gewachsen und liegt direkt am Werse Rad Weg. Im Zentrum von Beckum, unweit des Marktplatzes, befindet sich die Museumsschmiede Galen. Diese war 1894 vom Schmiedemeister Johann Galen errichtet worden und blieb bis zum Jahre 1983 in Betrieb. 2003 wurde an dieser historischen Stätte die Museumsschmiede eröffnet. Die Schmiedekunst, die zu den ältesten Handwerken der Menschheit gehört und bei der Metalle durch ständiges Hämmern oder Pressen geformt werden, wird hier in seiner ursprünglichen Form vorgeführt. Daneben kann auch eine stattliche Auswahl an historischen Schmiedewerkzeugen bewundert werden. In der Museumsschmiede kann man auch den Bund für das Leben schmieden. In den historischen Räumlichkeiten können auch standesamtliche Trauungen abgehalten werden.
Das Brauhaus Stiefel-Jürgens ist die älteste Brauerei Westfalens. Gegründet wurde sie 1680 und bis zum heutigen Tage braut man hier in der neunten Generation sehr unterschiedliche Bierspezialitäten: das traditionelle ‚Stiefel-Bier’, das dunkle ‚Stiefel-Ur-Alt’, das Pils ‚Staphanus-Bräu’ sowie saisonbedingt das ‚Stiefel’s Hefe Weizen’ und ‚Stiefel’s Winterbräu’. Den Namen ‚Stiefel-Jürgens’ erhielt die Schänke, weil sich hier die Zunft der Schumacher zum Tagen traf. Da es aber zu dieser Zeit mehrere Gaststätten mit dem Namen Jürgens gab, hängte man ein paar Stiefel als Erkennungsmerkmal vor die Pforte, um eine Verwechslung zu vermeiden. So wurden die Stiefel dann in den Gaststättennamen übernommen. Noch immer ist das Brauhaus Stiefel-Jürgens in der Hühlstrasse eine beliebte Gausthausbrauerei, in der man bei einem Besuch natürlich unbedingt eine der selbstgebrauten Bierspezialitäten probieren sollte.
Radrouten die durch Beckum führen:
Werse Rad Weg
100 Schlösser Route – Ostkurs
LandesGartenSchauRoute
Wadersloh
m Südosten der Beckumer Berge liegt das ländlich geprägte Wadersloh. Die heutige Gemeinde entstand 1975 durch den Zusammenschluss der Dörfer Wadersloh, Liesborn und Diestedde. Die Gründung der Abtei in Liesborn geht bereits auf die Zeit um 800 zurück. Das ehemalige Benediktinerkloster beherbergt heute ein umfangreiches Museum mit einer großen Gemäldesammlung und Europas größter Kreuz- und Kruzifixsammlung, darunter auch künstlerische Arbeiten von Dalí, Chagall und Beuys. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das Wasserschloß Crassenstein im Ortsteil Diestedde. Der privat bewohnte Renaissancebau stammt in seiner jetzigen Form noch aus dem 16. Jahrhundert.
Sehenswertes:
Das ehemals rot und heute dottergelb getünchte Schloss Crassenstein befindet sich im Dorf Diestedde, einem Ortsteil der Gemeinde Wadersloh. Die zweistöckige Dreiflügelanlage mit dem Mansardendach gehört zu den typischen Anlagen des Zwei-Insel-Typs. Eine kleine Allee führt als Achse die Front des Herrenhauses zu. Auf dem Weg zum Hauptportal überquert man zwei Brücken. Jenseits der ersten Brücke befinden sich auf der Vorburg symmetrisch zu beiden Seiten die Wirtschaftsgebäude, jenseits der zweiten erhebt sich das imposante Hauptschloss, flankiert von zwei Pavillons. Das klassizistische Gebäude wurde im 16. Jahrhundert zunächst im Renaissancestil errichtet und erst im 19. Jahrhundert dem damaligen vorherrschenden Architekturgeschmack angepasst. Später kamen im Zuge des Historismus neobarocke Stilelemente hinzu. Spatzierwege führen um das stolze Anwesen herum und bieten so von außen gute Besichtigungsmöglichkeiten.
Geschichtlicher Ablauf
|
1177 |
Erstmalige urkundliche Erwähnung von Crassenstein. Unklar sind bis heute aber der genaue Ort sowie Bauform und Aussehen des Anwesens. |
|
1372 |
Die Bischöfe von Münster und Osnabrück ziehen gegen den auf Crassenstein lebende Burggrafen Johann II. von Stromberg und erobern die Burg. |
|
1378 |
Johann II. von Stromberg wird begnadigt und erhält Crassenstein zurück. Das Anwesen ist Lehensburg des Grafens von Rietberg. |
|
1411 |
Verpfändung der Burg mit der Freigrafschaft an Lubbert I. von Wendt. |
|
1419 |
Endgültiger Verkauf an die Familie derer von Wendt |
|
1570 |
Das Schloss wird im Renaissancestil neu errichtet durch den Baumeister Laurenz von Brachum. Es entstand ein Haupttrakt mit zwei kleinen Seitenflügeln. |
|
1840 |
Umbau und Ausrichtung des Schlosses im klassizistischen Stil durch Konrad Niemann. |
|
1855 |
Die Familie von Ansembourg erwirbt das Wasserschloss und behält es bis zum heutigen Tage. |
|
1922 |
Bei weiteren Umbauarbeiten werden der Schlossanlage neobarocke Elemente hinzugefügt. Dabei entstand wurde dem Gebäude auch das Mansardendach aufgesetzt. |
Das Kloster Lisborn wurde ursprünglich um 815 als Benediktinerinnenkloster gegründet. Im Jahre 1131 verließen die Nonnen den Stift und die Anlage wurde zum Benediktinerkloster umgewandelt. 1270 und 1353 wurden die Klostergebäude durch verheerende Feuer jeweils fast vollständig zerstört und danach wieder neu aufgebaut. Die Abteikirche wurde im 15. Jahrhundert in Form einer gotischen Hallenkirche errichtet. Der vierstöckige romanische Turm mit der patinabesetzten Kupferhaube stammt wohl noch aus der Zeit um 1100. Im 18. Jahrhundert wurden die Klostergebäude noch einmal neu errichtet, doch im Zuge der Säkularisierung hob man das Kloster 1803 auf. Im Jahre 1966 richtete der Kreis Warendorf in den Klosterräumen ein Museum für Kunst und Kulturgeschichte ein. Auf 3000 m² tritt traditionelle Kunst mit moderner Kunst in einen verbindenden Dialog. Die Sammlung umfasst Kunst des Mittelalters, der Renaissance und des Barock genauso wie Gemälde, Graphiken und Plastiken aus dem 19. und 20. Jahrhundert, antike Möbel sowie eine Textilsammlung mit Tüchern aus dem 19. Jahrhundert. Bemerkenswert ist die Sammlung von Kreuzen, Kruzifixen und Kreuzigungsdarstellungen. Sie umfasst ungefähr 500 Exemplare und gilt als die größte ihrer Art in Europa. Die ältesten Exponate entstammen der Romanik, aber es werden auch moderne Objekte gezeigt, darunter Arbeiten von berühmten Künstlern, wie Salvador Dalí, Marc Chagall und Joseph Beuys. Ein Bereich des Museums widmet sich dem bekannten Heimatdichter Augustin Wibbelt (1862 – 1947). Dieser erlangte im Münsterland Beliebtheit durch seine Gedichte in niederdeutscher Sprache. Das Museum zeigt Möbel und Einrichtungsgegenstände des dichtenden Pastors.
Die Margarethenkirche im Zentrum von Wadersloh ist durch ihren 84 m hohen Turm das überragende Bauwerk des Ortes. Sie wurde zwischen 1890 und 1894 durch den Baumeister Rincklake im neugotischen Stil errichtet. Bei der Innenausstattung ist der Taufstein aus dem 15. Jahrhundert besonders sehenswert.
Radrouten die durch Wadersloh führen:
100 Schlösser Route – Ostkurs
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Lippetal
ie Gemeinde Lippetal existiert erst seit der kommunalen Neugliederung 1969. Da wurden elf zuvor selbstständige Dörfer zwischen Hamm und Lippstadt zu einer Gemeinde zusammengefasst. Als die älteste Siedlung gilt Herzfeld. Schon 786 wurde der Wallfahrtsort erstmals urkundlich erwähnt, um 800 wurde hier die erste Steinkirche östlich des Rheins erbaut. Die heutige St.-Ida-Kirche wurde zwar erst 1903 fertig gestellt, aber die neugotische Basilika erhielt den Beinamen ‚Weißer Dom an der Lippe’ und wird jährlich von ungefahr 40.000 Pilgern aufgesucht. Unbedingt sehenswert sind auch das Schloss Hovestadt, ein Wasserschloss aus dem 18. Jahrhundert mit französischem Park sowie Schloss Assen, einem Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert und die St.-Stephanus-Kirche in Oestringhausen mit ihrem kennzeichnenden Zwiebelturm. Im Ortsteil Lippborg gibt es noch einen Bahnhof, an dem allerdings kein regelmäßiger Personenverkehr mehr stattfindet. Aber hier hält noch die Museumsbahn Hamm mit ihrer alten Dampflokomotive.
Sehenswertes:
Das reizvolle Schloss Hovestadt blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Direkt an einer Furt der Lippe gelegen, wurde es im Mittelalter wegen seiner strategisch wichtigen Lage mehrfach in bewaffnete Konflikte verwickelt, zerstört und jeweils wieder aufgebaut. So wurde der alte Rittersitz im Laufe der Zeit immer weiter zur wehrhaften Wasserburg ausgebaut, ehe es im 16. Jahrhundert aus repräsentativen Gründen zum Schloss im Stile der Lipperenaissance umgebaut wurde. Die Vorburg der Zwei-Insel-Anlage wurde schließlich im 18. Jahrhundert vom berühmten westfälischen Baumeister Johann Conrad Schlaun im barocken Stil umgestaltet. Das Wasserschloss war ursprünglich als geschlossene Vierflügelanlage konzipiert worden, aber nur Nord- und Ostflügel sowie der mächtige dreistöckige Pavillonturm wurden verwirklicht. Die Fassade des Hauptschlosses besitzt an der Wasserseite eine umfangreiche Verzierung aus Rauten, Kreisen, Bändern und anderen aus Ziegeln und Sandstein geformten Mustern. Kleine Löwenköpfe schauen aus dem dekorierten Mauerwerk. Der französische Garten entstand Mitte des 18. Jahrhunderts nach Plänen von Clemens August von Vagedes und ist dem Besucher frei zugänglich. Bemerkenswert ist ein kleines Heckentheater, welches direkt an die Innengräfte anschließt.
Geschichtlicher Ablauf
|
1292 |
Erstmalige urkundliche Erwähnung als Rittersitz des Dietrich von Hovestadt. |
|
1303, 1346 |
Wegen der strategischen Lage in der Lippeniederung an einer Furt an der Grenze zu Kur-Köln wurde Burg Hovestadt mehrfach zerstört, jeweils aber wieder aufgebaut. |
|
1483 |
Godert Ketteler übernimmt die Wasserburg und das Amt Hovestadt zunächst als Pfand. Die Burg blieb aber im Familienbesitz. |
|
1563-72 |
Neubau als Renaissanceschloss durch Laurenz von Brachum. Bauherr war Goswin von Ketteler. Vom ursprünglich geplanten Vier-Flügel-Bau wurden aber nur zwei Flügel sowie ein Pavillonturm, verwirklicht. |
|
1649 |
Nachdem die Linie derer von Ketteler augestorben war, übernahmen die Freiherren von Haiden zu Schönrade und Boke das Schloss Hovestadt. |
|
1710 |
Der Freiherr und spätere Graf Friedrich Bernhard Wilhelm von Plettenberg-Lenhausen erwirbt die Anlage. |
|
1733 |
Johann Conrad Schlaun gestaltet auf der Vorburg Torhäuser und Wirtschaftsgebäude im barocken Stil. |
|
1735 |
Um- und Ausbau der Schlossanlage zu der heute noch erhaltenen Form. |
|
18. Jhd. |
Der Barockgarten wird nach französischem Vorbild angelegt. Die Pläne stammen zum Teil von Clemens August von Vagedes. |
Im Ortsteil Lippborg liegt etwas abseits gelegen das Wasserschloss Assen. Die Anlage wurde im Mittelalter zwar zunächst als typische Wasserburg des Zwei-Insel-Typs konzipiert, änderte seine Charakteristik im 15. Jahrhundert zu einer Doppelschlossanlage mit zwei Herrenhäusern, Alt- und Neu-Asseln. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden beide Häuser durch Heirat wiedervereinigt.
Der älteste Teil des Schlosses ist der wuchtige Rundturm auf der Vorburg, dessen Unterbau wohl noch aus dem 14. Jahrhundert stammt. Das Herrenhaus Neu-Asseln stammt von dem bekannten Renaissance-Baumeister Laurenz von Brachum, der das Gebäude im Stil der Lipperenaissance direkt an den Rundturm angliederte.
Das Schloss, das seit dem Ende des 20. Jahrhunderts als katholisches Knaben-Internat dient, wird von hohen Bäumen umgeben und ist daher nur schlecht aus der Ferne einsehbar.
Geschichtlicher Ablauf
|
1023 |
Erstmalige urkundliche Erwähnung, als Kaiser Heinrich II. den Amtshof Honsel dem Kloster Abdinghof in Paderborn schenkte. Zu diesem Amtshof gehörte auch die ‚borch tor Assen’. |
|
1350 |
Urkundliche Erwähnung der Burg, dessen Besitzer zu dieser Zeit Wennemar von Oldendorpe war. |
|
1384 |
Verkauf der Burg als Lehen an Röttger von Ketteler. In den folgenden Jahren wurde das Gut Assen umgebaut. Aus dieser Zeit stammt auch das älteste noch vorhandene Teil des Schlosses, der Unterbau des Rundturmes. |
|
1455 |
Die Wasserburg wird aufgeteilt zwischen den Nachfahren Röttger von Kettelers. Es entstanden Alt-Assen und auf der Vorburg Neu-Assen. In der Folgezeit wird Alt-Assen weitgehend um- und ausgebaut. |
|
1564 |
Neubau von Neu-Asseln. Bauherr war Goswin von Ketteler, Baumeister der bekannte Architekt Laurenz von Brachum. An den mächtigen Rundturm wird ein Schloss im Stil der Lipperenaissance angefügt. |
|
1590 |
Durch Heirat werden beide Häuser wiedervereinigt. |
|
1653 |
Verkauf des Renaissanceschlosses an Heinrich von Galen. |
|
1855-58 |
Bau der Schlosskapelle im neugotischen Stil durch Wilhelm Buchholtz. Die Pläne hierzu lieferte Hilger Hertel, der sich zuvor durch Arbeiten am Kölner Dom einen Namen gemacht hatte. |
|
1910 |
Erneuerung des Rundturmes. |
|
1997 |
Christoph Bernhard Graf von Galen schenkt Haus Assen der Ordensgemeinschaft Diener Jesu und Mariens (SJM). Diese betreibt heute das ‚Kolleg Kardinal von Galen’, ein Internat für Jungen in dem Wasserschloss. |
Im Ortsteil Herzfeld steht die zwischen 1900 und 1903 erbaute neugotische St-Ida-Kirche. Die Basilika mit ihrem spitzen Turm von 88 m ist das höchste Gebäude in Lippetal und bekam den Beinamen ‚Weißer Dom an der Lippe’. Herzfeld gilt als die älteste Siedlung der Gemeinde und ist auch der älteste Wallfahrtsort in der Diösis Münster. 40.000 Pilger ziehen jährlich zum Gotteshaus, um den Schrein der hl. Ida zu besuchen und dort zu beten. Ida war 825 gestorben und in einem Vorgängerbau beigesetzt worden. Die Reliquien mit dem Schrein der Heiligen befinden sich heute in der Grabkrypta. Die Inneneinrichtung weist noch einige weitere Sehenswürdigkeiten auf: den Hochaltar, den Taufbrunnen (1520), der Passionsaltar im südlichen Seitenschiff sowie die Ida-Kapelle.
Die Basilika besaß bereits zwei Vorgängerbauten aus dem 8. und 13. Jahrhundert und wahrscheinlich hat sich hier zuvor bereits auch eine heidnische Kultstätte befunden. Hinter der Szenerie: Die heilige Ida Ida war eine fränkische Grafentochter, verwandt mit Karl dem Großen und vermählt mit Egbert, einem Sachsenherzog. Zusammen mit Herzog Egbert zog Ida durch Westfalen und bekam in einer Vision den Auftrag, am Ufer der Lippe im heutigen Herzfeld eine Kirche zu errichten. Als ihr Gemahl im Jahre 811 starb, wurde er in dieser Kirche begraben. Fortan wohnte Ida in einem über das Grab gebauten Portikus und weihte ihr ganzes Leben anderen Menschen in der Not. Am 4. September 825 wurde auch sie zum Herrn abberufen und in der Kirche beigesetzt. Sofort setzte ein Strom von Menschen ein, der am Grab der Ida betete und diese Wallfahrt hat bis heute nicht aufgehört. Am 26. November 980 wurde Ida heilig gesprochen. Ihre Gebeine ruhen in einem wertvollen Schrein in der Grabkrypta der St. Ida-Kirche.
Die St.-Stephanus-Kirche im Ortsteil Oestringhausen gehört zu den markantesten Gebäuden der Gemeinde Lippetal. Der Sandsteinbau wurde bereits um 1000 im romanischen Stil errichtet und im 13. Jahrhundert zur Kreuzanlage erweitert. Ihre charakteristische Welsche Haube, ein Markenzeichen des Barock, erhielt sie aber erst 1715. Bemerkenswert ist der barocke Hauptaltar aus dem 17. Jahrhundert.
Die weiß verputzte ‚Sändkers Windmühle’, benannt nach den letzten Müllern und Besitzern der Anlage, steht im Ortsteil Heintrop. Erbaut wurde sie 1858 durch den Müller Horstmann als Ersatz für einen Vorgängerbau an anderer Stelle. 1867 wurde die Mühle durch die Familie Sändkers übernommen, die sie bis 1976 betrieb. Zwischenzeitlich erhielt das Mahlwerk einen 20-P.S.-Elektromotor zur Unterstützung an windschwachen Tagen und das Mühlengebäude wurde durch einen dreistöckigen Anbau ergänzt.
Nach einer grundlegenden Renovierung wurde die Windmühle in den 1990er Jahren zum ‚Industriellen Kulturdenkmal’ erklärt und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. 2009 ist auch das Mahlwerk zu Demonstrationszwecken wieder instand gesetzt worden.
Der Förderverein Sändkers Mühle hat sich zum Ziel gesetzt, die Windmühle zu erhalten und auszubauen. Hier finden jetzt regelmäßig Mühlenfeste statt, man kann sich in den Räumlichkeiten trauen lassen und auch Führungen können organisiert werden.
Im Ortsteil Oestinghausen steht das Chur-Köllnische Amtshaus. Das Gebäude ist ein reizendes Fachwerkhäuschen mit verzierter Fassade aus dem 16. Jahrhundert. Das ehemalige Amtshaus gilt als der hübscheste Fachwerkbau in der Gemeinde Lippetal.
Radrouten die durch Lippetal führen:
100 Schlösser Route – Ostkurs
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe Route
Hamm
ie heutige Großstadt Hamm am nordöstlichen Rand des Ruhrgebietes wurde 1226 als Planstadt vom Grafen von der Mark gegründet und mit Stadtrechten versehen. Die Pauluskirche im Zentrum der Stadt ist Hamms ältestes Wahrzeichen. Von 1882 bis 1955 war Hamm Badekurort und durfte sich bis 1955 ‚Bad Hamm’ nennen. Der Kurpark mit seinem historischen Kurhaus zeugt noch von dieser Zeit. Der Park mit seinem alten Baumbestand und seinen bezaubernden Seen wird als Naherholungsgebiet von den Hammer Bürgern viel genutzt und erhielt im Jahre 2009 ein neues Gradierwerk. Hamm liegt an der Lippe und dem parallel dazu verlaufenden Datteln-Hamm-Kanal, der vom Dortmund-Ems-Kanal abzweigt und im Stadtteil Uentrop endet. Der am Kanal liegende Stadthafen ist der zweitgrößte öffentliche Kanalhafen Deutschlands. Am ehemaligen Grenzfluss Lippe befinden sich noch eine Reihe alter und sehenswerter Wasserschlösser. Der Kern des neugotisch umgebauten Schloss Heesen stammt aus noch dem 16. Jahrhundert, das im 17. Jahrhundert von Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg erbaute Schloss Oberwerries dient heute der Stadt Hamm für repräsentative Empfänge. Der aufgeschüttete Erdhügel der nur noch als Bodendenkmal erhaltenen Wasserburg Mark ist die größte und besterhaltende Motte Westfalens. Geprägt wurde die Wirtschaft Hamms lange Zeit durch den Bergbau. Das ehemalige Bergwerk Heinrich Robert, zuletzt Teil des Bergwerk Ost, schloss als letzte Zeche am 30. September 2010 und beendete damit eine Ära. Von seiner Abräumhalde, der Kissinger Höhe, hat man bei klarem Wetter einen wunderbaren Blick über die Stadt und die weitere Umgebung. Bereits vorher hatten die Zechen Radbod mit seinen drei charakteristischen Fördertürmen, Sachsen und Maximilian geschlossen. Im Jahre 1984 fand im Hamm auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Maximilian die Landesgartenschau statt. Der Mittelpunkt des Landschaftsparks ist der begehbare 40 Meter hohe ‘Gläserner Elefant’ von Horst Röllecke. Die ‚Maxi’ genannte Skulptur wurde zum Maskottchen der Stadt Hamm. Überall im Stadtgebiet finden sich heute Elefanten in verschiedenen Formen, Farben und Größen. Sehenswert sind darüber hinaus der hinduistische Sri Kamadchi Ampal Tempel in Uentrop sowie der neugotische Hauptbahnhof, der als einer der Schönsten in Deutschland gilt.
Sehenswertes:
 Die evangelische Pauluskirche ist das bedeutendste Gotteshaus und Wahrzeichen der Stadt Hamm. Wann genau der gotische Bau errichtet wurde, ist nicht bekannt. Ihre Ursprünge liegen vermutlich im 12. Jahrhundert. Wesentliche Anbauten, wie das Querhaus und der Chor, entstammen dem 13. Jahrhundert, der Turm und das Langhaus dem 14. Jahrhundert. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Kirche schwer beschädigt. Beim Wiederaufbau erhielt der knapp 80 m hohe Turm seine pyramidenförmige Haube. Die Pauluskirche war zunächst eine katholische Pfarrkirche und ursprünglich den Heiligen Georg und Laurentius geweiht. Im 16. Jahrhundert fiel das Gotteshaus an die Protestanten, die den Kircheninnenraum von jeglichem Schmuck befreiten. Den Namen des Apostels Paulus erhielt die Kirche erst 1912.
Die evangelische Pauluskirche ist das bedeutendste Gotteshaus und Wahrzeichen der Stadt Hamm. Wann genau der gotische Bau errichtet wurde, ist nicht bekannt. Ihre Ursprünge liegen vermutlich im 12. Jahrhundert. Wesentliche Anbauten, wie das Querhaus und der Chor, entstammen dem 13. Jahrhundert, der Turm und das Langhaus dem 14. Jahrhundert. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Kirche schwer beschädigt. Beim Wiederaufbau erhielt der knapp 80 m hohe Turm seine pyramidenförmige Haube. Die Pauluskirche war zunächst eine katholische Pfarrkirche und ursprünglich den Heiligen Georg und Laurentius geweiht. Im 16. Jahrhundert fiel das Gotteshaus an die Protestanten, die den Kircheninnenraum von jeglichem Schmuck befreiten. Den Namen des Apostels Paulus erhielt die Kirche erst 1912.  Die barocke Martin-Luther-Kirche wurde zwischen 1734 und 1739 erbaut. Man nannte die ehemalige preußische Garnisonskirche lange Zeit auch ‘Kleine Evangelische Kirche’, bis im Jahre 1912 der jetzige Name eingeführt wurde. Ein ganzer Stadtteil in der Innenstadt wurde nach der Kirche benannt.
Die barocke Martin-Luther-Kirche wurde zwischen 1734 und 1739 erbaut. Man nannte die ehemalige preußische Garnisonskirche lange Zeit auch ‘Kleine Evangelische Kirche’, bis im Jahre 1912 der jetzige Name eingeführt wurde. Ein ganzer Stadtteil in der Innenstadt wurde nach der Kirche benannt. Die Kirche St. Agnes ist das einzige katholische Gotteshaus in der Hammer Innenstadt. Ursprünglich wurde sie als Klosterkirche des Franiskaner-Observaten-Ordens in den Jahren 1507 bis 1515 als Nachfolgebau für deine Vorgängerkirche aus dem 15. Jahrhundert errichtet.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die St.-Agnes-Kirche schwer in Mitleidenschaft gezogen, so dass nur die östlichen Außenmauern vom ursprünglichen Zustand erhalten sind.
In der Dorfschaft Mark steht die älteste Kirche Hamms. Sie wurde im 11. Jahrhundert wohl im romanischen Stil errichtet und war lange Zeit die Hauptkirche der Stadt. Der Sandsteinbau ist heute weiß verputzt. Das niedrige Langhaus wird vom Querschiff und dem Chor überragt. Der zweistöckige Turm wurde 1735 um ein Glockengeschoss erhöht. Vielen gilt die evangelische Kirche als das schönste Gotteshaus der Stadt.
Anfang des letzten Jahrhunderts fand man im Bereich des Chores Fresken, die aus dem 14. Jahrhundert stammen und in dieser Form einzigartig in ganz Westfalen sind. Beachtenswert ist der im 13. Jahrhundert entstanden Taufstein aus Baumberger Sandstein.
 Das Eisenbahnmuseum ist als Freilichtmuseum ein Teil des Maximilianparks. Die hier aufgebaute Gleisanlage entspricht der Darstellung eines Personen- und Güterverkehrsbahnhof der 50er Jahre. Im Lokschuppen sind die verschiedenen Lokomotiven, Güterwaggons und Personenwagen zu bestaunen. Zum Eisenbahnmuseum gehört auch eine funktionsfähige Eisenbahnstrecke. Auf der Route von Welver-Ramesohl nach Lippborg-Heintrop kann man die Museumseisenbahn für Ausflugsfahrten mieten. Zwei Dampf- und drei Dieselloks, allesamt über fünfzig Jahre alt, ziehen die historischen Waggons.
Das Eisenbahnmuseum ist als Freilichtmuseum ein Teil des Maximilianparks. Die hier aufgebaute Gleisanlage entspricht der Darstellung eines Personen- und Güterverkehrsbahnhof der 50er Jahre. Im Lokschuppen sind die verschiedenen Lokomotiven, Güterwaggons und Personenwagen zu bestaunen. Zum Eisenbahnmuseum gehört auch eine funktionsfähige Eisenbahnstrecke. Auf der Route von Welver-Ramesohl nach Lippborg-Heintrop kann man die Museumseisenbahn für Ausflugsfahrten mieten. Zwei Dampf- und drei Dieselloks, allesamt über fünfzig Jahre alt, ziehen die historischen Waggons. Im Jahre 1984 fand im Hamm auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Maximilian die Landesgartenschau statt. Auf dem weiträumigen 14.000m² großen Haldengelände entstand eine reizvolle Parklandschaft mit Blumenrabatten und -beeten. Origineller Mittelpunkt ist der 40m hoch ‘Gläserner Elefant’. Ihr Schöpfer Horst Röllecke hat seine Skulptur als begehbaren Erlebnisraum gestaltet. Besonders beeindruckend ist die bunte Vielfalt von Schmetterlingen und Faltern, die der Besucher im größten tropischen Schmetterlingshaus Nordrhein-Westfalens entdecken kann. Von einer 35m hohen Aussichtsplattform kann sich der Gast einen weiten Überblick über die vielfältig gestaltete Anlage verschaffen. Auf der Freilichtbühne finden in den Sommermonaten die unterschiedlichsten kulturellen Darbietungen statt, von Konzerten über Theateraufführungen bis hin zu Kleinkunstveranstaltungen.

Nördlich von Hamm nahm im Jahre 1905 die Zeche Radbod ihren Betrieb auf. Die Schächte reichen in eine Teufe von ungefähr 850m. 1989 wurde mit über 1,3 Mio Tonnen Steinkohle die höchste Jahresmenge gefördert. Ein Jahr später war Schicht im Schacht und die Zeche wurde geschlossen. Zu einem folgenschweren Zwischenfall kam es gleich zu Beginn im Jahre 1908, als bei einer Schlagwetterexplosion 348 Kumpel ums Leben kamen. Heute erinnern nur noch drei hintereinander hoch aufragende Fördertürme an die alte Zechenzeit. Sie sind zu Wahrzeichen des Stadtteils Bockum-Hövel geworden.
 1912 eröffnet, hatte die Zeche Sachsen eine wechselvolle Geschichte, in deren Verlauf viele Bergleute ihr Leben unter Tage verloren. Der Name ‘Sachsen’ geht auf die Bergbaugewerkschaft zurück, die damals ihre Zentrale im sächsischen Eisleben hatte. Die Schächte, in denen die begehrte ‚Fettkohle’ gefördert wurde, reichten über 1000m tief. Noch im Jahre 1962 wurden über 1,2 Mio Tonnen Steinkohle zu Tage gefördert. Zu diesem Zeitpunkt waren über 3200 Kumpel beschäftigt. Die Zeche gab 1976 ihren Betrieb auf, heute erinnert noch das klassizistische Maschinenhaus von 1912 an die Förderzeit. Der opulente Bau erhielt den Namen ‘Alfred-Fischer-Halle’ und dient heute als Veranstaltungszentrum. Nordwestlich der ehemaligen Zeche liegt die Kolonie Vogelsang. Sie gilt als eine typische geschlossene Bergarbeitersiedlung der 20er Jahre.
1912 eröffnet, hatte die Zeche Sachsen eine wechselvolle Geschichte, in deren Verlauf viele Bergleute ihr Leben unter Tage verloren. Der Name ‘Sachsen’ geht auf die Bergbaugewerkschaft zurück, die damals ihre Zentrale im sächsischen Eisleben hatte. Die Schächte, in denen die begehrte ‚Fettkohle’ gefördert wurde, reichten über 1000m tief. Noch im Jahre 1962 wurden über 1,2 Mio Tonnen Steinkohle zu Tage gefördert. Zu diesem Zeitpunkt waren über 3200 Kumpel beschäftigt. Die Zeche gab 1976 ihren Betrieb auf, heute erinnert noch das klassizistische Maschinenhaus von 1912 an die Förderzeit. Der opulente Bau erhielt den Namen ‘Alfred-Fischer-Halle’ und dient heute als Veranstaltungszentrum. Nordwestlich der ehemaligen Zeche liegt die Kolonie Vogelsang. Sie gilt als eine typische geschlossene Bergarbeitersiedlung der 20er Jahre. Ursprünglich wurde das Gustav-Lübcke-Museum als Heimatmuseum bereits im 19. Jahrhundert eröffnet. 1917 stiftete Gustav Lübcke seine kunsthandwerkliche Sammlung der Stadt Hamm. Sie umfasste Gegenstände vom Mittelalter bis zur damaligen Gegenwart. Heute zeigt das Museum eine umfangreiche eigene Sammlung der Klassischen Moderne und der zeitgenössischer Kunst. Darüber hinaus betreibt das Museum eine der größten ägyptischen Sammlungen Deutschlands. Zu bestaunen gibt es eine Vielzahl von Mumien und archäologischen Ausgrabungsfunden. 1993 zog das Gustav-Lübcke-Museum in seine neues Domizil, einem modernen Museumsbau in der Neuen Bahnhofstraße um.
Das Kulturbüro organisiert in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Hamm e.V. im Stadthaus Wechselausstellungen mit Werken einheimischer Künstler sowie Arbeiten von darstellenden Künstlern der Partnerstädte.
Im Jahre 1933 entstand auf dem Gelände des ehemaligen Südenstadtparks der Tierpark Hamm. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Zoo leider zerstört, 1950 aber wieder neu aufgebaut. Heute leben in den Tiergehegen Löwen, Tiger und Leoparden, Kamele, Kängurus und Nasenbären, Papageien und Uhus. Im Reptilienhaus kann man Schlangen wie eine Python und eine Boa Constrictor bewundern, aber auch Wasserschildkröten beim Schwimmen beobachten. Der Tierpark besitzt einen Streichelzoo und vielfältige Spielmöglichkeiten für Kinder, wie Karussells, eine Eisenbahn und einen Autoscooter. Im angegliederten Naturkundemuseum zeigt eine Dauerausstellung Präparate der heimischen Tierwelt, die eine umfangreiche Käfer- und Schmetterlingssammlung beinhaltet. Ziel ist es, in der Zukunft einmal ein komplettes Bild der Heimattierwelt präsentieren zu können.
 In einem Parkgelände unweit der Ahse befindet sich die größte und besterhaltende Motte Westfalens. Eine Motte ist ein zur Verteidigung aufgeschütteter Erdhügel, auf dem eine Burganlage errichtet wurde. Die Oberburg von Burg Mark wurde auf einer sieben Meter hohen Motte errichtet. Eine Gräfte umfloss sowohl die Oberburg als auch die Vorburg, auf der sich die Wirtschaftsgebäude befanden. Die Gesamtlänge der Anlage betrug 200 Meter und war damit für die damalige Zeit ungewöhnlich groß. Burg Mark war eine so genannte Ringmantelburg mit zwei Türmen. Die Außenmauer umschloss kreisförmig den Innenhof und bot so zusammen mit dem Hügel und den Wassergräben einen wirkungsvollen Schutz gegen Angreifer. Von der ehemaligen, gegen Ende des 12. Jahrhunderts errichteten Burganlage Mark ist heute noch der Erdhügel erhalten, auf dem sie einst gestanden hat. Das Mauerwerk ist längst abgebrochen worden. Der Bereich der Vorburg ist heute mit hohen Bäumen bewachsen. Ein Brunnen aus Bruchstein hat sich hier als Relikt noch erhalten. Dieser wurde im 19. Jahrhundert erstmals erwähnt, das genaue Jahr seiner Erbauung ist jedoch nicht bekannt.
In einem Parkgelände unweit der Ahse befindet sich die größte und besterhaltende Motte Westfalens. Eine Motte ist ein zur Verteidigung aufgeschütteter Erdhügel, auf dem eine Burganlage errichtet wurde. Die Oberburg von Burg Mark wurde auf einer sieben Meter hohen Motte errichtet. Eine Gräfte umfloss sowohl die Oberburg als auch die Vorburg, auf der sich die Wirtschaftsgebäude befanden. Die Gesamtlänge der Anlage betrug 200 Meter und war damit für die damalige Zeit ungewöhnlich groß. Burg Mark war eine so genannte Ringmantelburg mit zwei Türmen. Die Außenmauer umschloss kreisförmig den Innenhof und bot so zusammen mit dem Hügel und den Wassergräben einen wirkungsvollen Schutz gegen Angreifer. Von der ehemaligen, gegen Ende des 12. Jahrhunderts errichteten Burganlage Mark ist heute noch der Erdhügel erhalten, auf dem sie einst gestanden hat. Das Mauerwerk ist längst abgebrochen worden. Der Bereich der Vorburg ist heute mit hohen Bäumen bewachsen. Ein Brunnen aus Bruchstein hat sich hier als Relikt noch erhalten. Dieser wurde im 19. Jahrhundert erstmals erwähnt, das genaue Jahr seiner Erbauung ist jedoch nicht bekannt.
Geschichtlicher Ablauf
|
1198 |
Burg Mark ist im Besitz des Grafen Friedrich von Berg-Altena. Er gilt als der wahrscheinliche Erbauer der Burg. |
|
1595 |
Nach einer Beschreibung bestand die Anlage zu diesem Zeitpunkt aus einer zweistöckigen Ringmantelburg auf einer Motte mit Vorburg. Beide Burgteile waren durch eine Wassergräfte umschlossen. |
|
18. Jhd. |
Nach Abbrucharbeiten blieb nur noch ein Rest der Ringmauer und ein Turm erhalten. |
|
1990 |
Burg Mark wird in die Liste der Bodendenkmäler aufgenommen. |
 Nahe der Lippe gelegen, befindet sich das Schloss Heesen, ein ehemaliges Rittergut und heutiges Internat. Von den an der Lippe aufgereihten Hammer Herrenhäusern ist Schloss Heesen das bedeutendste und prächtigste. Die Ursprünge des Oberhofes gehen bis in das 10. Jahrhundert zurück. Die Schlossanlage besteht aus insgesamt vier Häusern. Das Hauptgebäude ist ein dreiflügliger Backsteinbau und besitzt einen 30 m hohen Turm. Im Kern stammt das Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, ihr heutiges Erscheinungsbild bekam es jedoch erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Wasserschloss im neugotischen Stil umfangreich umgebaut wurde. Dabei erhielt es auch die gotischen Zinnen auf den Treppengiebeln, die das Schloss prägen. Im Jahre 2008 diente Schloss Heesen als Kulisse für den erfolgreichen Kinofilm ‚Die wilden Hühner’.
Nahe der Lippe gelegen, befindet sich das Schloss Heesen, ein ehemaliges Rittergut und heutiges Internat. Von den an der Lippe aufgereihten Hammer Herrenhäusern ist Schloss Heesen das bedeutendste und prächtigste. Die Ursprünge des Oberhofes gehen bis in das 10. Jahrhundert zurück. Die Schlossanlage besteht aus insgesamt vier Häusern. Das Hauptgebäude ist ein dreiflügliger Backsteinbau und besitzt einen 30 m hohen Turm. Im Kern stammt das Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, ihr heutiges Erscheinungsbild bekam es jedoch erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Wasserschloss im neugotischen Stil umfangreich umgebaut wurde. Dabei erhielt es auch die gotischen Zinnen auf den Treppengiebeln, die das Schloss prägen. Im Jahre 2008 diente Schloss Heesen als Kulisse für den erfolgreichen Kinofilm ‚Die wilden Hühner’. 975 Um 1200 Durch Heirat gelangt das Anwesen an die Grafen von Altena-Isenberg. 1243 Nach 1350 15. Jhd. 1590-1600 1775 1803 1806 1808 1813 1905-08 1957
Geschichtlicher Ablauf
Erstmalige urkundliche Erwähnung des Erbgutes ‚Hesnon’
Nach dem Ende der ‚Isenberger Wirren’ wurde der Rittersitz dem Haus Limburg zugesprochen.
Neubau einer Wasserburg an etwas versetzter Position.
Dietrich von der Recke lässt ein neues Herrenhaus errichten.
Neubau der Wirtschaftsgebäude auf der Vorburg.
Die Burganlage wird Bentheim-Tecklenburger Lehen und wird dem Freiherren Friedrich Joseph von Boeselager zu Nehlen und Höllinghofen vererbt. Dieses führte jedoch zu einem jahrzehntelangen Rechtsstreit innerhalb der Familie.
Rückgabe von Schloss Heesen an die Familie von der Recke.
Einnahme des Schlosses durch Napoléon und den verbündeten Holländern.
Die Familie derer von Boeselager erhält Schloss Heesen zurück und nutzt es als Wohnsitz.
Plünderungen während der Befreiungskriege.
Die verschiedenen Umbauten der letzten Jahrhunderte wurden rückgängig gemacht, so dass das Schloss seiner Grundform aus dem 18. Jahrhundert wieder glich. Darüber hinaus wurde die Fassade neugotisch überarbeitet und erhielt so die charakteristischen Zinnen an den Treppengiebeln.
Die Schlossgebäude werden als Landschulheim und als Internat genutzt.
Im Stadtteil Bockum-Hövel, im Norden von Hamm, befindet sich das ehemalige Rittergut Haus Ermelinghof. Vier Gebäude aus verschiedenen Epochen bilden zusammen die Wasserschlossanlage, die ursprünglich auf drei separaten Inseln lag. Diese bildeten die Hauptburg, die Vorburg mit den Wirtschaftsgebäuden und das Vorwerk mit der St.-Bartholomäus-Kapelle. Heute umfließt nur noch eine Gräfte das Schloss. Ältester Bestandteil des Gutes ist das Ziegelbrauhaus (1627) neben dem Herrenhaus mit seinem im Münsterland typischen Dreistaffelgiebel. Das dreistöckige Hauptschloss wurde nach einem verheerenden Feuer im Jahre 1875 wiedererrichtet. Die Fachwerkgebäude der Vorburg entstanden um 1800, das klassizistische Torhaus mit seinen griechisch anmutenden Säulen wurde 1831 fertig gestellt. Der Besitzer betreibt heute auf Haus Ermelinghof einen Reitstall. 1350 1410 Durch Heirat kommt der Hof in Besitz derer von Galen. 1627 1654 1787 Um 1800 1831 1840 1875
Geschichtlicher Ablauf
Erstmalige urkundliche Erwähnung des Rittergutes. Besitzer des Ermelinghofes war zu dieser Zeit die Familie Scheidingen.
Ein Großfeuer beschädigt die Hofanlage schwer. Danach entsteht neben dem Herrenhaus das bis heute nahezu unverändert gebliebene Ziegelbrauhaus mit seinem Dreistaffelgiebel.
Die dem heiligen Bartholomäus geweihte Schlosskapelle auf dem Vorwerk entsteht.
Durch eine Zwangsversteigerung kommt Haus Ermelinghof in den Besitz des Freiherrn Anton von Wintgen.
Bau der Wirtschaftsgebäude auf der Vorburg.
Bau des lang gestreckten klassizistischen Torhauses.
Durch Heirat kommt das Anwesen in den Besitz derer von Twickel.
Nachdem ein Feuer das Herrenhaus vollständig zerstört hatte, wird das Haupthaus im neugotischen Stil wieder errichtet.
 Mächtig ragt das zweistöckige Herrenhaus von Schloss Oberwerries direkt aus dem Wasser seiner Gräfte. Ambrosius von Oelde baute ab 1684 das zweiflüglige Herrenhaus für Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg. Das Schloss wird geprägt von seinem mächtigen, vorstehenden Pavillonturm. Der Marstall und der kleine Hundestall auf der Vorburg wurden von dem berühmten westfälischen Baumeister Johann Conrad Schlaun gestaltet. Der älteste Gebäudeteil ist das im Jahre 1667 er- oder umgebaute Torhaus. Möglicherweise ist das Bauwerk bedeutend älter, aber verlässliche Daten gibt es hierfür nicht mehr. Heute nutzt die Stadt Hamm das Schloss als Gästehaus, als Veranstaltungsort sowie für repräsentative Empfänge.
Mächtig ragt das zweistöckige Herrenhaus von Schloss Oberwerries direkt aus dem Wasser seiner Gräfte. Ambrosius von Oelde baute ab 1684 das zweiflüglige Herrenhaus für Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg. Das Schloss wird geprägt von seinem mächtigen, vorstehenden Pavillonturm. Der Marstall und der kleine Hundestall auf der Vorburg wurden von dem berühmten westfälischen Baumeister Johann Conrad Schlaun gestaltet. Der älteste Gebäudeteil ist das im Jahre 1667 er- oder umgebaute Torhaus. Möglicherweise ist das Bauwerk bedeutend älter, aber verlässliche Daten gibt es hierfür nicht mehr. Heute nutzt die Stadt Hamm das Schloss als Gästehaus, als Veranstaltungsort sowie für repräsentative Empfänge. 1284 1464 Verkauf der Burg Oberwerries an Gerd von Beverförde. 1667 1684-92 1730-35 1768 1781 1942 1952-75
Geschichtlicher Ablauf
Erstmalige urkundliche Erwähnung einer Burg zu Werries. Engelbert von Herbern wurde durch Dietrich von Limburg mit dem Besitz belehnt.
Das Torhaus ist der älteste erhaltene Teil der Schlossanlage. Auf Grund der gotischen Fenster wird vermutet, dass sich die im Maueranker eingemeißelte Jahreszahl 1667 nur auf einen Umbau bezieht, das Gebäude aber im Kern wesentlich älter ist.
Bau des Herrenhauses durch den Kapuzinermönch Ambrosius von Oelde für Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg, der es für seine Schwester Ida errichten ließ.
Der berühmte westfälische Baumeister Johann Conrad Schlaun errichtete auf der Vorburg das Marstallgebäude.
Durch Erbschaft kommt das Schloss in den Besitz der Familie von Elverfeldt.
Abermals durch Erbschaft gelangt das Anwesen in den Besitz derer von Beverförde-Werries auf Loburg bei Ostbevern. Das Schloss blieb jedoch lange Zeit unbewohnt und verfiel dadurch bedingt.
Zunächst erwirbt die Zeche Sachsen das baufällige Haus, verkauft es aber im gleichen Jahr weiter an die Stadt Hamm.
Restauration und Umbau der Schlossanlage. Zunächst wurde in den Räumen des Herrenhauses ein Berufslandschulheim untergebracht, heute dient es repräsentativen Empfängen der Stadt, als Veranstaltungsort und als Bildungs- und Begegnungsstätte.
Seit über 600 Jahren befindet sich das Wasserschloss Haus Uentrop im Besitz der Familie von der Recke. Das heutige Herrenhaus ist ein schlichtes, zweistöckiges Gebäude mit Walmdach. Es wurde im 18. Jahrhundert errichtet, nachdem die Vorgängerburg bei einem Feuer vernichtet worden war. Ursprünglich diente das Haus Uentrop der Grenzsicherung an der Lippe. Heute steht das Hauptschloss leer, die Wirtschaftsgebäude werden landwirtschaftlich genutzt. 1198 1328 Dietrich von Grimberg wird als Besitzer der Burg urkundlich erwähnt. 1393 1679 1713-20 1849 1860 1976
Geschichtlicher Ablauf
Haus Uentrop wird urkundlich erwähnt als grenzsichernde Ritterburg für den Grafen von Berg-Altena.
Hermann von der Recke erhält Haus Uentrop als Lehen.
Ein Großfeuer zerstört die Burg und die Wirtschaftsgebäude
Neubau des Schlosses durch die Familie von der Recke-Baer
Bau des Gesindeshauses
Die Scheune mit dem Staffelgiebel entsteht.
Bis 1976 wurde das Herrenhaus durch Mitglieder der Familie von der Recke bewohnt, seit dem steht das Gebäude leer.
Unmittelbar an der Autobahn A1 liegt im Stadtteil Lerche an der Grenze zu Bergkamen das Haus Reck. Vormals Haus zur Heide genannt, erhielt es seinen Namen ‚Reck’ erst Mitte des 16. Jahrhunderts. Haus Reck gehörte einst zu den zehn Burgmannshöfen von Kamen und diente somit dem Schutz des damaligen Grenzortes. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts erhielt der Hof mehr Eigenständigkeit. Das heutige Erscheinungsbild des gelb getünchten Herrenhauses mit seinem dreistöckigen Wehrturm entstammt aber erst dem 19. Jahrhundert. 12 Jhd. 14 Jhd. Der Burgmannshof ist im Besitz von Dietrich von der Recke. 1465 16 Jhd. 1649 1709 1715 1775 1821
Geschichtlicher Ablauf
Bau einer befestigten Residenz in Kamen durch die Grafen von Altena. In der Folgezeit entstanden zehn Burgmannshöfe an der damaligen Ortsgrenze, zu denen auch das damals noch Haus zur Heide genannte Anwesen gehörte.
Das Haus zur Heide wird zur festen Burg ausgebaut.
Mitte des Jahrhunderts entstanden als Wirtschaftsgebäude das Bauhaus und das Hallenhaus. Der Hof wird jetzt Haus Reck genannt.
Stiftung der Kapelle auf der Vorburg.
Die Herrlichkeit Reck entsteht mit eigenem Verwaltungs- und Gerichtsbezirk.
Bau der Backsteinscheune.
Der Schafstall entsteht im Fachwerkbauweise.
Verkauf des Gutes an den Freiherrn von Syberg zu Busch. In der Folgezeit werden das Herrenhaus und der Wehrturm erheblich umgebaut.
Das im späten Mittelalter errichtete Brauhaus Henin gilt nach der Schlossmühle Heesen als das älteste Gebäude der Stadt Hamm. Der Bau des Fachwerkhauses wird auf das Jahr 1516 datiert und erhielt seinen Namen von der Familie Henin, die das Gebäude im 18. Jahrhundert bewohnte. Heute dient das alte Brauhaus wieder als Gaststätte.
 Im Jahre 1876 stieß man bei Probebohrungen, bei denen man hoffte, Kohle zu finden, auf eine Sohlequelle. So wurde die Stadt 1882 Badekurort und durfte sich bis 1955 ‚Bad Hamm’ nennen. Im Jahre 1882 entstand dann auch der 34 ha große Kurpark. Er liegt südlich vom Datteln-Hamm-Kanal und schließt sich östlich an die Innenstadt an. Heute ist der Kurpark ein viel genutztes Naherholungsgebiet mit mehreren Seen, weiträumigen Rasenflächen und einem alten Baumbestand, der noch aus den Anfängen des Parks stammt. Skulpturen säumen die Spatzierwege durch das Gelände. Im Zentrum befindet sich das repräsentative denkmalgeschützte Kurhaus. Im Jahre 2009 wurde im westlichen Teil des Kurparks eine 41 m lange und über 9,5 m hohe Saline errichtet. Obwohl noch weitere Sohlevorkommen im Erdreich vermutet werden, wird das Gradierwerk von einem großen Tank gespeist. Alljährlich findet mit dem Kurparkfest ein großes Volksfest statt, bei dem viele namhafte Künstler auftreten und dessen Höhepunkt ein abendliches Großfeuerwerk ist.
Im Jahre 1876 stieß man bei Probebohrungen, bei denen man hoffte, Kohle zu finden, auf eine Sohlequelle. So wurde die Stadt 1882 Badekurort und durfte sich bis 1955 ‚Bad Hamm’ nennen. Im Jahre 1882 entstand dann auch der 34 ha große Kurpark. Er liegt südlich vom Datteln-Hamm-Kanal und schließt sich östlich an die Innenstadt an. Heute ist der Kurpark ein viel genutztes Naherholungsgebiet mit mehreren Seen, weiträumigen Rasenflächen und einem alten Baumbestand, der noch aus den Anfängen des Parks stammt. Skulpturen säumen die Spatzierwege durch das Gelände. Im Zentrum befindet sich das repräsentative denkmalgeschützte Kurhaus. Im Jahre 2009 wurde im westlichen Teil des Kurparks eine 41 m lange und über 9,5 m hohe Saline errichtet. Obwohl noch weitere Sohlevorkommen im Erdreich vermutet werden, wird das Gradierwerk von einem großen Tank gespeist. Alljährlich findet mit dem Kurparkfest ein großes Volksfest statt, bei dem viele namhafte Künstler auftreten und dessen Höhepunkt ein abendliches Großfeuerwerk ist. Auf einem alten Bauerngehöft aus dem 17. Jahrhundert befindet sich heute die 1996 ins Leben gerufene Ottmar-Alt-Stiftung. Auf dem 10.000m² große Anwesen sind Ateliers für Stipendiaten und mehrere Ausstellungsräume untergebracht, in denen Wechselausstellungen bildender Künstler, aber auch Kleinkunst- und Theaterveranstaltungen stattfinden. Auf dem Freigelände wurde ein umfangreicher Skulpturengarten eingerichtet.
 Der hinduistische Sri Kamadchi Ampal Tempel in Hamm-Uentrop ist der größte erbaute tamilische Tempel Europas. Er misst 27 x 27 Meter und besitzt einen Innenraum von 700 m². Streng nach den traditionellen rituellen Vorgaben konzipiert, wurde der Tempel im Jahre 2002 eröffnet. Das Tempelportal, der so genannte Gopuram wurde im südindischen Stil errichtet und misst eine stattliche Höhe von 17 Metern.
Der hinduistische Sri Kamadchi Ampal Tempel in Hamm-Uentrop ist der größte erbaute tamilische Tempel Europas. Er misst 27 x 27 Meter und besitzt einen Innenraum von 700 m². Streng nach den traditionellen rituellen Vorgaben konzipiert, wurde der Tempel im Jahre 2002 eröffnet. Das Tempelportal, der so genannte Gopuram wurde im südindischen Stil errichtet und misst eine stattliche Höhe von 17 Metern.  Das im Stil des Historismus errichtete Bahnhofsgebäude gilt als eines der Schönsten Deutschlands. Nachdem sich Hamm schon früh im 19. Jahrhundert als bedeutender Eisenbahnknotenpunkt entwickelt hatte, wurde 1861 das Gebäude als Inselbahnhof zwischen den Gleisen fertig gestellt. Der denkmalgeschützte Hauptbahnhof wurde in den letzten Jahren umfangreich restauriert. 2001 wurde die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, der jetzige Willy-Brandt-Platz, abgeschlossen.
Das im Stil des Historismus errichtete Bahnhofsgebäude gilt als eines der Schönsten Deutschlands. Nachdem sich Hamm schon früh im 19. Jahrhundert als bedeutender Eisenbahnknotenpunkt entwickelt hatte, wurde 1861 das Gebäude als Inselbahnhof zwischen den Gleisen fertig gestellt. Der denkmalgeschützte Hauptbahnhof wurde in den letzten Jahren umfangreich restauriert. 2001 wurde die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, der jetzige Willy-Brandt-Platz, abgeschlossen.  Die ehemalige Zeche Heinrich-Robert liegt im Hammer Stadtteil Herringen und war zuletzt Teil des zusammengelegten ‚Bergwerk Ost’. 1901 wurden die ersten Schächte abgeteuft, seit 1904 wurde schließlich Steinkohle gefördert. Die Endteufe betrug über 1.200 m und zeitweilig arbeiteten über 5.500 Kumpel auf der Zeche. Aber am 30. September 2010 wurde die letzte Schicht gefahren und damit wurde auch die letzte Zeche in Hamm geschlossen. Die Kissinger Höhe ist die Abräumhalde des Bergwerk Ost. In den Jahren 1974 bis 1998 wuchs sie auf eine Höhe von 55 Metern. Von oben hat man bei klarem Wetter eine wunderbare Sicht auf die Stadt Hamm und das weitere umland. Insgesamt 17 km Wanderwege mit verschiedenen Steigungsgraden erwarten den Besucher. Die Halde wurde als Nordic Walking Park ausgewiesen. Informationstafeln mit Routenbeschreibungen befinden sich am Fuße der Anhöhe. Auf dem Weg nach oben wurde ein Bergwerkslehrpfad einrichtet. Er zeigt Geräte aus dem Bergbau und beschreibt auf Tafeln die Techniken, die unter Tage angewendet werden.
Die ehemalige Zeche Heinrich-Robert liegt im Hammer Stadtteil Herringen und war zuletzt Teil des zusammengelegten ‚Bergwerk Ost’. 1901 wurden die ersten Schächte abgeteuft, seit 1904 wurde schließlich Steinkohle gefördert. Die Endteufe betrug über 1.200 m und zeitweilig arbeiteten über 5.500 Kumpel auf der Zeche. Aber am 30. September 2010 wurde die letzte Schicht gefahren und damit wurde auch die letzte Zeche in Hamm geschlossen. Die Kissinger Höhe ist die Abräumhalde des Bergwerk Ost. In den Jahren 1974 bis 1998 wuchs sie auf eine Höhe von 55 Metern. Von oben hat man bei klarem Wetter eine wunderbare Sicht auf die Stadt Hamm und das weitere umland. Insgesamt 17 km Wanderwege mit verschiedenen Steigungsgraden erwarten den Besucher. Die Halde wurde als Nordic Walking Park ausgewiesen. Informationstafeln mit Routenbeschreibungen befinden sich am Fuße der Anhöhe. Auf dem Weg nach oben wurde ein Bergwerkslehrpfad einrichtet. Er zeigt Geräte aus dem Bergbau und beschreibt auf Tafeln die Techniken, die unter Tage angewendet werden.  Der Stadthafen Hamm ist der zweitgrößte öffentliche Kanalhafen Deutschlands. Er liegt am Datteln-Hamm-Kanal und wird jährlich von über 1700 Schiffen angelaufen. Hauptumschlaggüter sind Getreide und andere Nahrungsmittel, Futtermittel, Kohle, Öl und Stahl. Der Hafen wurde zusammen mit dem Kanal im Jahre 1914 eröffnet. Bereits 100 Jahre zuvor hatte es einen Hafen an der Lippe gegeben. Doch der Fluss eignete sich nur bedingt für die Schifffahrt, da sich Wassertiefe und Strömungsverlauf der Lippe ständig veränderte. So wurde der Schiffsverkehr 1870 endgültig eingestellt.
Der Stadthafen Hamm ist der zweitgrößte öffentliche Kanalhafen Deutschlands. Er liegt am Datteln-Hamm-Kanal und wird jährlich von über 1700 Schiffen angelaufen. Hauptumschlaggüter sind Getreide und andere Nahrungsmittel, Futtermittel, Kohle, Öl und Stahl. Der Hafen wurde zusammen mit dem Kanal im Jahre 1914 eröffnet. Bereits 100 Jahre zuvor hatte es einen Hafen an der Lippe gegeben. Doch der Fluss eignete sich nur bedingt für die Schifffahrt, da sich Wassertiefe und Strömungsverlauf der Lippe ständig veränderte. So wurde der Schiffsverkehr 1870 endgültig eingestellt.  Das direkt an der Lippe liegende Gerstein-Kraftwerk ist eine der markantesten Industrieanlagen im Ruhrgebiet. Seine drei monumentalen Kühltürme sind weithin sichtbar. Bereits 1914 wurde das Kraftwerk errichtet und in den folgenden Jahrzehnten stetig ausgebaut. Zeitweilig war es das größte Steinkohlekraftwerk Deutschlands. Noch heute wird täglich aus ungefähr 400t Kohle Strom produziert.
Das direkt an der Lippe liegende Gerstein-Kraftwerk ist eine der markantesten Industrieanlagen im Ruhrgebiet. Seine drei monumentalen Kühltürme sind weithin sichtbar. Bereits 1914 wurde das Kraftwerk errichtet und in den folgenden Jahrzehnten stetig ausgebaut. Zeitweilig war es das größte Steinkohlekraftwerk Deutschlands. Noch heute wird täglich aus ungefähr 400t Kohle Strom produziert.  Die ‚Lupia‘ gehört zu den drei Lippefähren, mit denen Fußgänger und Radfahrer kostenfrei den Fluss überqueren können. Allerdings ist die eigene Muskelkraft erforderlich, um die Gierseilfähre am Schloss Oberwerries in Bewegung zu setzen. Mit einer Kette wird das Boot zum anderen Ufer gezogen. Die Betriebszeit der Fähre ‚Lupia‘ ist zwischen April und Anfang November. ‚Lupia‘ ist der lateinische Name für ‚Lippe‘, da die Fährverbindung in die im Jahr 2013 neu gestalteten Römer-Lippe-Route eingebunden ist.
Die ‚Lupia‘ gehört zu den drei Lippefähren, mit denen Fußgänger und Radfahrer kostenfrei den Fluss überqueren können. Allerdings ist die eigene Muskelkraft erforderlich, um die Gierseilfähre am Schloss Oberwerries in Bewegung zu setzen. Mit einer Kette wird das Boot zum anderen Ufer gezogen. Die Betriebszeit der Fähre ‚Lupia‘ ist zwischen April und Anfang November. ‚Lupia‘ ist der lateinische Name für ‚Lippe‘, da die Fährverbindung in die im Jahr 2013 neu gestalteten Römer-Lippe-Route eingebunden ist.  Eines der berühmtesten Industriekomplexe im Ruhrgebiet sind die Krafwerke in Hamm-Uentrop. Das ehemalige Kernkraftwerk besaß die exakten Bezeichnung ‚THTR-300‘. Es wurde 1983 in Betrieb genommen und galt als weitaus unfallsicherer als vergleichbare ältere Kernkraftanlagen. Doch 1986 kam es zu einem Zwischenfall, bei dem auch geringe Mengen an Radioaktivität austraten. Der Betreiber geriet wenig später an den Rand der Insolvenz. 1989 wurde der Reaktor nach einer Laufzeit von nur 7 Jahren wieder vom Netz genommen. Während der große Trockenkühlturm bereits 1991 gesprengt wurde, kann mit dem Abriss des Reaktorblocks frühestens 2030 begonnen werden.
Eines der berühmtesten Industriekomplexe im Ruhrgebiet sind die Krafwerke in Hamm-Uentrop. Das ehemalige Kernkraftwerk besaß die exakten Bezeichnung ‚THTR-300‘. Es wurde 1983 in Betrieb genommen und galt als weitaus unfallsicherer als vergleichbare ältere Kernkraftanlagen. Doch 1986 kam es zu einem Zwischenfall, bei dem auch geringe Mengen an Radioaktivität austraten. Der Betreiber geriet wenig später an den Rand der Insolvenz. 1989 wurde der Reaktor nach einer Laufzeit von nur 7 Jahren wieder vom Netz genommen. Während der große Trockenkühlturm bereits 1991 gesprengt wurde, kann mit dem Abriss des Reaktorblocks frühestens 2030 begonnen werden.
Gleich neben dem alten KKW entstand in unmittelbarer Nähe zur Lippe sowie am Ende des Datteln-Hamm-Kanals ein neues Gas- und Dampf-Kombikraftwerk, das mit seinen beiden riesigen Kühltürmen eine schon von Weitem erkennbare Landmarke darstellt. Das GuD-Krafwerk hat eine Leistung von 850 MW und ging 2007 in Betrieb.
Radrouten die durch Hamm führen:
Werse Rad Weg
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Rundkurs Ruhrgebiet
Route der Industriekultur per Rad
Radroute Historische Stadtkerne
Bergkamen
ergkamen wurde seit dem Ende des 19. Jahrhunderts vom Bergbau geprägt. Mit den Zechen Monopol und Haus Aden gab es hier gleich zwei große Bergwerke, die jedoch beide in den 1990er Jahren im Verbund-Bergwerk Ost aufgingen. Aber auch dieses Bergwerk wurde 2010 schließlich stillgelegt. Die Doppelfördertürme von Schacht Grimberg 1/2 sowie der Zeche Haus Aden blieben als markante Industriedenkmäler erhalten. Am Marina Rünthe, dem größten Marinas Nordrhein-Westfalens, kann man richtiges maritimes Flair erleben. Wo noch bis in die 1990er Jahre Kohle umgeschlagen wurde, befindet sich heute ein Motorboothafen mit Promenade, Restaurants und Cafés – für Radler eine inzwischen häufig genutzte Raststätte.
Mit den Überresten des Römerlagers Oberaden besitzt die Stadt eine herausragende Sehenswürdigkeit, denn das Lager galt als größtes römisches Militärlager nördlich der Alpen. Von hier aus wurden die Feldzüge gegen die Germanen gestartet. Einige Grabungsfunde werden im Stadtmuseum ausgestellt.
Sehenswertes:
 Das Römerlager in Bergkamen-Oberaden war einst die bedeutendste militärische Anlage in Germanien und die größte nördlich der Alpen. Sie entstand im Jahre 11 v. Chr., wurde aber vermutlich bereits drei Jahre später wieder aufgegeben. Von hieraus wurden die augusteischen Germanienfeldzüge begonnen. Das römische Lager besaß eine Größe von 840 x 680 m und damit eine Fläche von rund 56 ha. Es beherbergte einst zwei Legionen mit insgesamt 15.000 Soldaten. Ein breiter und tiefer Graben umgab die Anlage, die mit einer Holzpfahlmauer zusätzlich geschützt war und im Abstand von ca. 25 m jeweils einen Wehrturm besaß. Über vier Tore konnte man in das Lager gelangen. Im Jahre 1905 wurde das römische Relikt wiederentdeckt. Einige der Ausgrabungsfunde sind im Stadtmuseum Bergkamen ausgestellt. Ein Lehrpfad mit mehreren Schautafeln gibt erklärende Informationen über die antike Militäranlage und die wichtigsten Fundorte des heute als Bodendenkmal geschützten Römerlagers. Eine begehbare Mauer ist unlängst rekonstruiert worden.
Das Römerlager in Bergkamen-Oberaden war einst die bedeutendste militärische Anlage in Germanien und die größte nördlich der Alpen. Sie entstand im Jahre 11 v. Chr., wurde aber vermutlich bereits drei Jahre später wieder aufgegeben. Von hieraus wurden die augusteischen Germanienfeldzüge begonnen. Das römische Lager besaß eine Größe von 840 x 680 m und damit eine Fläche von rund 56 ha. Es beherbergte einst zwei Legionen mit insgesamt 15.000 Soldaten. Ein breiter und tiefer Graben umgab die Anlage, die mit einer Holzpfahlmauer zusätzlich geschützt war und im Abstand von ca. 25 m jeweils einen Wehrturm besaß. Über vier Tore konnte man in das Lager gelangen. Im Jahre 1905 wurde das römische Relikt wiederentdeckt. Einige der Ausgrabungsfunde sind im Stadtmuseum Bergkamen ausgestellt. Ein Lehrpfad mit mehreren Schautafeln gibt erklärende Informationen über die antike Militäranlage und die wichtigsten Fundorte des heute als Bodendenkmal geschützten Römerlagers. Eine begehbare Mauer ist unlängst rekonstruiert worden.
Ein wesentliches Schwerpunktthema im Stadtmuseum Bergkamen ist das Römerlager Oberaden, das eine Zeit lang das größte römische Militärlager nördlich der Alpen war. Von hier gingen die Feldzüge nach Germanien aus. Die Ausstellung beschreibt das Leben der Legionäre und zeigt archäologische Fundstücke aus dem Römerlager. Weitere Schwerpunkte des Museums sind die Stadt- und Siedlungsgeschichte sowie die Entwicklung der Industrie. Besondere Höhepunkte der Ausstellung sind der begehbare Barbara-Stollen, ein alter Tante-Emma-Laden sowie Beispiele zur Wohnkultur aus der Zeit um 1900 und 1950.
Südlich der Lippe bei Rünthe sind noch die Reste einer alten Wallanlage zu erkennen. Sie besteht aus zwei Ringwällen, einer Vor- und einer Kernburg mit einer Fläche von rund 5 ha. Den Namen Bumannsburg hat sie erst später erhalten. Ihre ursprüngliche Bezeichnung ist nicht überliefert. Höchstwahrscheinlich hat sie bereits in den Sachsenkriegen im 8. Jahrhundert eine Rolle gespielt. Man vermutet, dass sie noch bis in das 12. Jahrhundert in Gebrauch war. Wann die Burg genau aufgegeben wurde, ist aber heute nicht mehr bekannt.
Die Gedenkstätte erinnert an ein düsteres Kapitel in der deutschen Geschichte. Das NS-Sammellager war in den 1920er Jahren als Sozialgebäude der Bergarbeitersiedlung ‚Kolonie Schönhausen‘ erbaut worden. Deshalb wurde sie während der Nazizeit auch KZ Schönhausen genannt. Zwischen April und Oktober 1933 diente das Gebäude als Sammellager für ungefähr 900 Menschen, die von hier aus in andere Lager weitergeleitet wurden. Heute dient das Gebäude der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde.
In der denkmalgeschützten Waschklause der Zeche ist heute ein Kulturzentrum untergebracht.
 Noch in den 1990er Jahren handelte es sich bei dem Hafen in Rünthe um einen düsteren Kohleumschlaghafen – gleich neben der großen Kohlenhalde.
Noch in den 1990er Jahren handelte es sich bei dem Hafen in Rünthe um einen düsteren Kohleumschlaghafen – gleich neben der großen Kohlenhalde.
Welch eine Entwicklung: heute glitzern weiße Bötchen an breiten Schwimmstegen in der Sonne. Das Marina Rünthe ist das größte Marina Nordrhein-Westfalens. Insgesamt gibt es hier über 300 Liegeplätze. Am Hafenbecken haben sich mehrere Restaurants, Cafés und Wassersporteinrichtungen angesiedelt und die Bänke auf der Promenade laden zum Verweilen und Pause machen ein.
Über 100 Jahre war die Zeche Monopol der wichtigste Arbeitgeber Bergkamens. Der Bergbau hat die Stadt nachhaltig geprägt. Die zu der Zeche gehörende Doppelschachtanlage Grimberg 1/2 wurde zwischen 1890 und 1894 errichtet. Noch in den 1980er Jahren wurde die Schachtanlage komplett modernisiert. Dabei entstand auch der neue markante 73 m hohe Förderturm, der heute ein bekanntes Denkmal im Ruhrgebiet ist. Durch die Zusammenlegung mit den Zechen von Haus Aden und Heinrich Robert in Hamm zum Verbund-Bergwerk Ost wurde die Förderung am Schacht Grimberg schon bald danach aufgegeben.
Die Halde ‚Großes Holz‘ wurde 1962 für die Entsorgung des Bergematerials der beiden Zechen Monopol und Haus Aden angelegt. Sie besitzt eine Höhe von rund 30 m und ist für Radfahrer und Fußgänger erschlossen. Seit der Fertigstellung im Jahre 2008 hat sie sich zum beliebten Aussichtspunkt entwickelt. Auf dem künstlichen Hügel steht die Lichtskulptur ‚Impuls‘ der Künstler Maik und Dirk Löbbert. Die mit Tausenden von LED-Leuchten besetzte Stahlsäulenkonstruktion besitzt nochmals eine Höhe von rund 30 m. Hinter der Szenerie: Wie der Name Monopol enstand In Bergkamen erzählt man sich eine amüsante Anekdote, wie der Name der Zeche Monopol endstanden sein soll. Als Heinrich Grimberg und Friedrich Grillo ihre Kohlenfelder vor dem Oberbergamt eintragen lassen wollten, hatten sie sich über einen Namen noch keinerlei Gedanken gemacht. Jetzt schaute der Beamte die beiden Unternehmer fragend an, welche Bezeichnung die neue Zeche denn nun bekommen solle. Die beiden einigten sich kurzer Hand auf den Markennamen des Champagners, mit dem sie am Vorabend auf die Geschäftsvereinbarung angestoßen hatten. Aus ‚Heidsiek Monopole‘ wurde die ‚Zeche Monopol‘. Die Schächte in Bergkamen wurden nun nach Heinrich Grimberg benannt, die in Kamen nach Friedrich Grillo.
 Neben der Zeche Monopol war das Bergwerk ‚Haus Aden‘ die zweite große Zeche Bergkamens. Die Doppelschachtanlage wurde erst 1938 errichtet. Als 1998 mit der Zusammenlegung der Zechen Haus Aden, Monopol und Heinrich Robert das neue Verbund-Bergwerk Ost entstand, verlor Haus Aden damit seine Funktion als Förderstandort. Aus der 54 ha großen Zechenbrache entstand nun ein Erholungsgebiet mit Wohnanlagen, Gewerbegebiet und einem neu angelegten See, der durch eine 800 m lange Gracht mit dem Datteln-Hamm-Kanal verbunden ist, so dass auch kleinere Schiffe auf dem See fahren können.
Neben der Zeche Monopol war das Bergwerk ‚Haus Aden‘ die zweite große Zeche Bergkamens. Die Doppelschachtanlage wurde erst 1938 errichtet. Als 1998 mit der Zusammenlegung der Zechen Haus Aden, Monopol und Heinrich Robert das neue Verbund-Bergwerk Ost entstand, verlor Haus Aden damit seine Funktion als Förderstandort. Aus der 54 ha großen Zechenbrache entstand nun ein Erholungsgebiet mit Wohnanlagen, Gewerbegebiet und einem neu angelegten See, der durch eine 800 m lange Gracht mit dem Datteln-Hamm-Kanal verbunden ist, so dass auch kleinere Schiffe auf dem See fahren können.
 Der alte Gutshof wurde 1864 erbaut und beherbergt heute die Ökologiestation des Kreises Unna. Der Wildbienenlehrpfad, ein Bauerngarten, der Umweltpädagogigteich und eine Pflanzenkläranlage sind frei zugänglich. Daneben werden Führungen durch einen Musterschweinestall und einen Fleischzerlegungsbetrieb nach Voranmeldung möglich. Am Verkaufstresen kann man regionale Produkte, wie Honig, Marmeladen und Säfte erwerben. Regelmäßig werden auf dem Gutshof wechselnde Kunstausstellungen präsentiert.
Der alte Gutshof wurde 1864 erbaut und beherbergt heute die Ökologiestation des Kreises Unna. Der Wildbienenlehrpfad, ein Bauerngarten, der Umweltpädagogigteich und eine Pflanzenkläranlage sind frei zugänglich. Daneben werden Führungen durch einen Musterschweinestall und einen Fleischzerlegungsbetrieb nach Voranmeldung möglich. Am Verkaufstresen kann man regionale Produkte, wie Honig, Marmeladen und Säfte erwerben. Regelmäßig werden auf dem Gutshof wechselnde Kunstausstellungen präsentiert.
Radrouten die durch Bergkamen führen:
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Rundkurs Ruhrgebiet
Route der Industriekultur per Rad
Lünen
ünen ist eine Mittelstadt im nördlichen Ruhrgebiet. Ehemals kreisfrei, ist Lünen heute die größte Stadt des Kreises Unna. Südlich des Zentrums befindet sich der Datteln-Hamm-Kanal, an dem sich mit dem Stadthafen ein bedeutender Umschlagpunkt für Handelsgüter befindet. Die Lippe fließt mitten durch den Stadtkern und teilt so Lünen in einen nördlichen und einen südlichen Bereich. Die Bauernschaften Alstedde, Nordlünen und Wethmar bildeten bis 1974 die eigenständige Gemeinde Altlünen, die historisch münsterländisch beeinflusst ist. Der südliche Teil Lünens dagegen ist vom Bergbau und den ehemaligen Zechen Victoria, Preußen und Gneisenau geprägt. Zechensiedlungen bestimmen hier das Stadtbild.
Von der historischen Altstadt sind leider nur noch wenige Fachwerkhäuser aus dem 17. Jahrhundert erhalten. Der überwiegende Teil wurde in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts abgerissen. Im Mittelalter war Lünen mit einer Stadtmauer befestigt und gehörte als Handelsmetropole der Hanse an. Seit 1341 besitzt Lünen das Stadtrecht, im Jahre 1512 wurde es bei einem verheerenden Stadtbrand weitgehend zerstört. Auch im Dreißigjährigen Krieg wurde Lünen stark mitgenommen. Mehrfach wurde die Stadtmauer geschleift, jeweils gleich danach jedoch wieder aufgebaut. Allein im Jahre 1634 wurde die Handelsstadt fünf Mal besetzt und dementsprechend stark beschädigt.
Zu den Sehenswürdigkeiten gehören Schloss Schwansbell südöstlich der Innenstadt, die Stadtkirche als ältestes Gebäude des Ortes von 1366 und das Colani-Ei, ein vom berühmten Designer Luigi Colani umgestalteter Steinkohle-Förderturm im Stadtteil Brambauer.
Sehenswertes:
Das älteste Bauwerk Lünens ist die von 1360 bis 1366 errichtete spätgotische Stadtkirche St. Georg. Sie befindet sich mitten in der heutigen Fußgängerzone. Bemerkenswert ist der um 1470 entstandene Flügelaltar sowie die Deckengemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert, die den Sündenfall und das Jüngste Gericht darstellen. Die Orgel und die Orgelempore entstammen der Barockzeit.
Die Pfarrkirche St. Marien wurde zwischen 1894 und 1896 als kreuzförmige Basilika im neugotischen Stil errichtet. Der mächtige rote Backsteinbau befindet sich unweit der Lippe auf der nördlichen Seite des Flusses. Ein erster mittelalterlicher Steinbau war bereits um 1018 an gleicher Stelle erbaut worden. Aus dieser Vorgängerkirche stammen noch Teile der heutigen Einrichtung, wie der zylindrische Taufstein (1270), das Triumphkreuz (14. Jhd.) sowie zwei Sandstein-Madonnen, die vermutlich aus dem 13. Jahrhundert stammen.
Leider sind in der Stadt Lünen in der Nachkriegszeit bis in die 1960er Jahre viele historische Gebäude abgerissen worden. Trotzdem blieben im Bereich des Roggenmarktes noch einige alte Fachwerkhäuser aus dem 17. Jahrhundert erhalten. Besonders erwähnenswert sind die Giebelhäuser am Roggenmarkt (Nr. 3) von 1609 und in der Silberstrasse (Nr. 3) von 1664 sowie ein so genanntes Traufenhaus von 1651 in der Mauerstrasse (Nr. 93).
Südöstlich der Innenstadt Lünens und unweit des Datteln-Hamm-Kanals liegt in einem Waldstück das Schloss Schwansbell. Das Gebäude mit seinen beiden prägenden achteckigen Türmen entstand zwischen 1872 und 1875 durch Wilhelm von Westerhold.
Bereits im 12. Jahrhundert befand sich auf dem Gelände eine Wasserburg, der Sitz des Rittergeschlechtes derer von Schwansbell. Diese Burg ist jedoch nicht mehr erhalten. Wo sie einst stand, umschließt der alte Wassergraben heute eine Garteninsel.
Schloss Schwansbell war von 1929 bis 1982 im Besitz der Stadt Lünen, heute befindet sich das Anwesen wieder im Privatbesitz. In den Innenräumen befinden sich Mietwohnungen und Büros.
In den Wirtschaftsgebäuden, dem Gesindehaus des Schlosses, ist das Museum der Stadt Lünen untergebracht. Das Heimatmuseum präsentiert die Wohnkultur der Bergarbeiter zwischen 1830 und 1930. Daneben ist auch die Puppen- und Spielzeugsammlung bemerkenswert.
Die alte Wassermühle Lippholtshausen ist ein spätbarockes Fachwerkgebäude. Sie wurde 1760 errichtet und gehörte als Schlossmühle ursprünglich zum im letzten Jahrhundert abgebrochenen Haus Buddenburg. Lange Zeit wurde die Mühle als Wohnhaus genutzt, heute gehört das Gebäude dem ‚Verein der Mühlenfreunde’. In den historischen Räumlichkeiten der Wassermühle finden heute auch standesamtliche Trauungen statt.
Im Jahr 1996 fand in Lünen die Landesgartenschau statt. Dazu gestaltete man eine alte Bergbaufläche, die einst zur Zeche Preußen gehörte und sich direkt am Datteln-Hamm-Kanal befand, zu einer großzügigen Parklandschaft um. In der Mitte des 63 ha großen frei zugänglichen Grüngeländes befindet sich der Horstmarer See, an dessen Nordufer sich ein Strandbad befindet. An den Seepark schließt sich die Preußenhalde, eine Abraumhalde der ehemaligen Zeche Preußen, an.
Der Preußenhafen ist eine Ausbuchtung im Datteln-Hamm-Kanal, angrenzend an den Seepark. Er dient einerseits als Anlegestelle für Bootstouristen, andererseits soll er aber auch ein Freizeittreffpunkt der Lüner Bevölkerung sein. Eine Promenade führt einmal um den gesamten Hafen herum, das Hafenhaus bietet Touristeninformationen auch für Radfahrer und Wanderer.
Direkt am Datteln-Hamm-Kanal liegt der Stadthafen Lünen. Er ist ein wichtiges Warenumschlagszentrum im nördlichen Ruhrgebiet. Der Hafen zieht sich am nördlichen Ufer des Kanals entlang und bietet eine Gesamtlagerfläche von ungefähr 100.000 m².
Im Lüner Stadtteil Brambauer befand sich einst das Bergwerk Minister Achenbach. Die Zeche wurde 1990 stillgelegt und anschließend zwischen 1993 und 1995 zum Technologiezentrum ‚Lüntec’ umgebaut. Die alte Schachthalle dient heute als Foyer, Veranstaltungsraum und als Ausstellungshalle.
Der ehemalige Förderturm der Schachtanlage 4 wurde von dem berühmten Designer Luigi Colani umgestaltet. Er entwarf ein UFO, das dem 35 m hohen Förderturm aufgesetzt wurde. Das im Volksmund ‚Colani-Ei’ genannte Gebilde soll den Strukturwandel im Ruhrgebiet symbolisieren. Im Inneren des UFOs wurde eine Business-Lounge eingerichtet, von der man bei klarem Wetter einen weiten Blick über Lünen und das Ruhrgebiet hat.
In der Ziethenstrasse befindet sich eine alte Bergarbeitersiedlung. Sie besteht aus 52 gleich gestalteten roten Backsteinhäusern und wurde 1898 für die Kumpel der Zeche Preußen erbaut. Obwohl die einzelnen Häuser für vier Familien konzipiert waren, wurden sie maximal für drei Familien genutzt. Typisch für diese Siedlung sind die großen Gärten, in denen sich auch Stallungen und das Klosett befanden. Der Bauherr, die Harpener Bergbau AG zeichnete sich auch verantwortlich für die Schulen, Kirchen und für eine Polizeistation. In der ehemaligen Pestalozzi-Schule befindet sich eine kulturelle Begegnungsstätte. Im Obergeschoss ist ein kleines Bergarbeitermuseum untergebracht.
An der Münsterstraße befindet sich die Bergarbeitersiedlung Victoria. Sie wurde zwischen 1910 und 1912 von der Gewerkschaft Viktoria Lünen geschaffen und wird geprägt durch hellgrau verputzte Einfamilien-Doppelhäuser, Reihenhäuser sowie von kleinen Plätzen. Diese Freiräume sorgen dafür, dass die Struktur dieser Siedlung sehr aufgelockert wirkt. Teil der Arbeiterwohnsiedlung waren auch Geschäfte sowie ein Wohlfahrtshaus mit Kindergarten und Badeanstalt.
Unweit des Preußenhafens, direkt am Datteln-Hamm-Kanal gelegen, befindet sich die Bergarbeitersiedlung ‚Am Kanal’. Sie wurde 1921/22 erbaut und war eine der ersten Siedlungen, die nicht allein durch eine Bergwerkgewerkschaft, sondern auch mit Hilfe von staatlichen Zuschüssen errichtet wurde. Einige Wohnungen wurden sogar direkt an Arbeiter verkauft, was ungewöhnlich für Bergarbeitersiedlungen war.
Die Siedlung sollte Wohnraum für die Arbeiter aller Lüner Zechen bieten (Viktoria, Preußen und Gneisenau). Sie bot auch öffentliche Einrichtungen, wie Schulen, Kirchen, Kinderbetreuungsanstalten sowie verschiedene Geschäfte. Bedingt durch ihre damalige abgeschiedene Lage war sie als geschlossene Siedlung konzipiert worden. Inzwischen wurden die Häuser privatisiert und gehören zum überwiegenden Teil den ehemaligen Mietern.
In dem Gebäude einer um 1900 erbauten Schule in Lünen-Süd befindet sich heute das Bergmannsmuseum. Die Ausstellung zeigt Fotos, Bilder und Alltagsgegenstände aus dem Leben von Bergmannsfamilien und wurde von ehemaligen Bergleuten selber zusammengetragen und eingerichtet. Nach dem allgemeinen Zechensterben zeigt dieses Museum bereits heute ein Stück regionale Vergangenheit. Auf dem Außengelände wurde ein Stollen nachgebaut, der einen kleinen Eindruck der Bergarbeiterwelt vermittelt. Neben dem Museum betreibt der Verein ‚ Multikulturelles Forum Lünen e.V.‘ im Haus auch eine Begegnungsstätte.
In einer ehemaligen Zechenkolonie im Stadtteil Brambauer befindet sich das Bergarbeiter-Wohnmuseum. Die Doppelhaushälfte, in der einst eine Bergarbeiterfamilie mit 14 Kindern hauste, wurde Anfang der 1990er Jahre ‚zurückrenoviert‘, um die Einrichtungen eines typischen Zechenhauses in der Zeit der 1920/30er Jahre zu zeigen – mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Plumpsklo! Die ausgestellten Exponate stammen zum großen Teil von Bewohnern der Siedlung.
Die Selimiye-Moschee in der Roonstraße wurde zwischen 1999 und 2008 erbaut. Betrieben wird sie durch die Türkisch-Islamische Gemeinde zu Lünen e.V. betrieben. Bei ihrer Eröffnung war sie mit einer Gebetsraumgröße von 640 m² und einer Gesamtfläche von 2.400 m² die größte Moschee in Nordrhein-Westfalen.
Das Betongebäude ist eher schmucklos gestaltet und besitzt ein Minarett. Ungleich mehr verziert ist der Innenraum des islamischen Gotteshauses. Es besitzt eine Vielzahl von Mosaiken und einen Brunnen, der sich genau unter der Kuppel befindet. Der eindrucksvolle Leuchter, der sich über diesem Brunnen befindet, wiegt ungefähr 450 kg und besitzt mehr als 100 Leuchten.
Radrouten die durch Lünen führen:
LandesGartenSchauRoute
Römer-Lippe-Route
Rundkurs Ruhrgebiet
Route der Industriekultur per Rad





















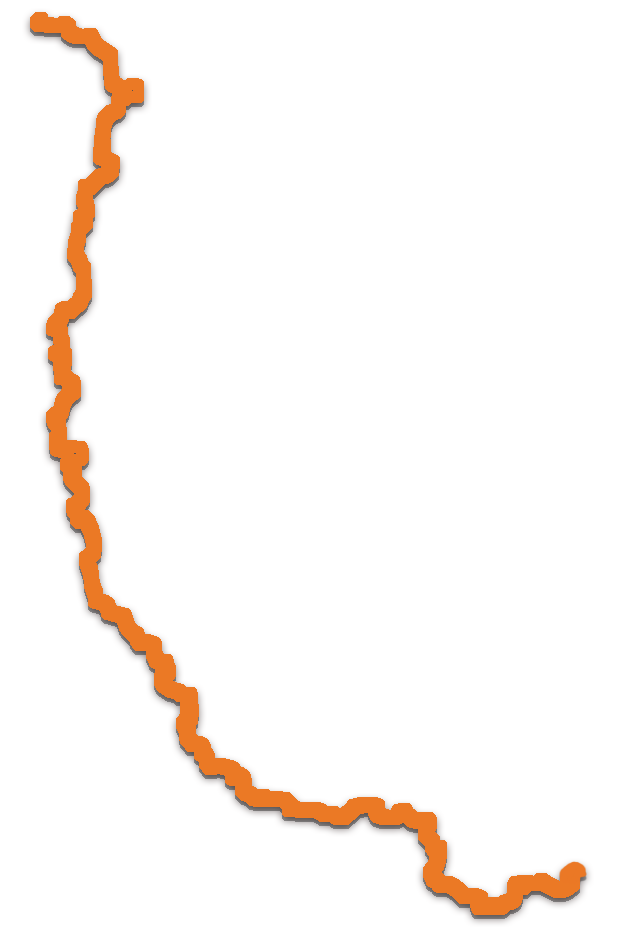
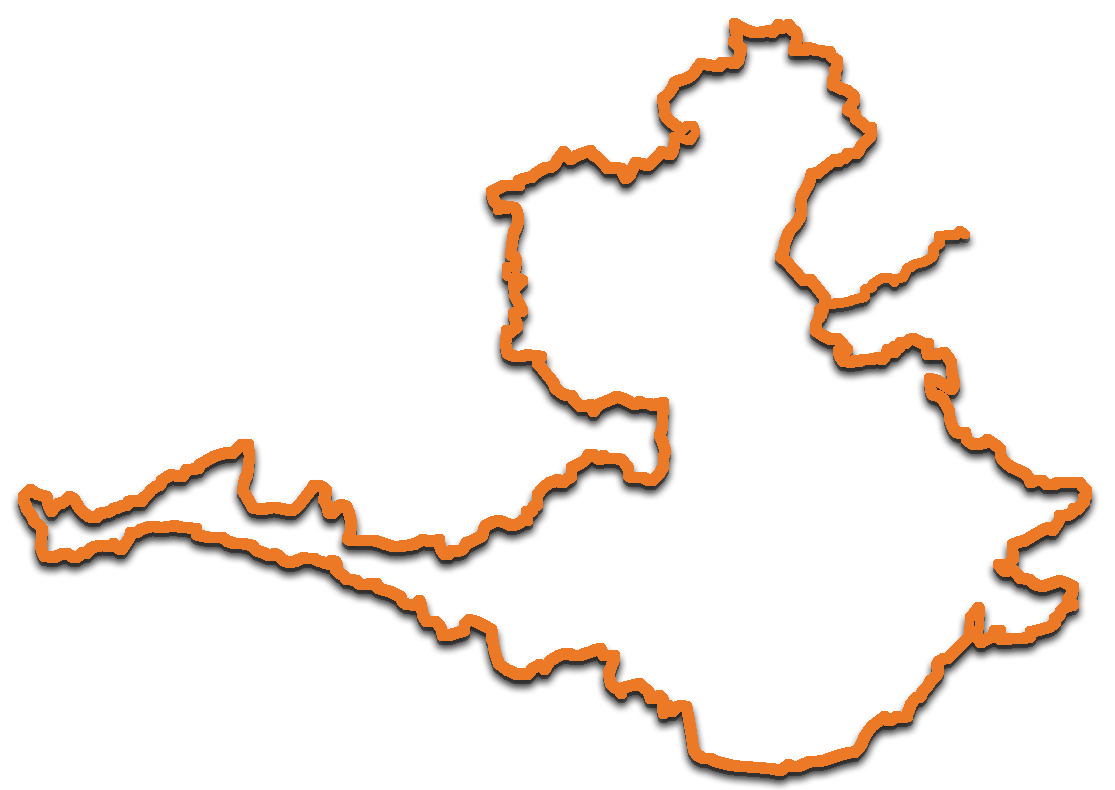
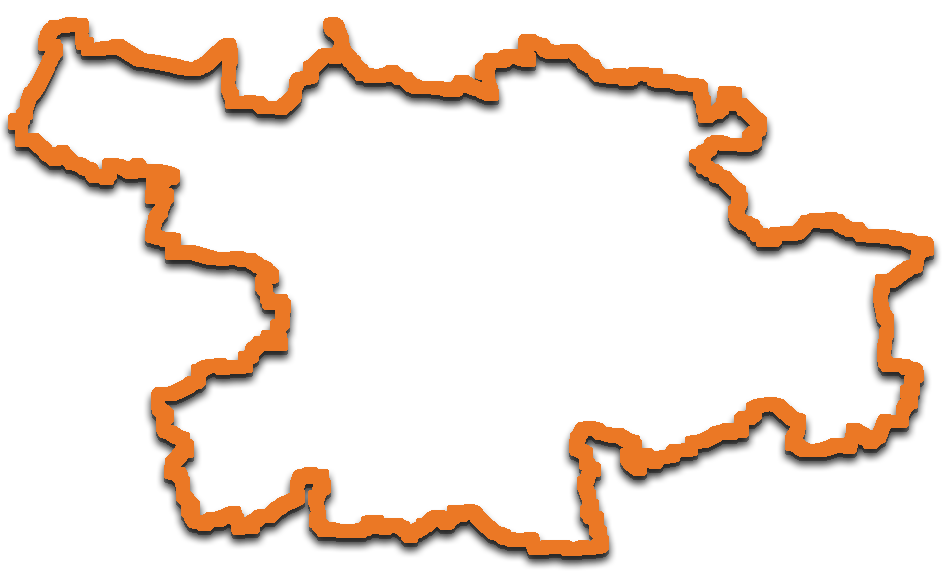

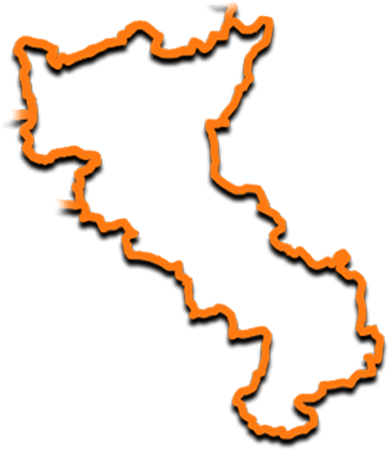
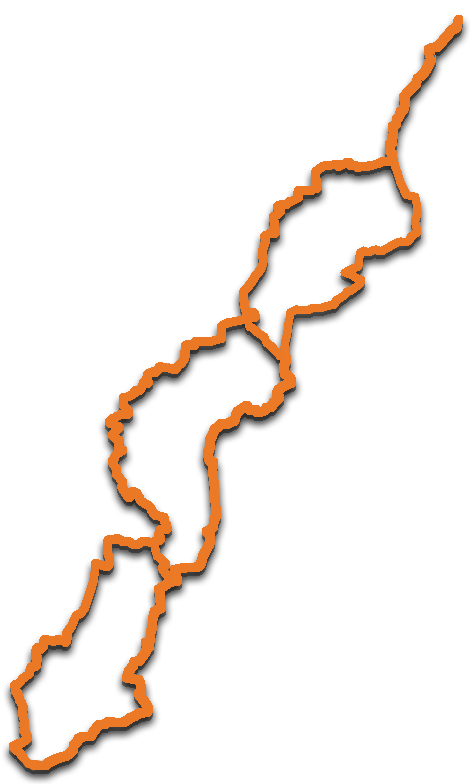


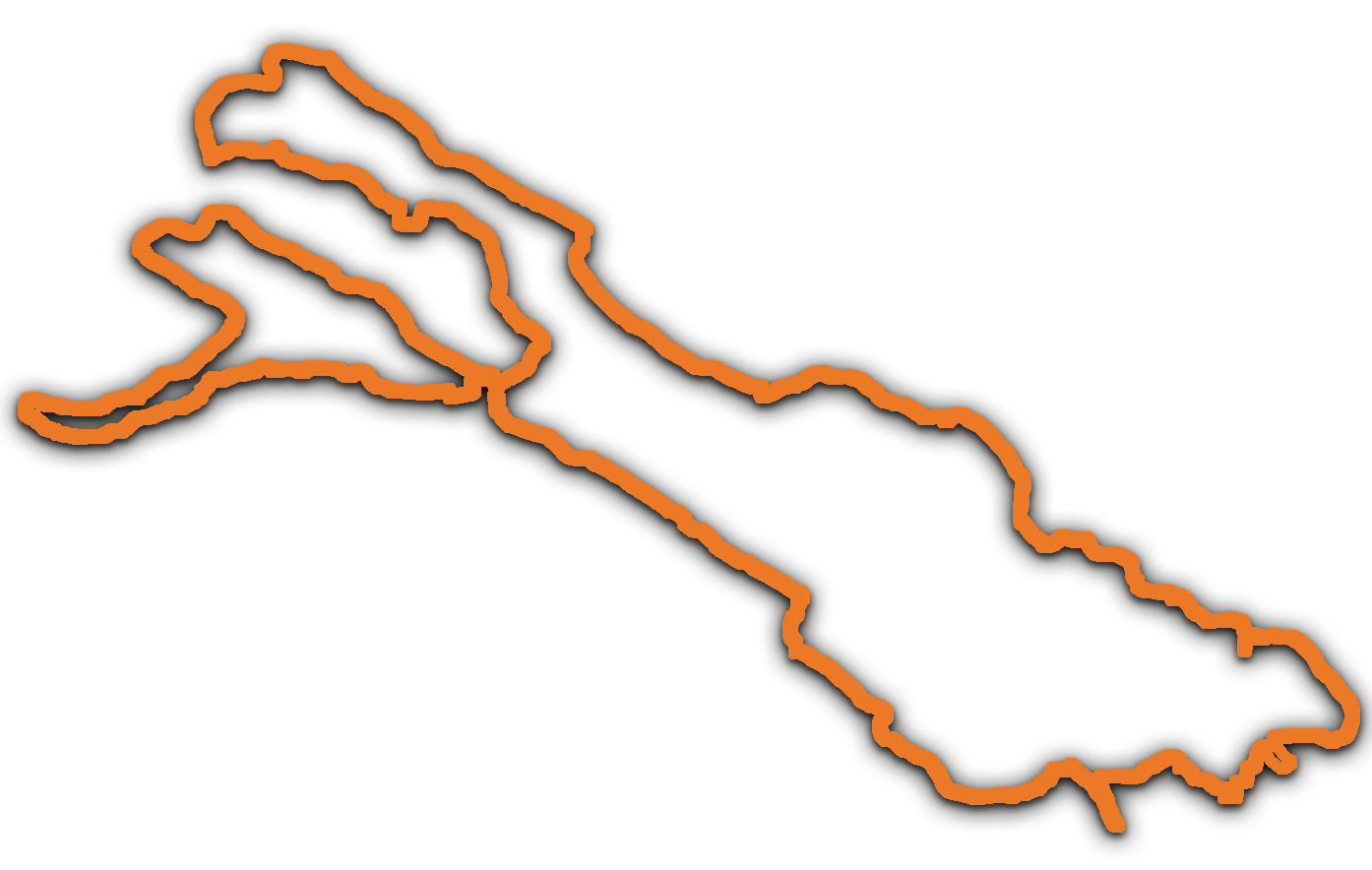

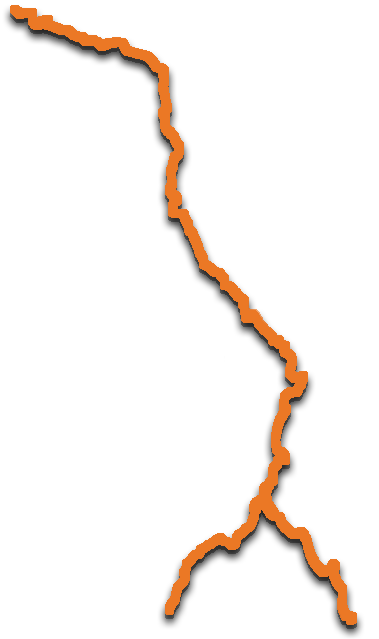
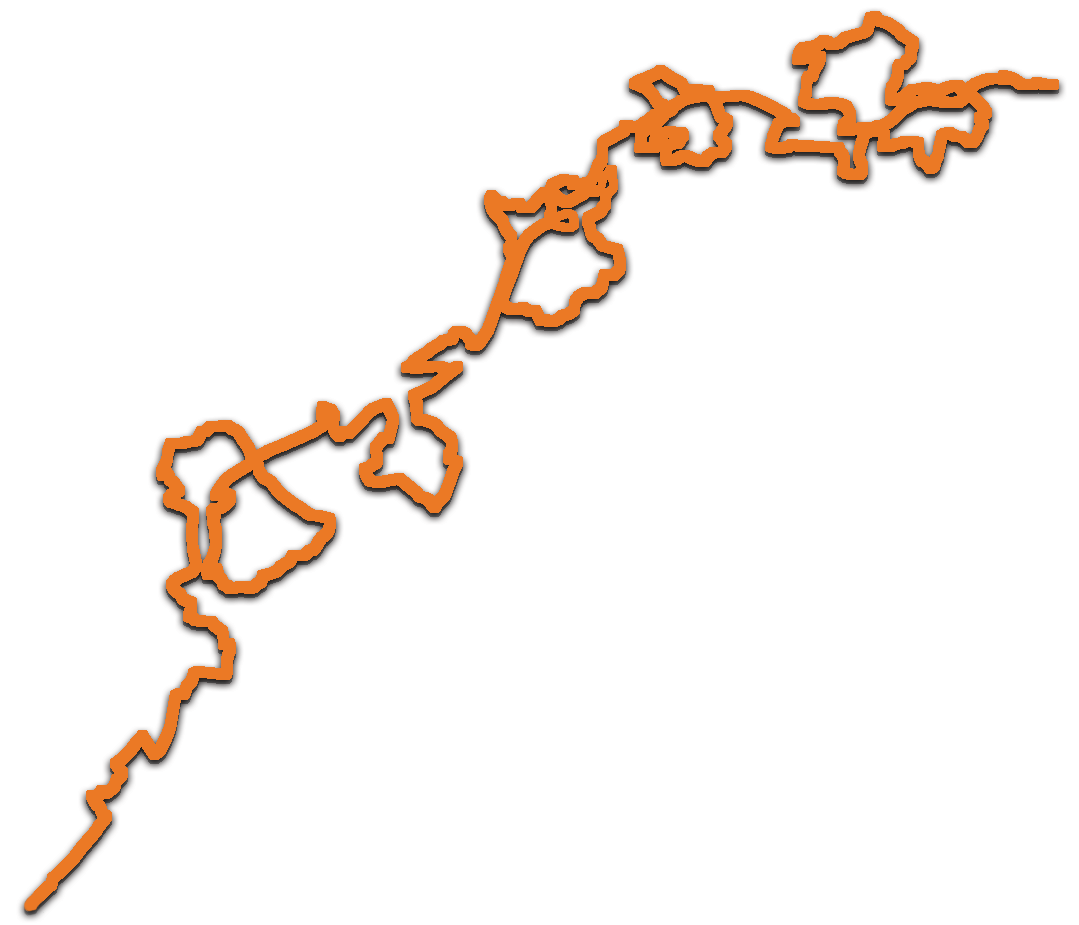
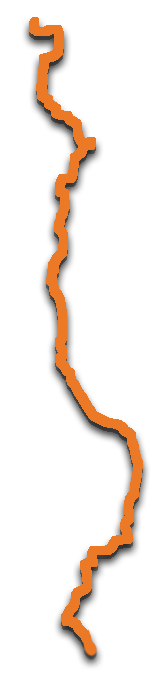












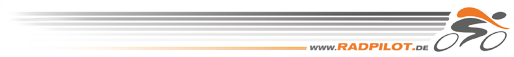







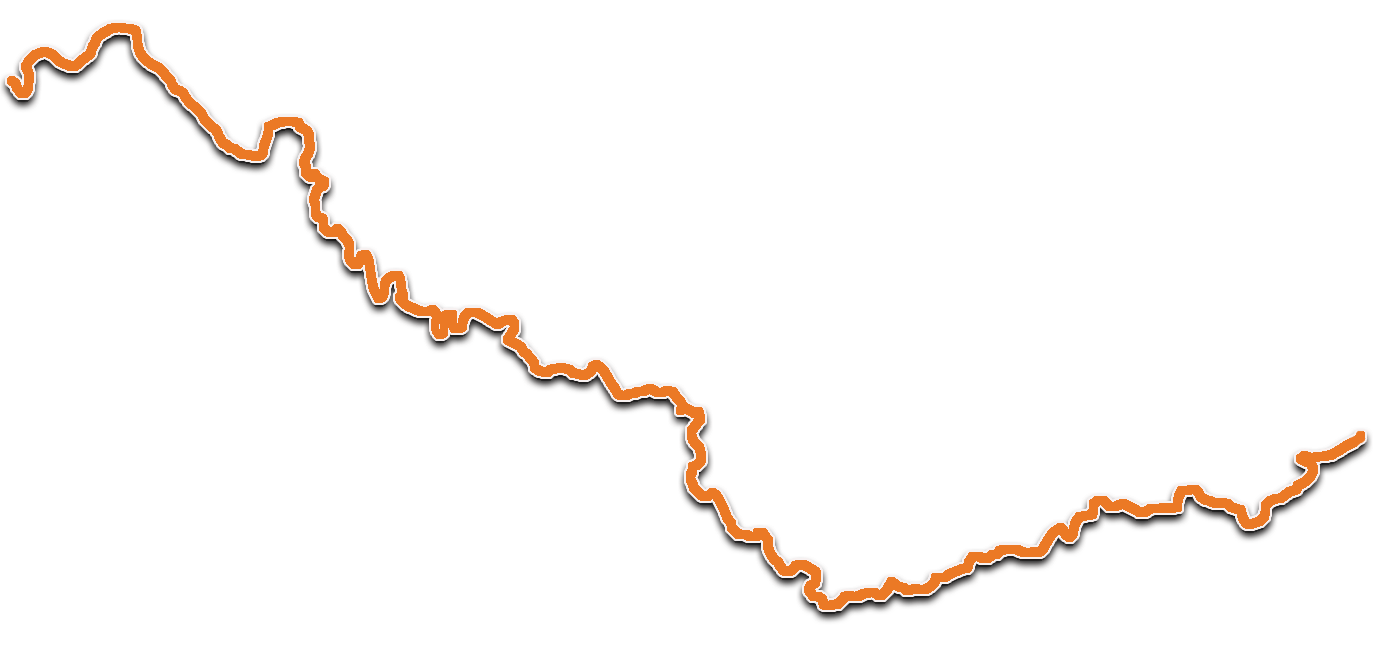

















































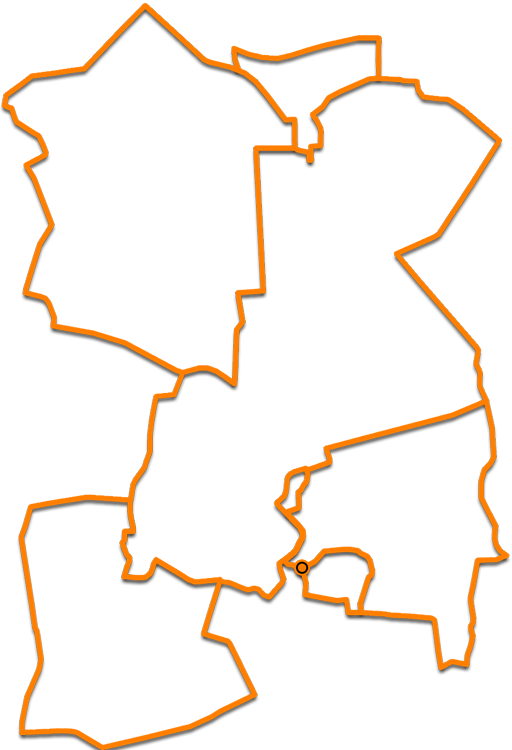





















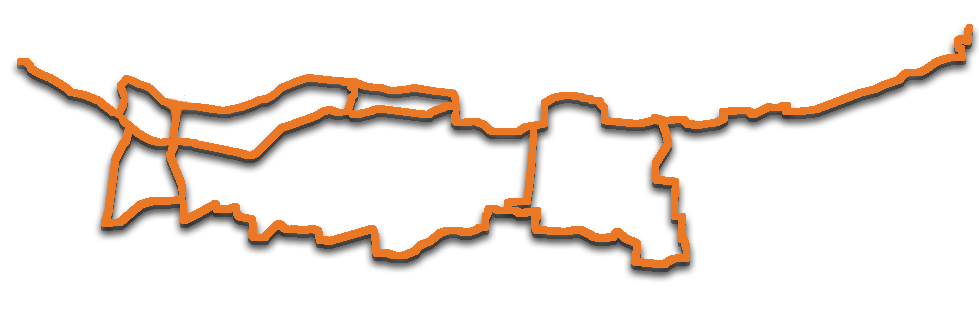











































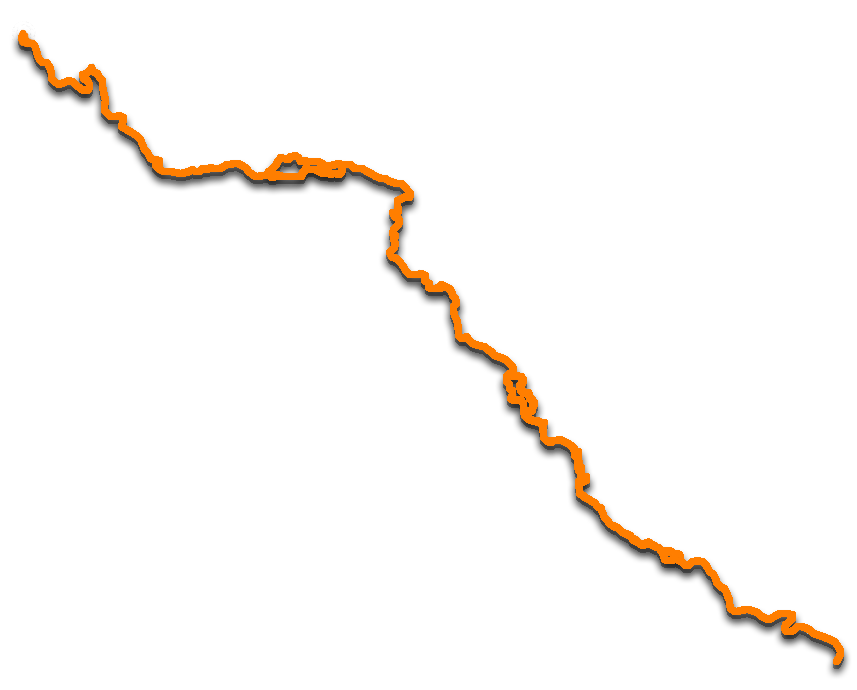










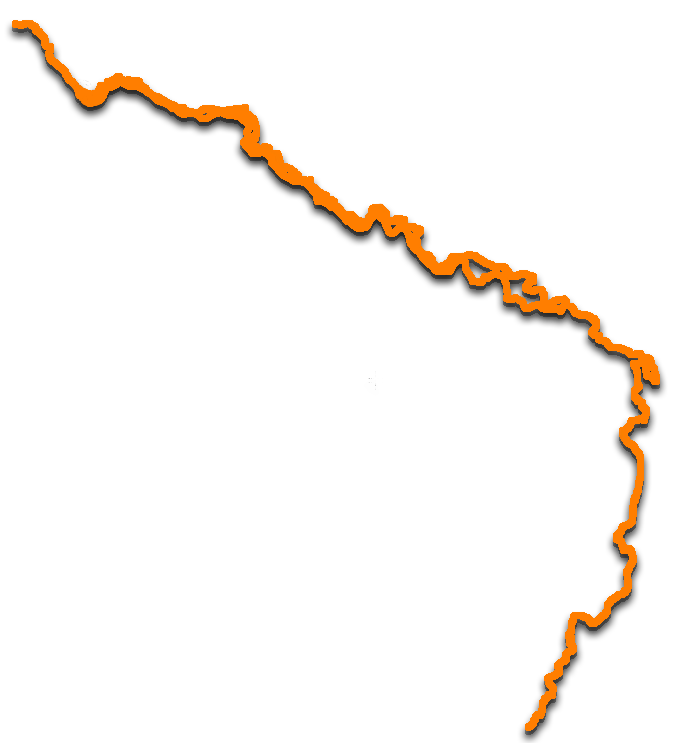











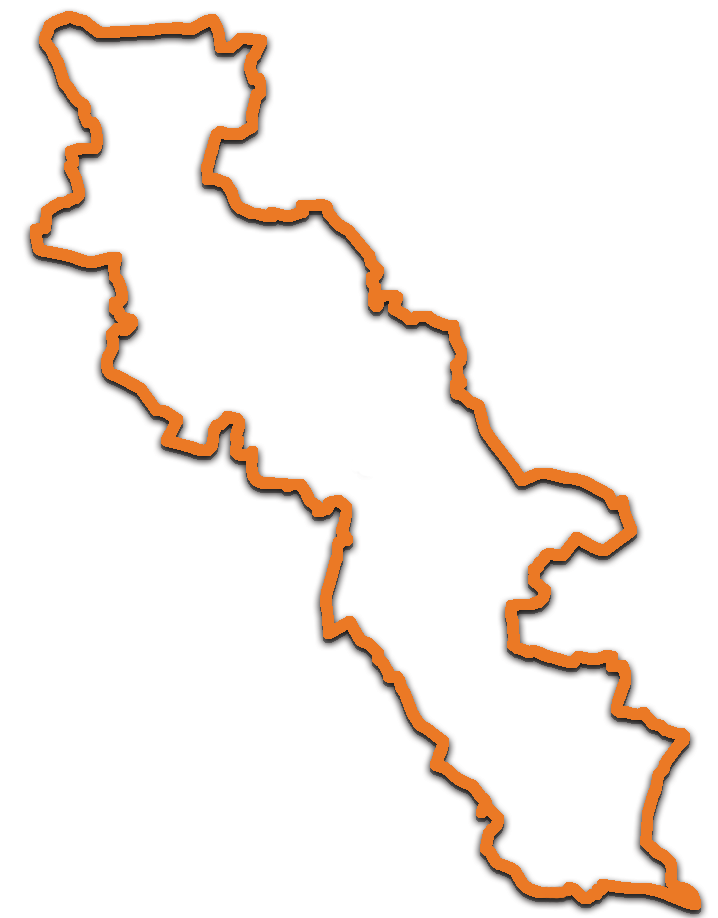

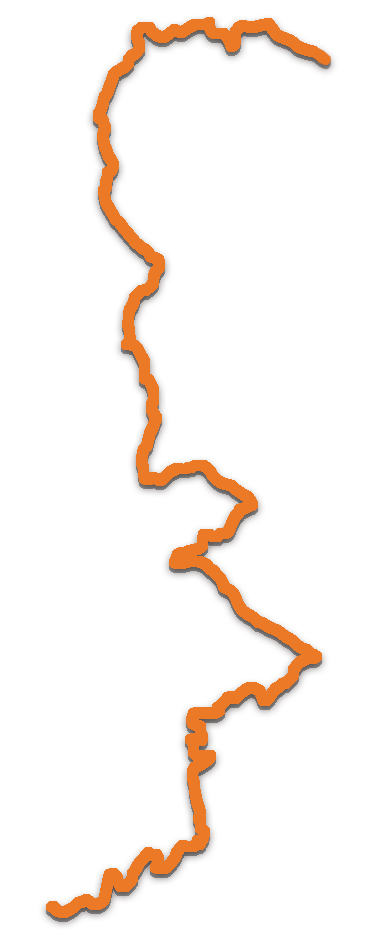














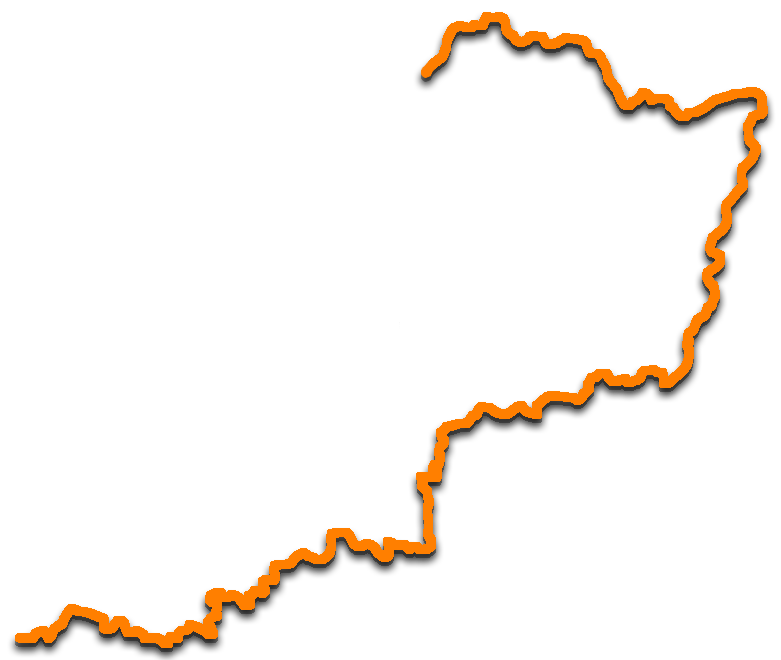
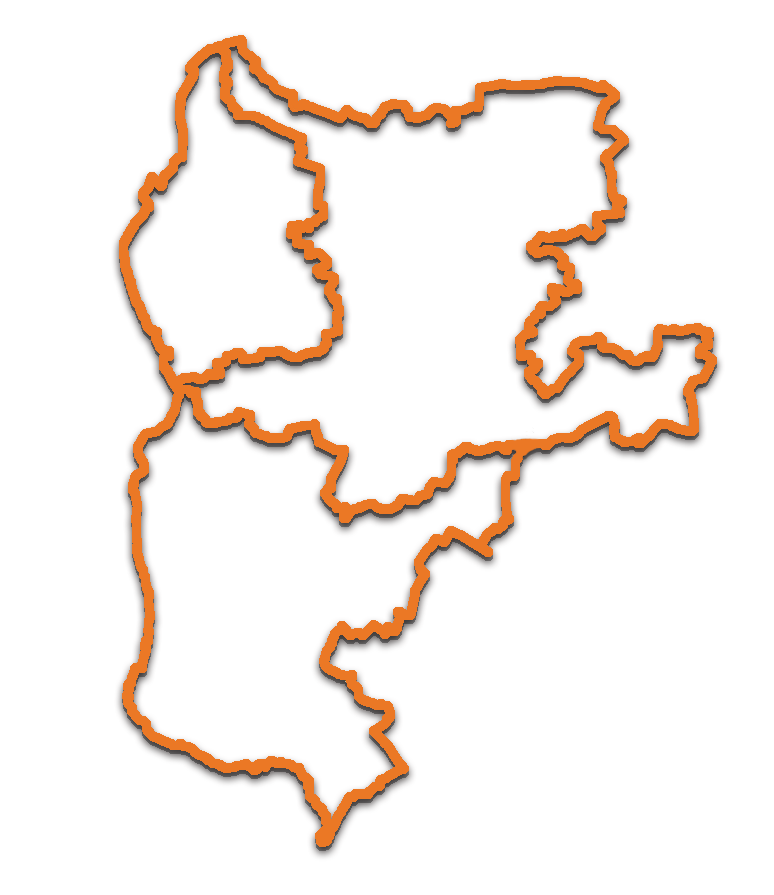
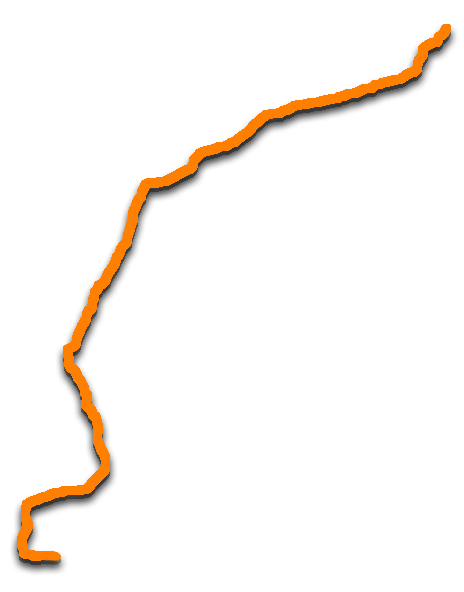
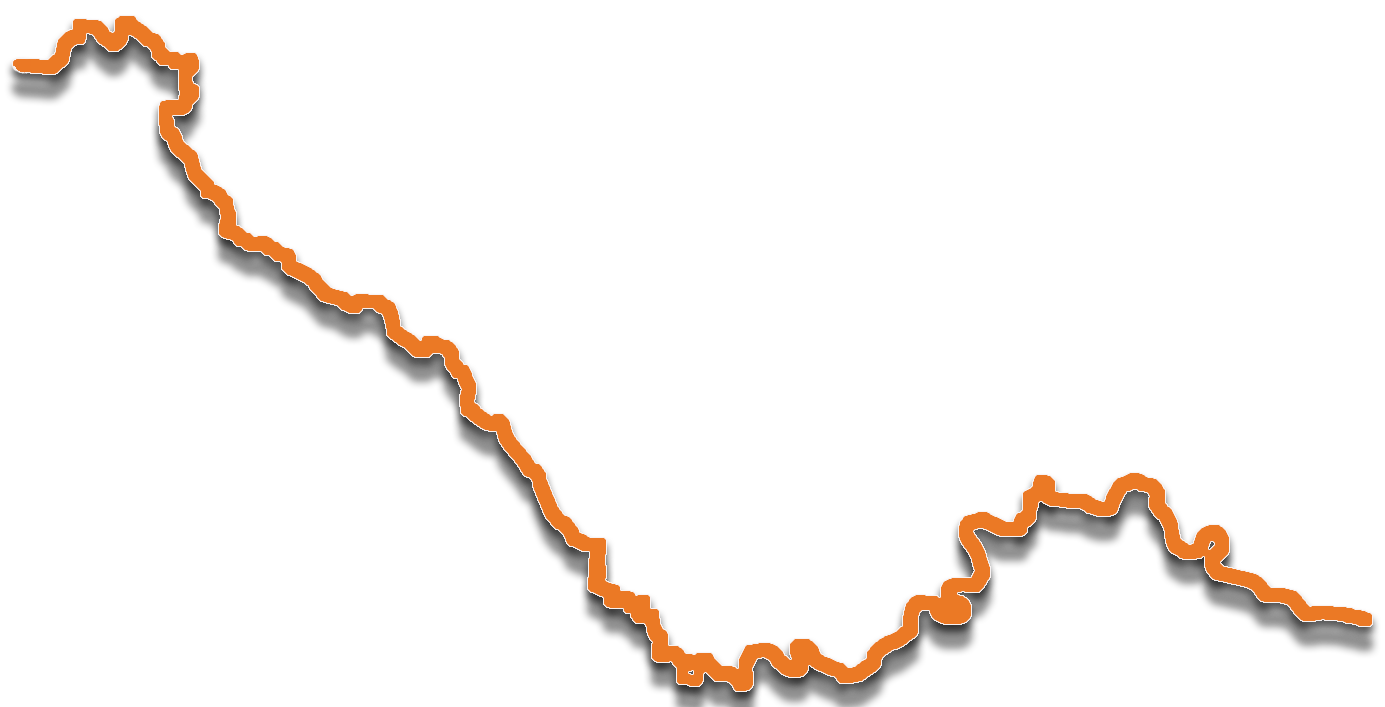
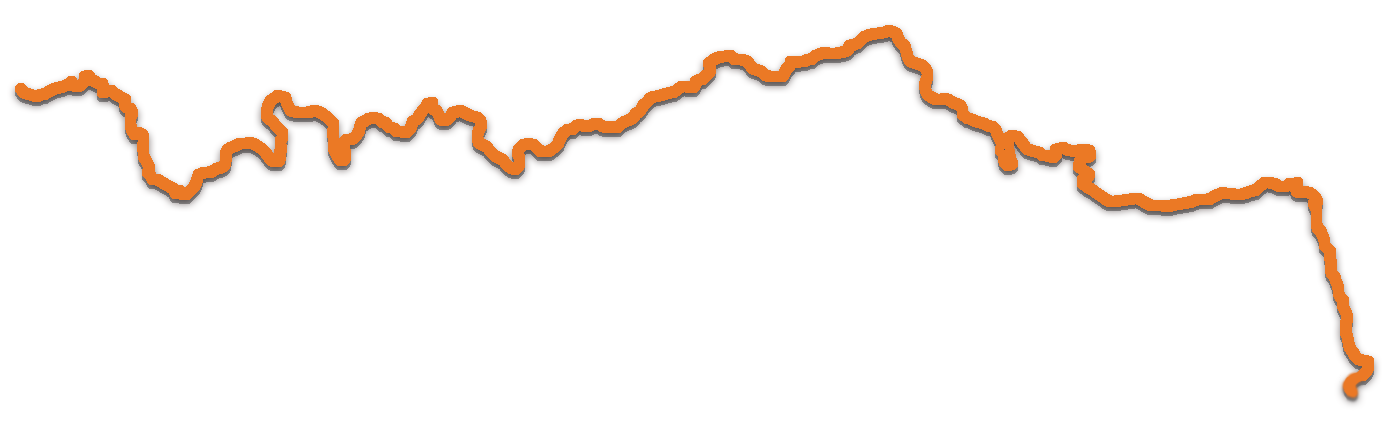
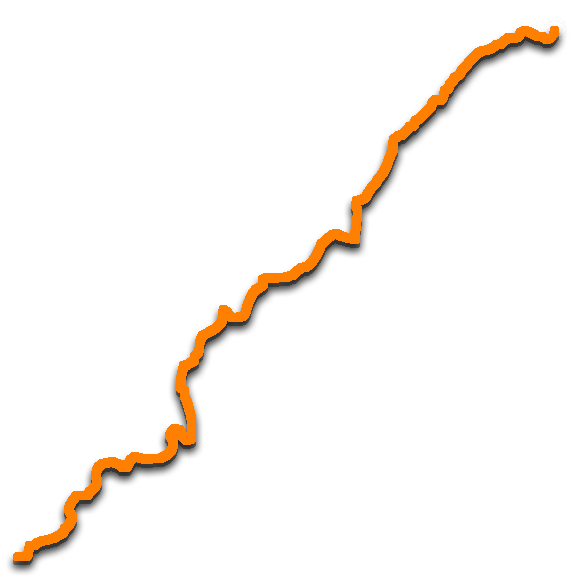




 e
e