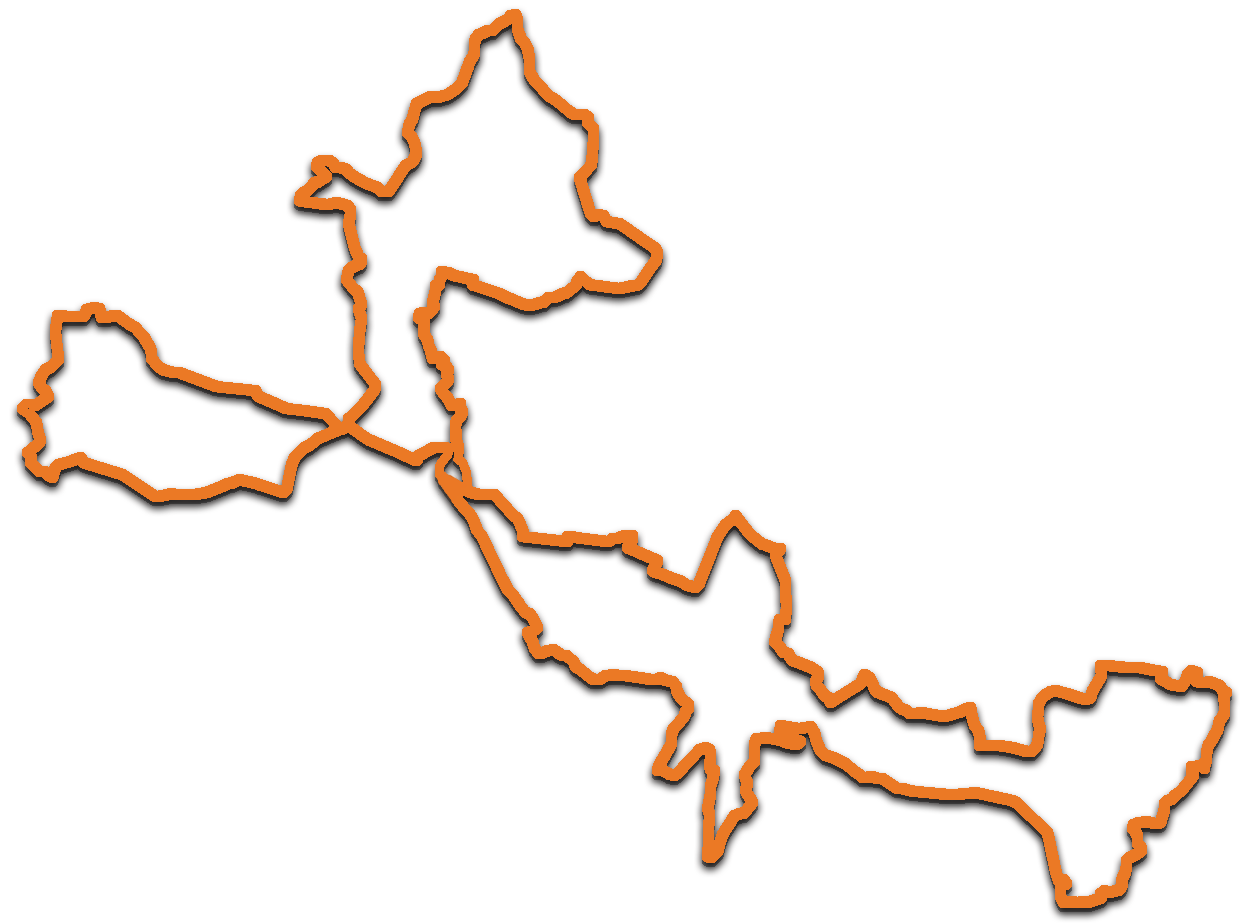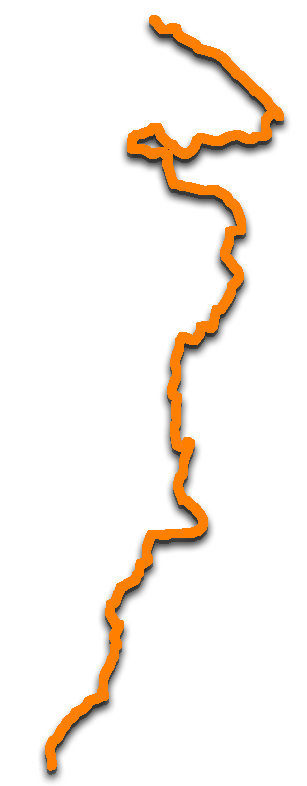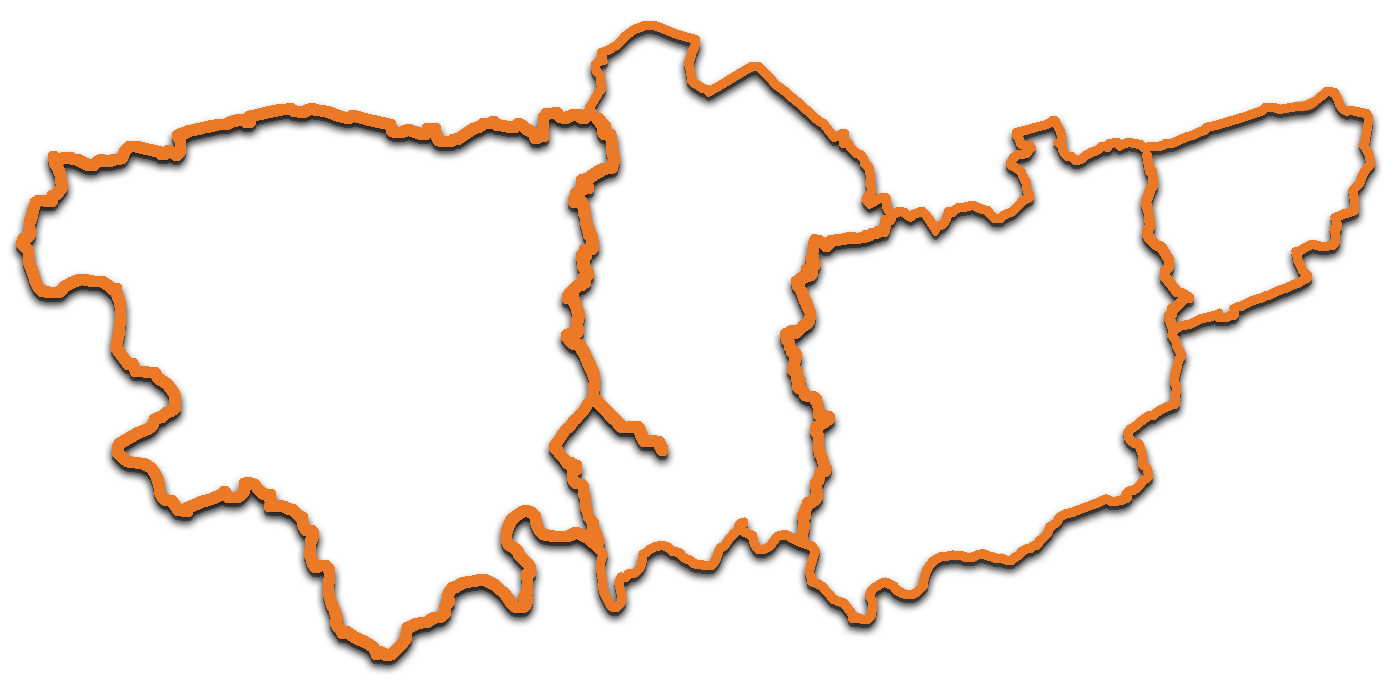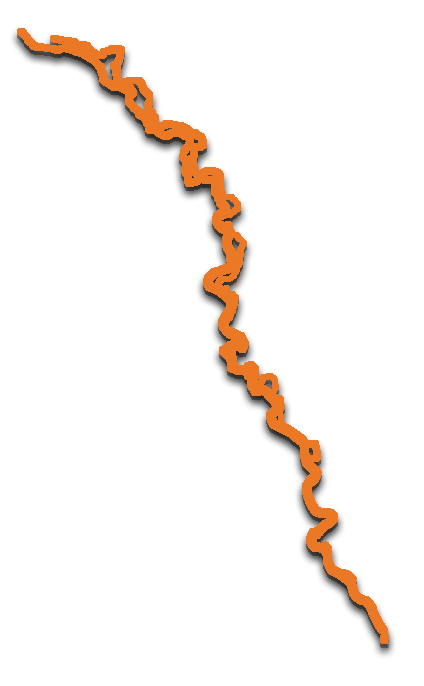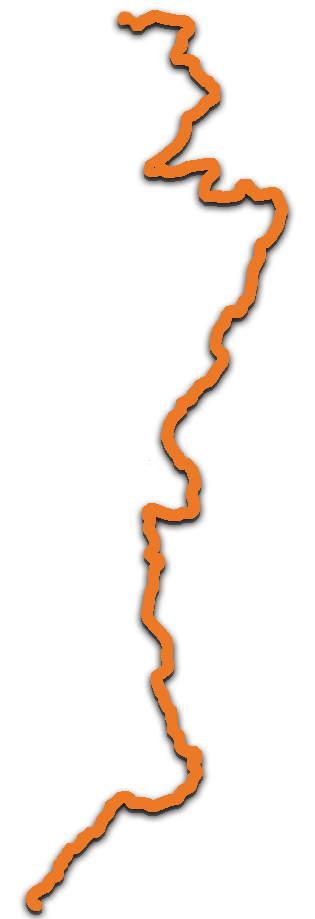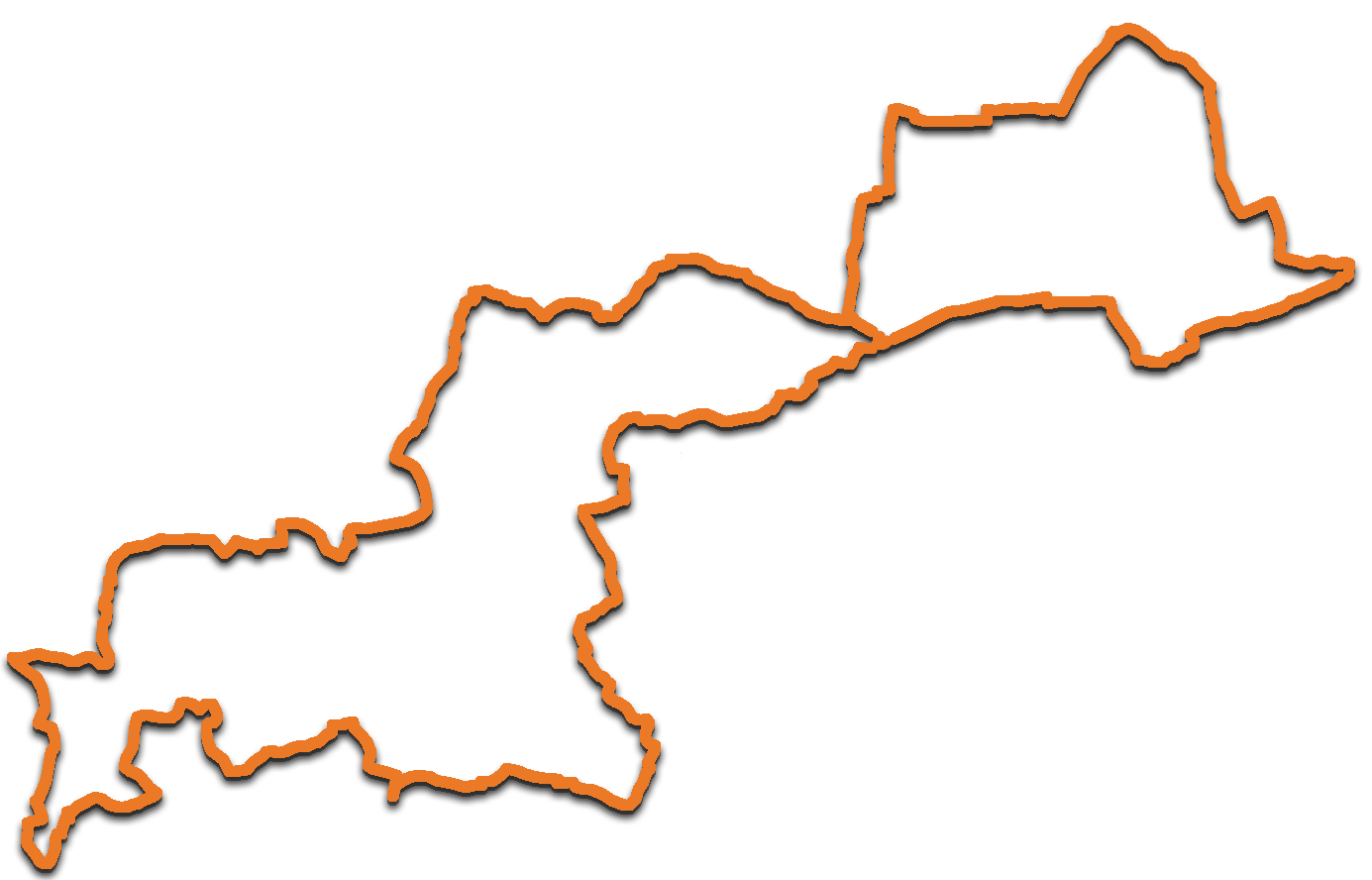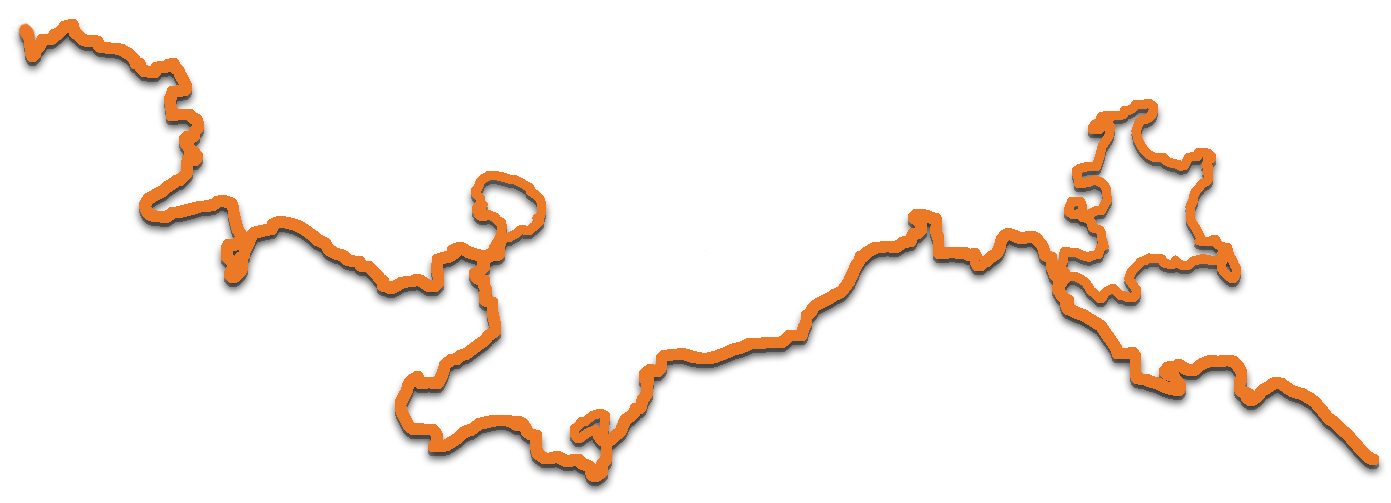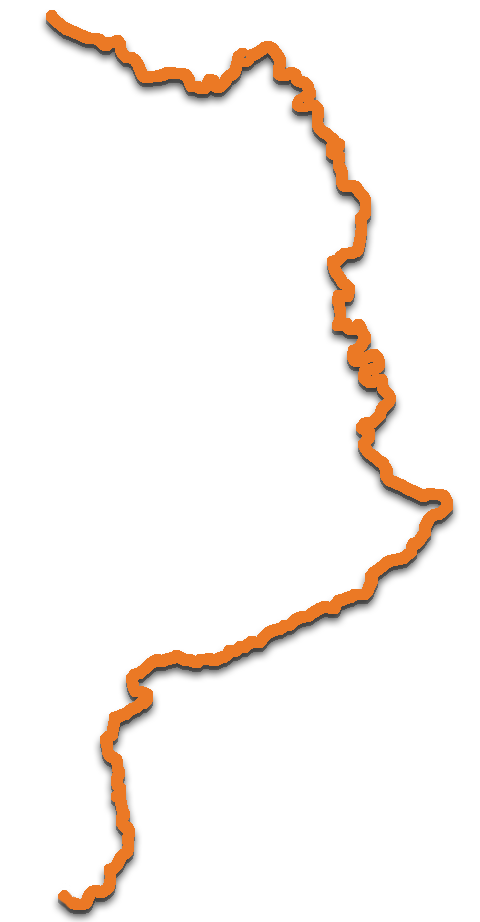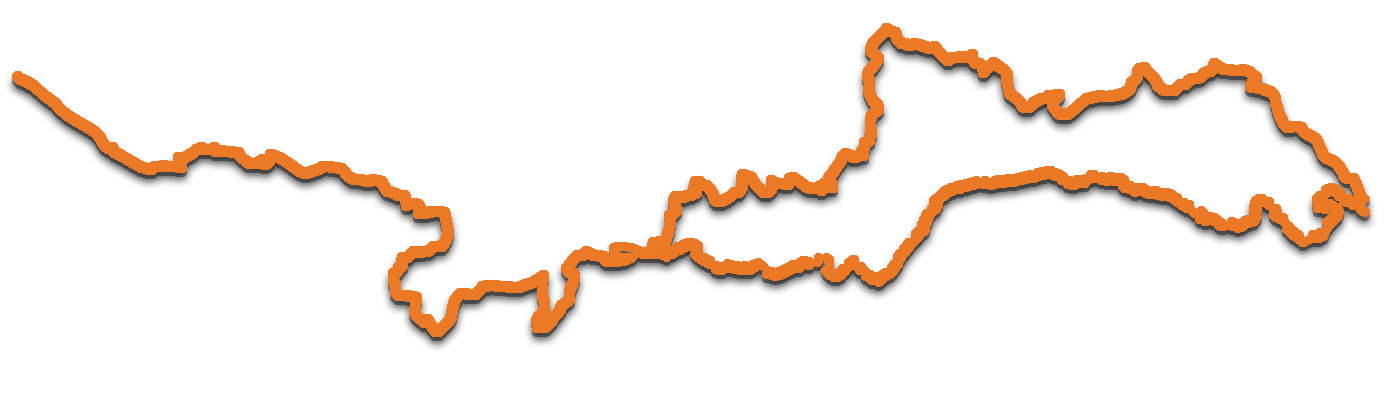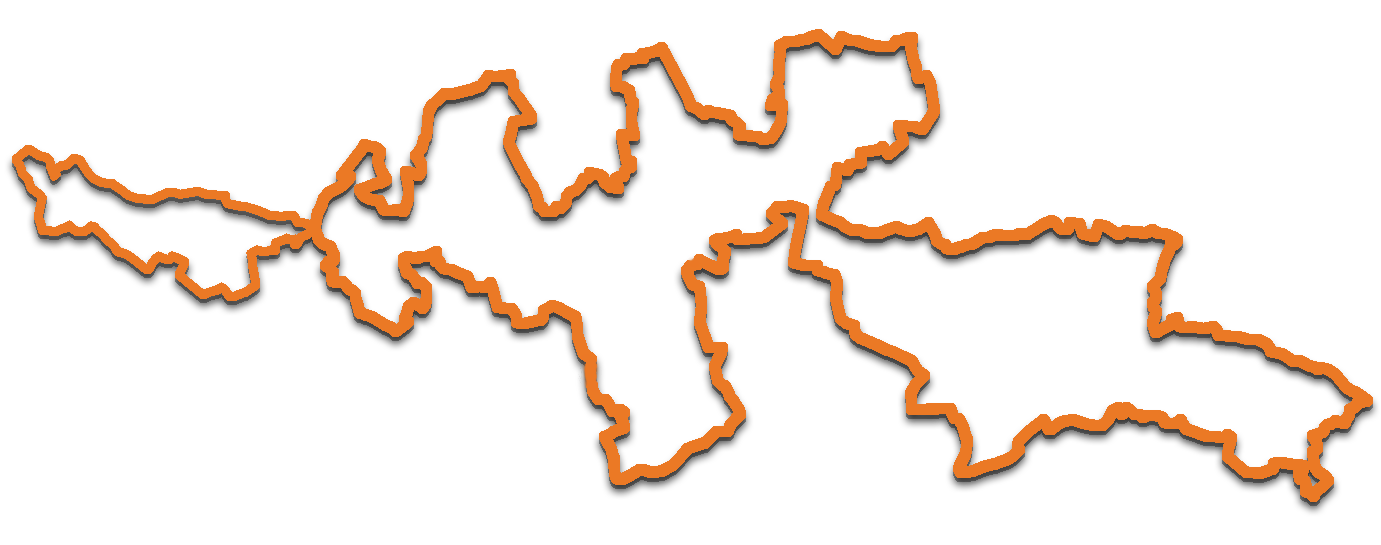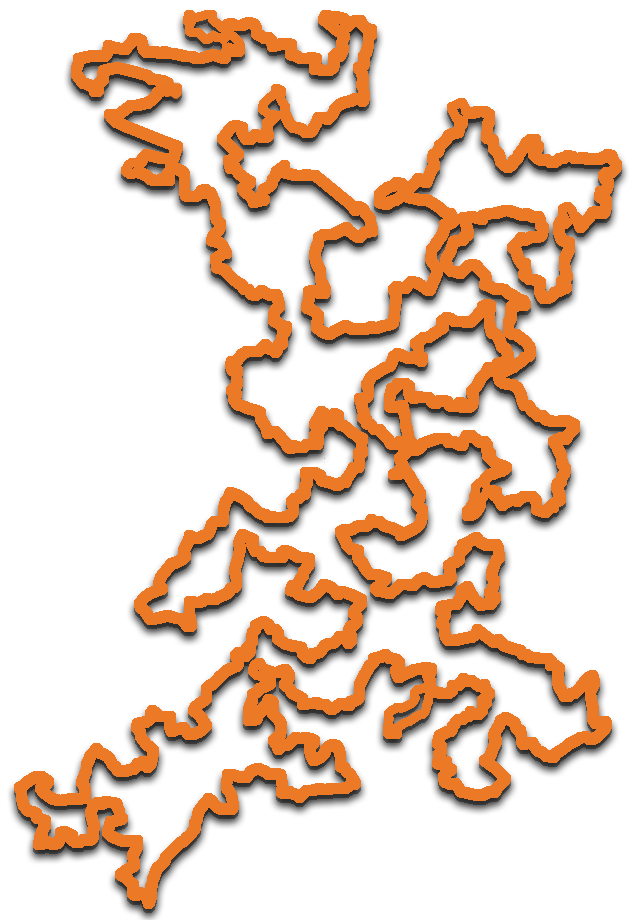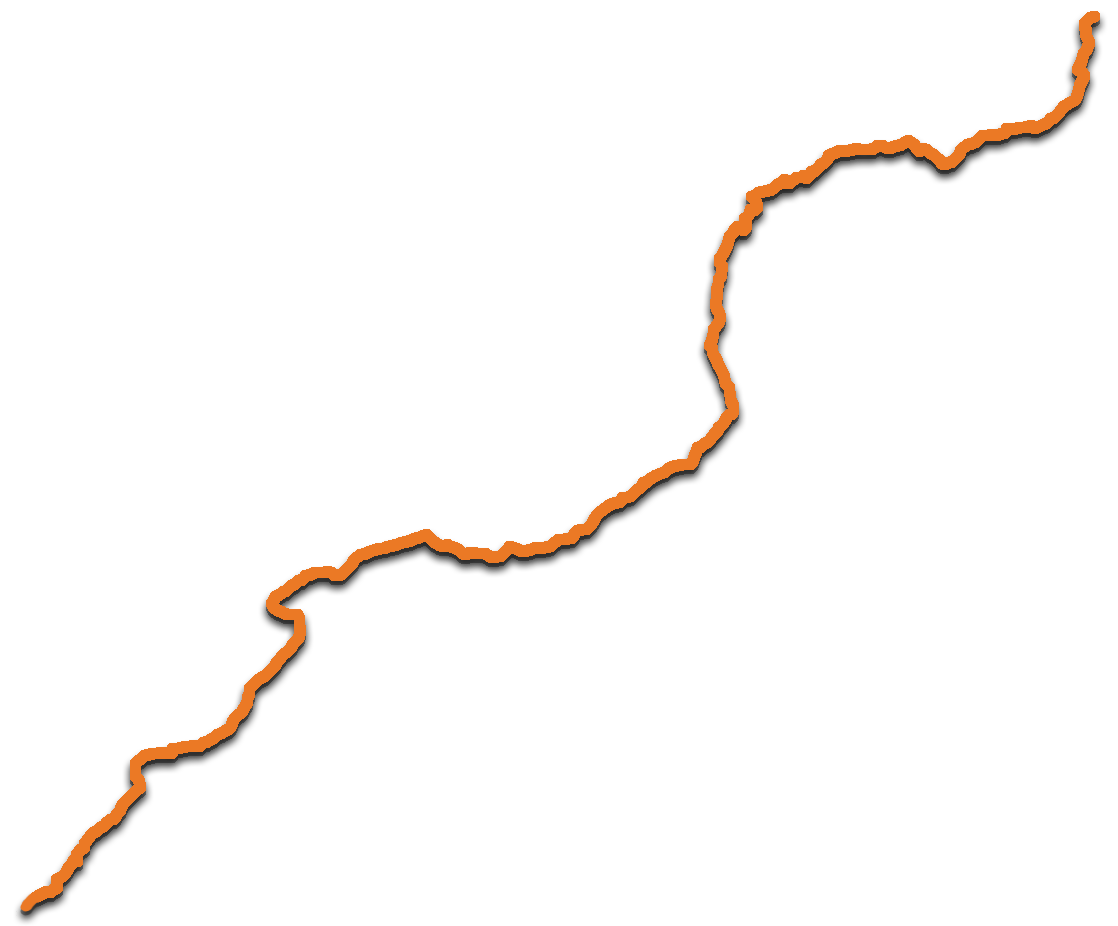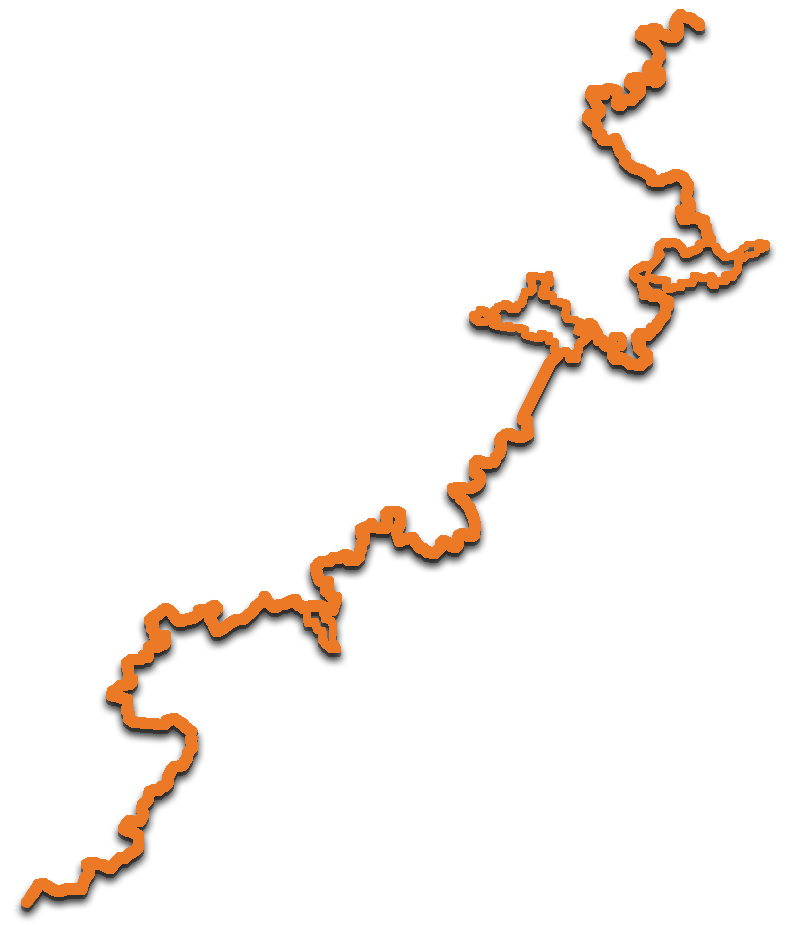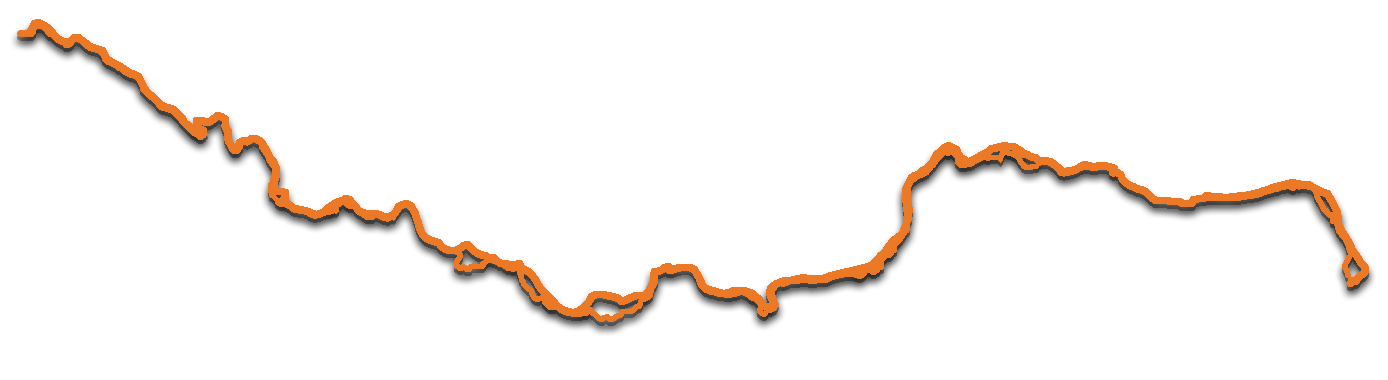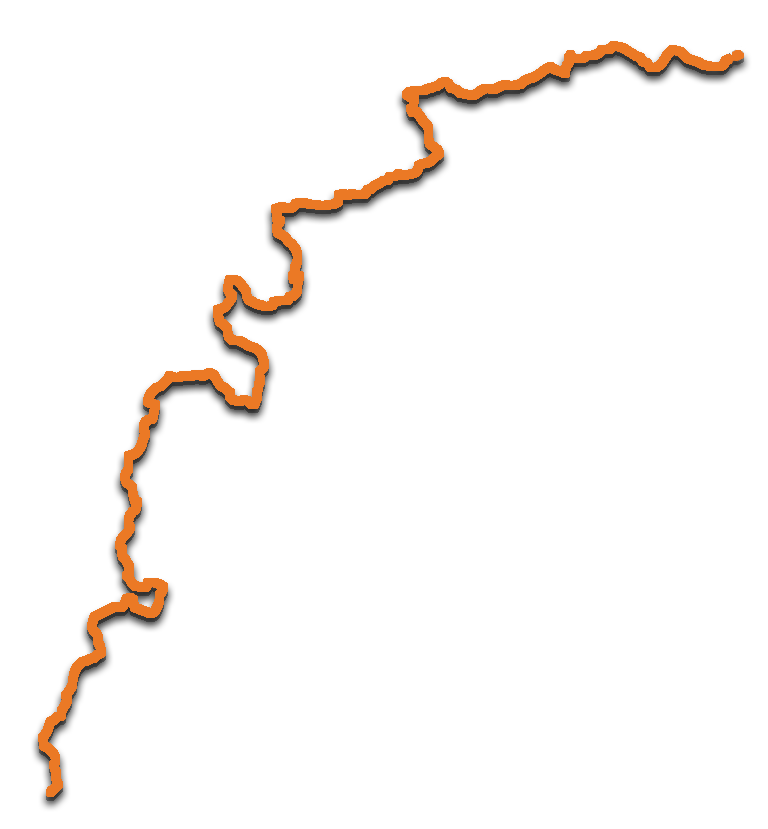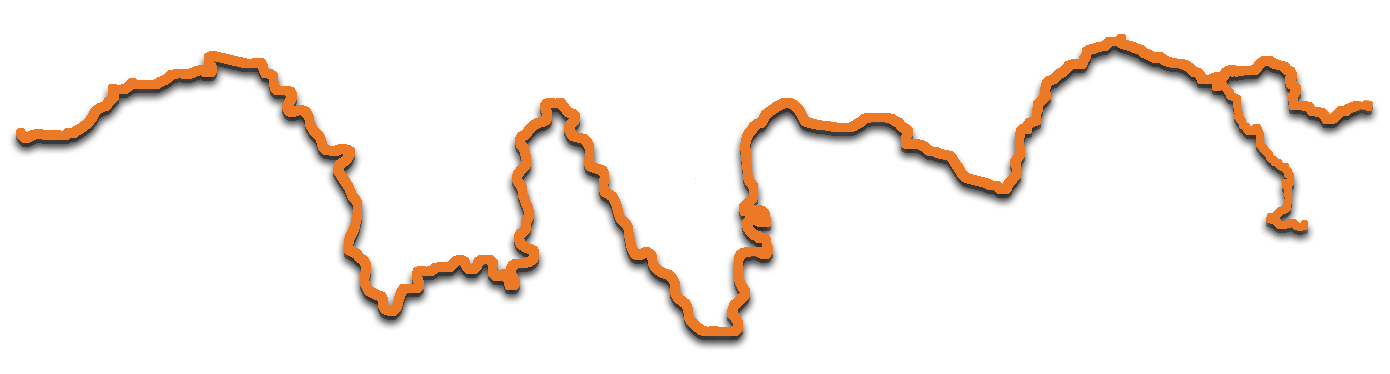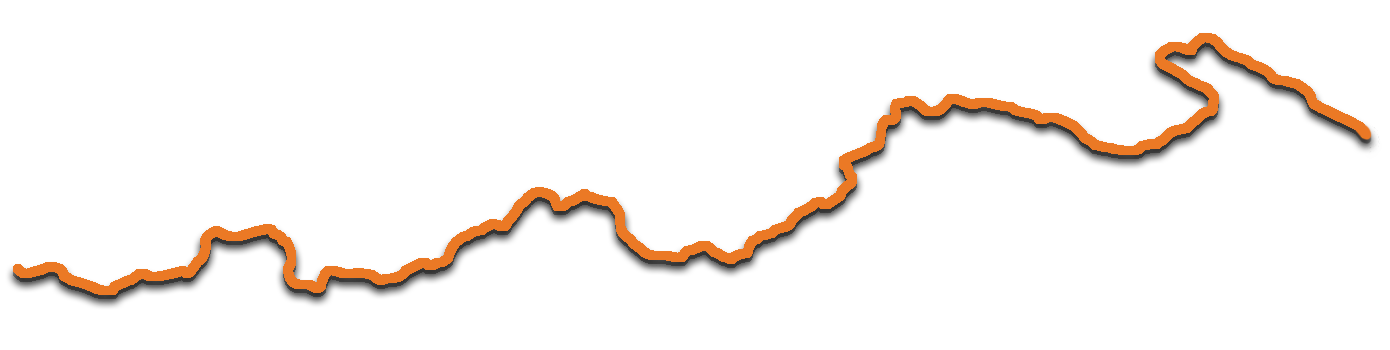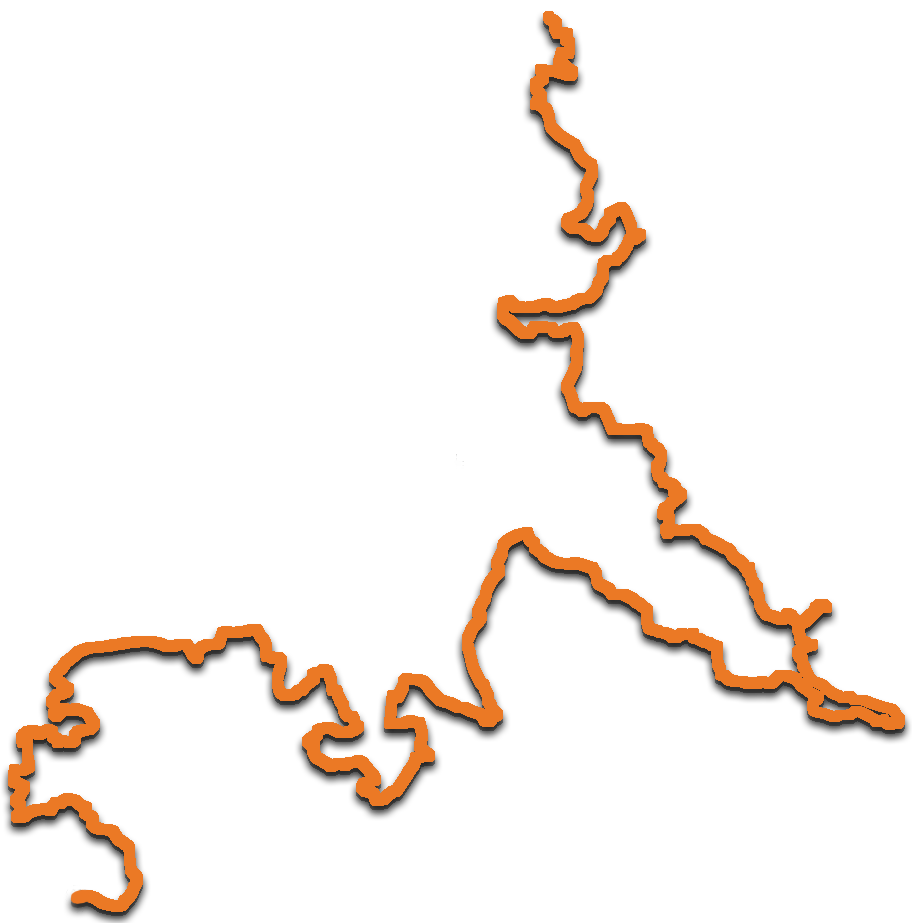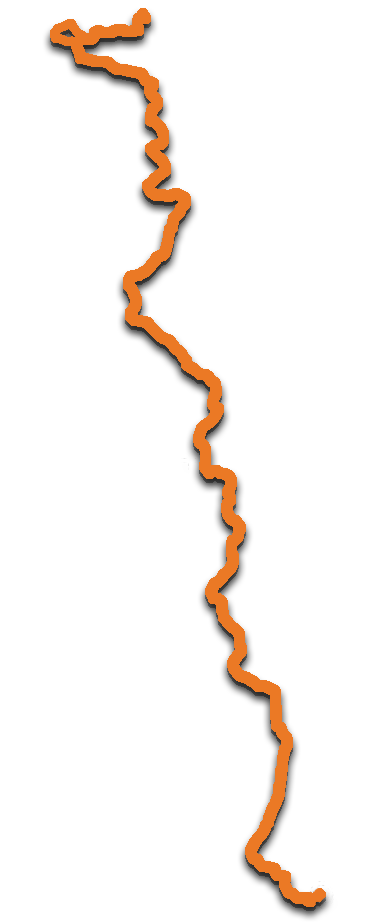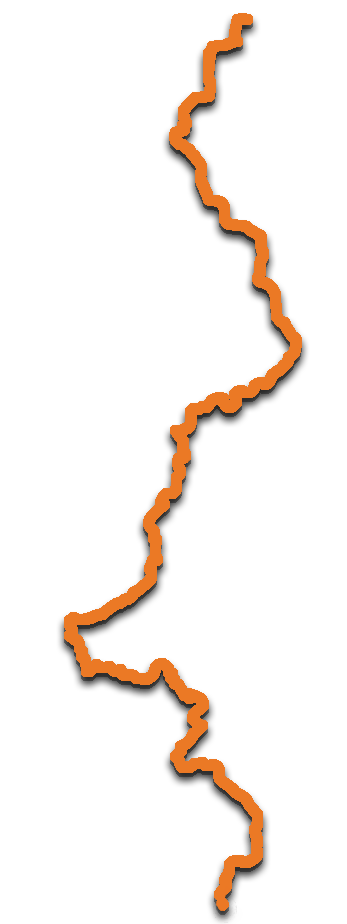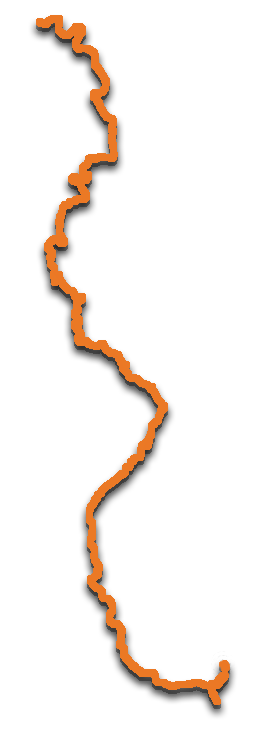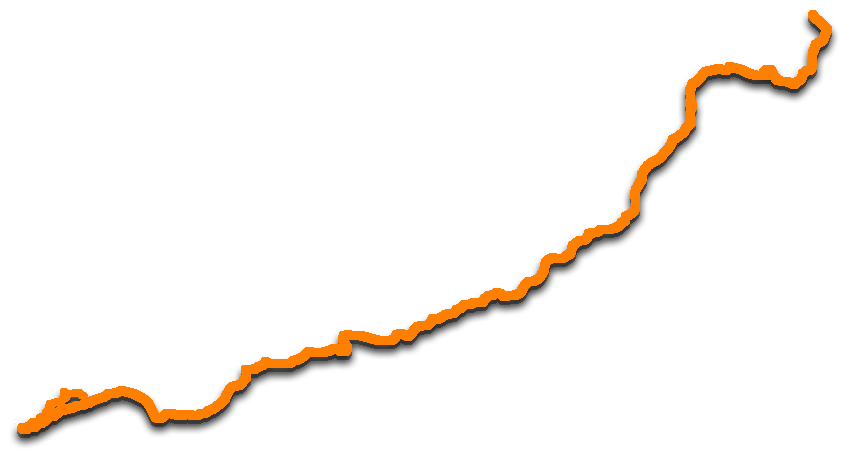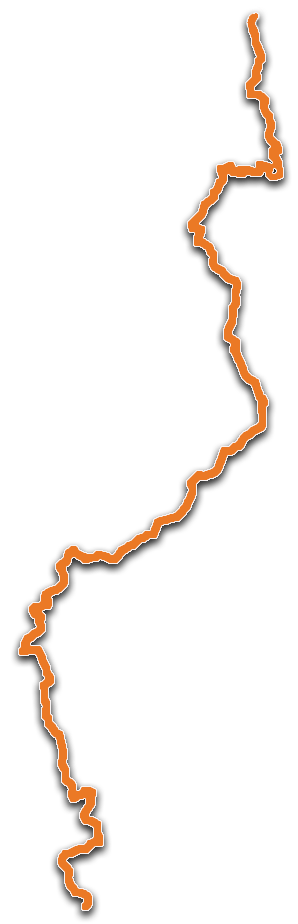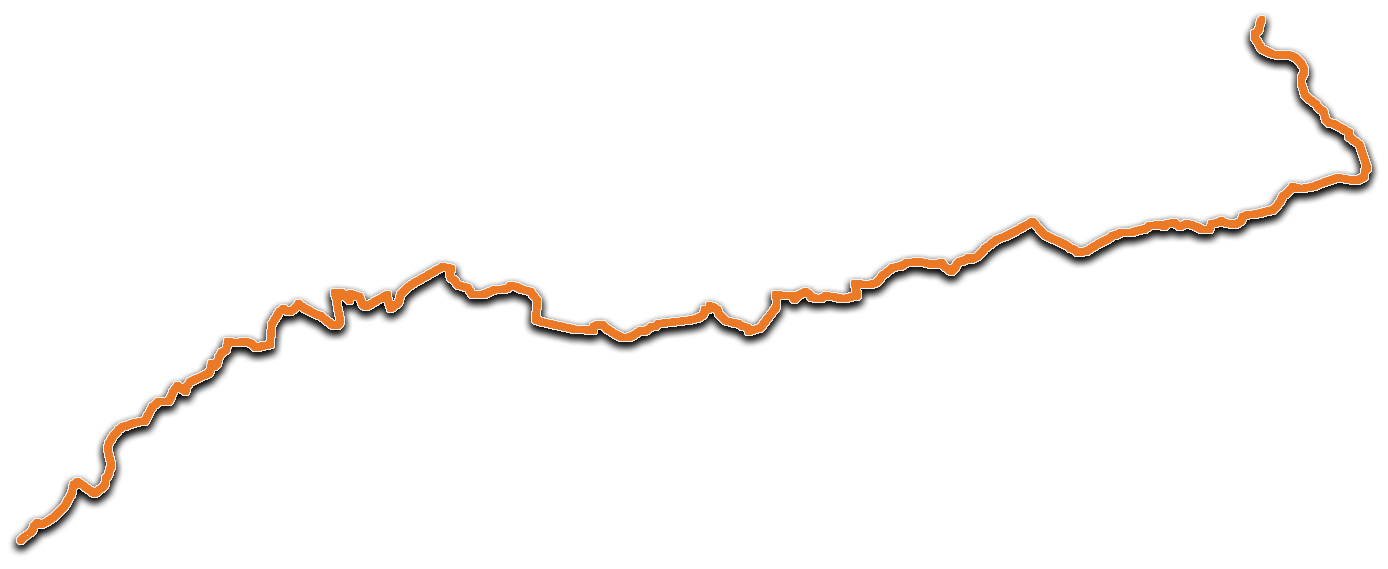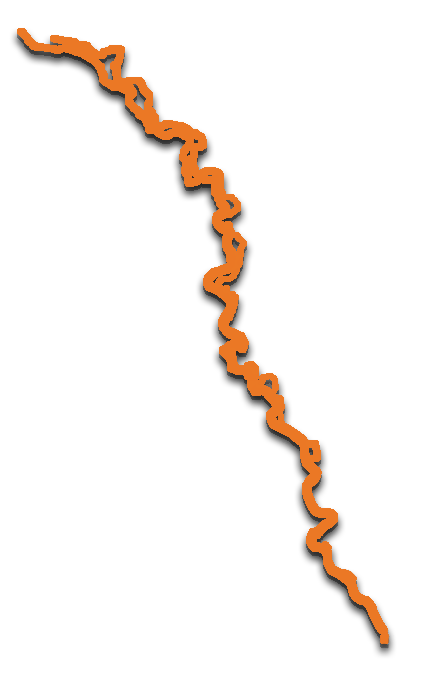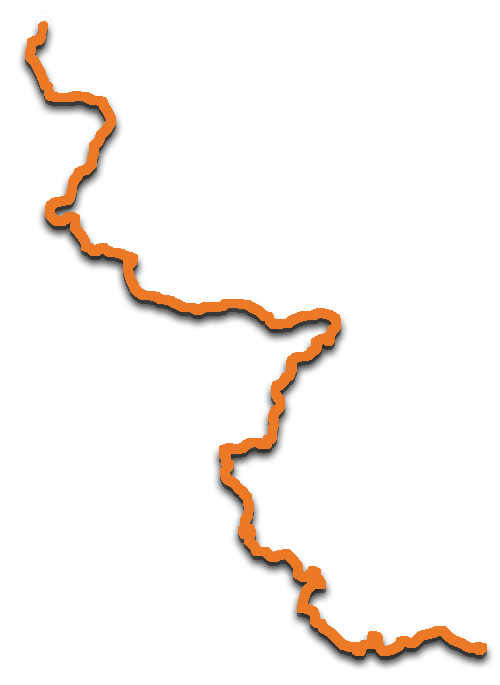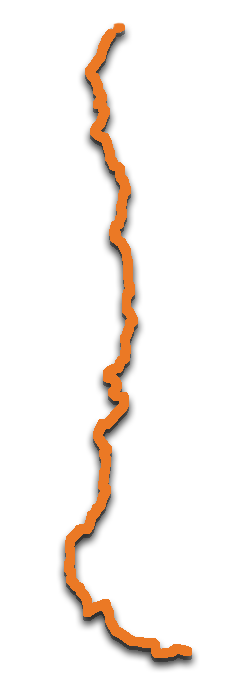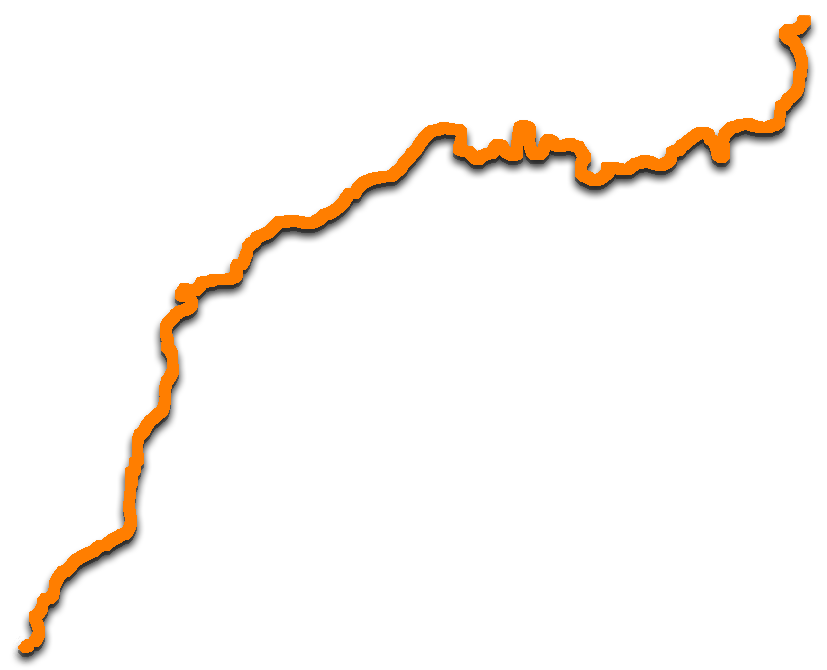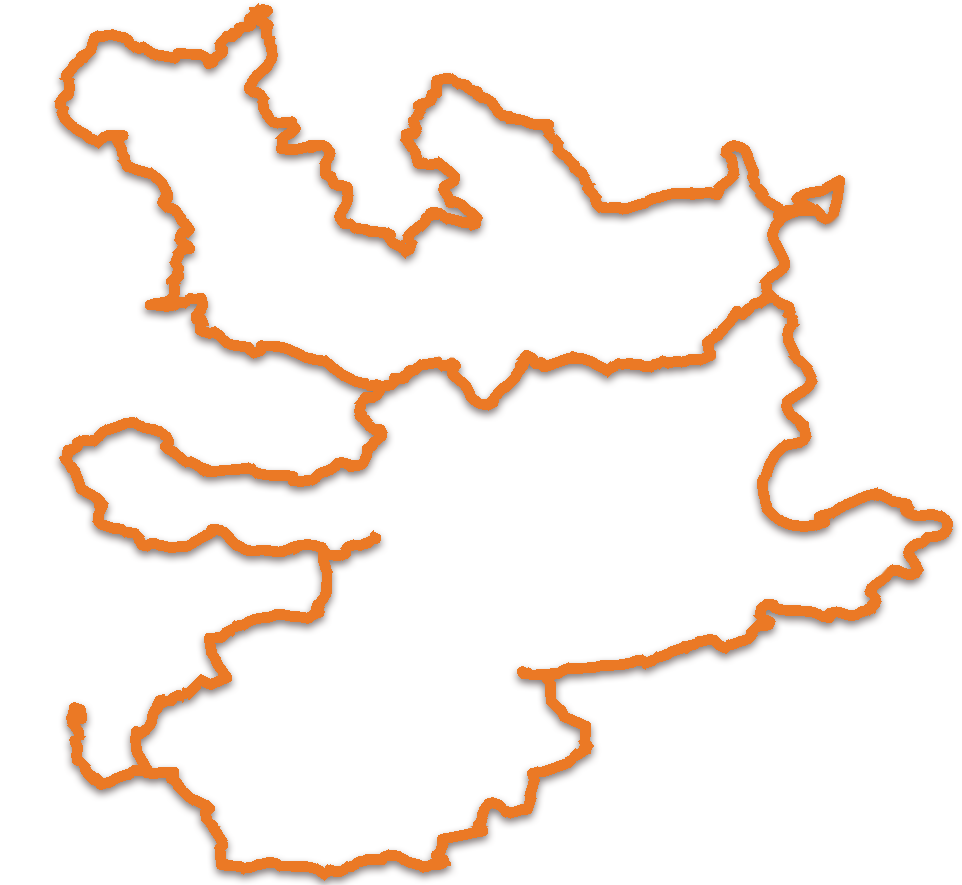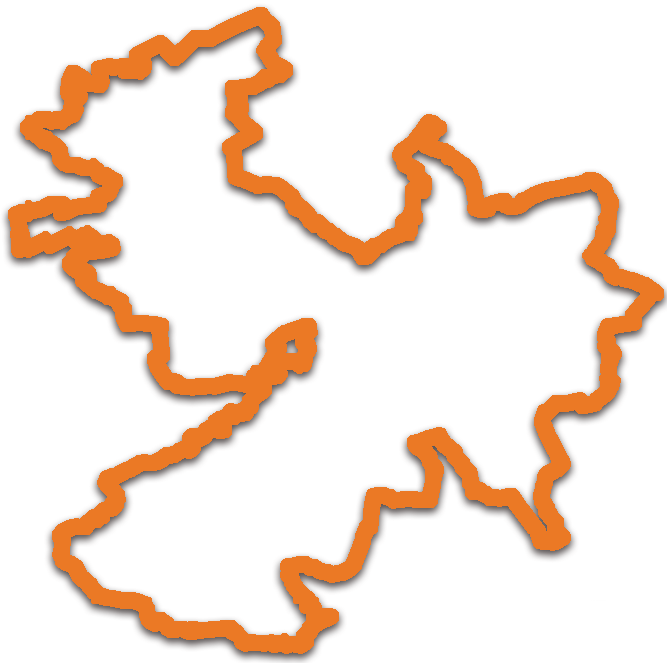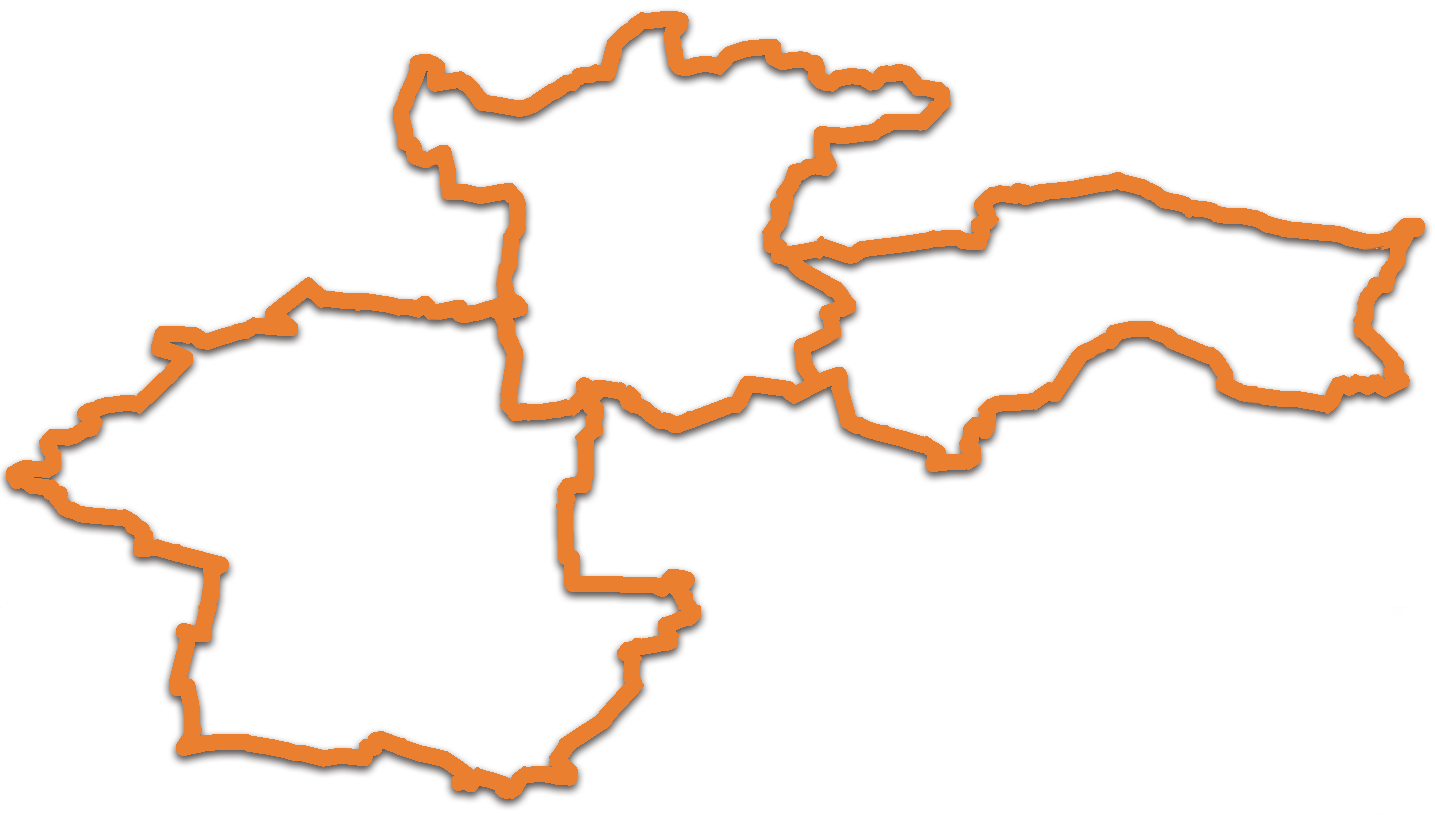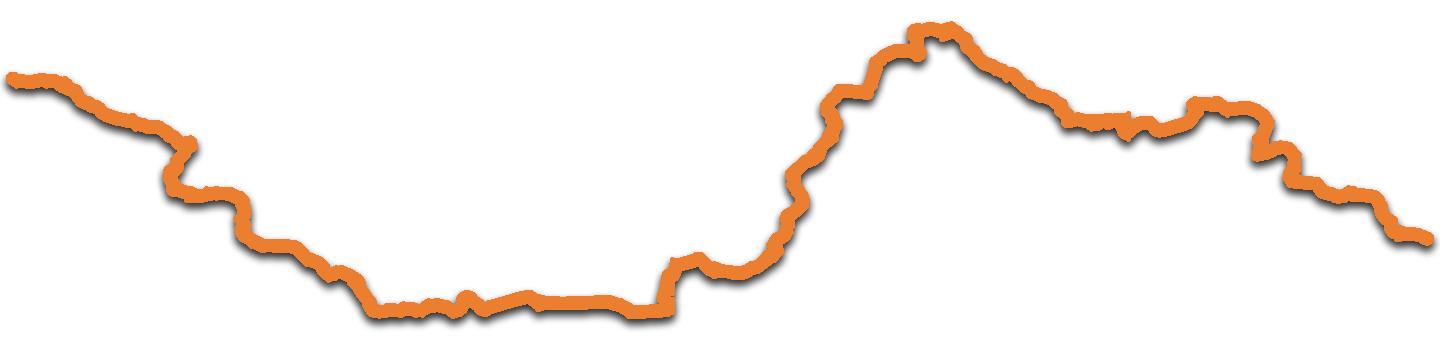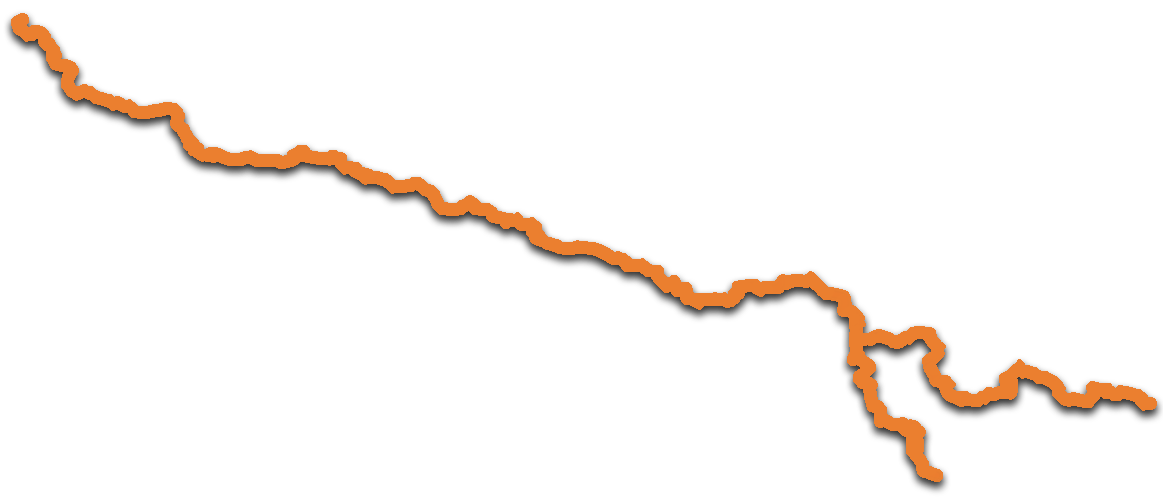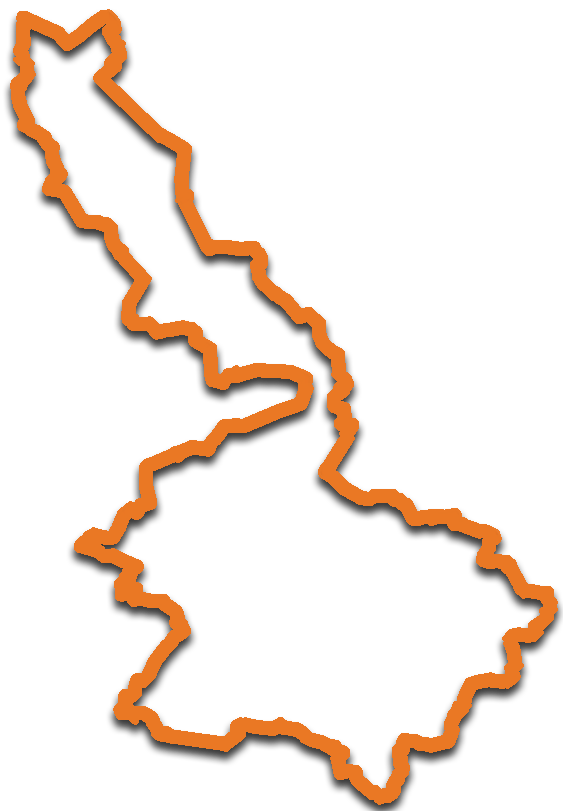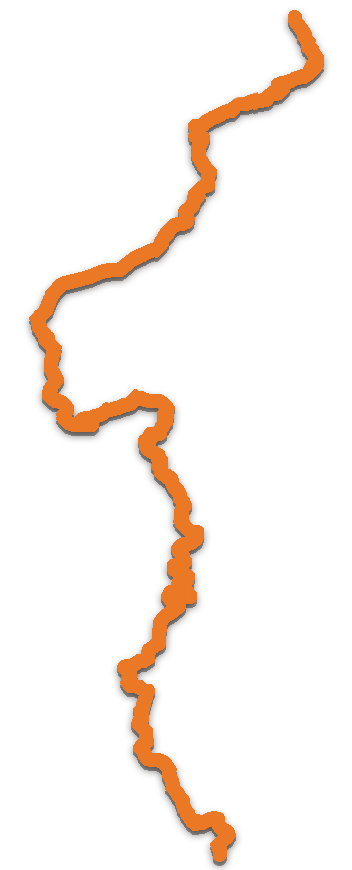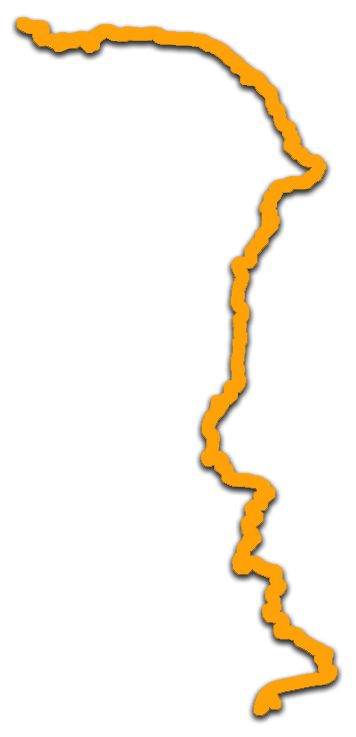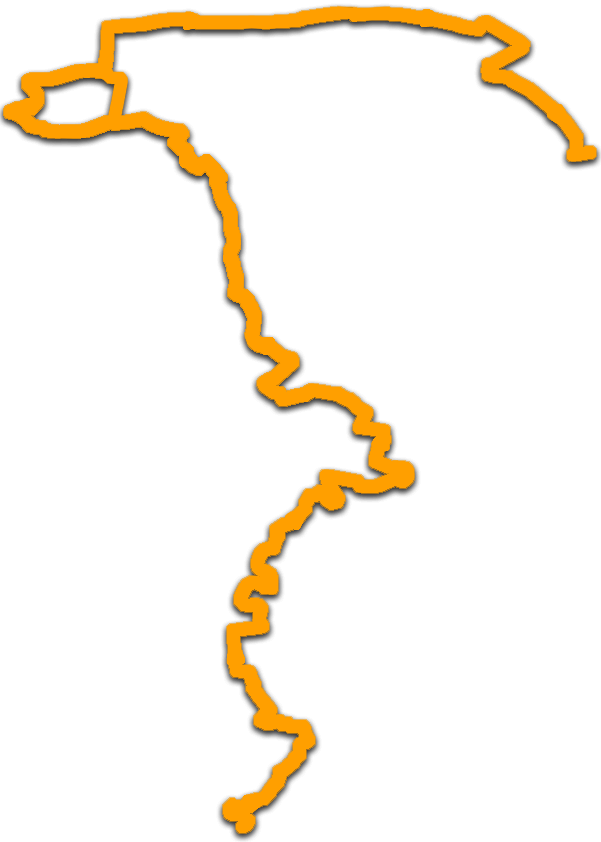Bodensee Radweg
er Bodensee ist – wenn man nach dem Wasservolumen geht – der zweitgrößte See Mitteleuropas. Das Bodenseebecken wurde durch die letzte Eiszeit ausgeformt.
Der Hauptzulauf ist der Alpenrhein im Südosten des Bodensees. Als Hochrhein fließt der See bei Stein am Rhein wieder ab. Der Bodensee gliedert sich in den Ober-, Unter- und Überlinger See. Neben Deutschland grenzen auch die Schweiz und Österreich an das Ufer des Sees. Für die Radwanderer ist diese Region ein Eldorado. Der Bodensee ist ein Klassiker unter den Radfernwegen und gehört zu den beliebtesten Radkursen Europas. Über 200.000 Pedalritter werden hier jährlich gezählt. Das leicht hüglige Umland, das Alpenpanorama, die vielen Sehenswürdigkeiten und das türkis glitzernde Wasser des Bodensees machen diese Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis! Der Rundkurs ist etwa 260 Kilometer lang und führt durch Baden-Württemberg, Bayern, das österreichische Bundesland Vorarlberg und durch die Schweizer Kantone St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen. Die größten Städte sind Konstanz, Friedrichshafen und Bregenz. Wer zwischendurch abkürzen möchte, dem stehen die verschiedenen Verkehrsschiffe der Weißen Flotte zur Verfügung, oder man nutzt eine der Autofähren.
Mehrere Abstecher sind möglich und durchaus empfehlenswert. So liegt der Rheinfall von Schaffhausen nur gut 20 Kilometer von der Hauptstrecke entfernt, das Schloss Salem sogar nur acht – allerdings geht es dorthin stark bergauf! Ein besonderer Tipp ist die Fahrt mit der Seilbahn auf den Hausberg Pfänder, auf der man das Fahrrad mitnehmen kann. Die Sausefahrt hinab ist eine tolle Gaudi – die Bremsen sollten allerdings im guten Zustand sein! Ansonsten bietet der Bodensee-Radweg eine Fülle von Sehenswürdigkeiten: alte Burgen und Schlösser, bezaubernde mittelalterliche Stadtkerne, interessante Inseln (Mainau, Reichenau, Lindau, Werd) und hochinteressante Museen, wie das Pfahlbaumuseum in Uhldingen oder das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen sowie die weltberühmte Seebühne in Bregenz.
Die Beschilderung ist länderübergreifend leider noch nicht ganz einheitlich. In Deutschland leitet ein stilisierter Radler mit einem runden Pfeil als Hinterrad, das blau gefüllt ist, den Weg. Das österreichische Pendant zeigt einen weißen Radler mit blauem Hinterrad in einem roten Kreis. In der Schweiz kann man auch dem Rheinradweg, der Schweizer Radroute #2 folgen, die denselben Wegen folgt.
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf www.bodensee-radweg.de.
Charakteristik
Obwohl die Alpen und die angrenzenden Mittelgebirge ständig in Sichtweite sind, verläuft der Radweg überwiegend flach in unmittelbarer Nähe des Sees. Ausnahmen sind jedoch Teilstücke bei Sipplingen, auf dem Bodanrück und auf der Halbinsel Höri. Auch bei den Abstechern zum Rheinfall oder zum Schloss Salem gibt es größere Steigungen. Die meisten Radler fahren im Uhrzeigersinn und in den Sommermonaten ist die Strecke stark frequentiert. Die Beschilderung ist beidseitig gut sichtbar angebracht, fällt jedoch in den verschiedenen Ländern leicht unterschiedlich aus. Die Oberflächenbeschaffenheit ist in der Regel gut und asphaltiert. Leider ist das Verkehrsaufkommen teilweise recht hoch, bei Friedrichshafen kann es schon unangenehm sein. Ansonsten ist die Tour familienfreundlich und kann auch von ungeübten Radlern bedenkenlos in Angriff genommen werden.
Ortschaften entlang der Route
Konstanz / Allensbach / Bodman-Ludwigshafen / Sipplingen / Überlingen / Uhldingen-Mühlhofen / Meersburg / Stetten / Hagnau am Bodensee / Immenstaad am Bodensee / Friedrichshafen / Eriskirch / Langenargen / Kressbronn am Bodensee / Nonnenhorn / Wasserburg (Bodensee) / Lindau (Bodensee) / Bregenz / Hard / Fußach / Höchst (Vorarlberg) / Gaißau / Rheineck SG / Thal SG / Rorschacherberg / Rorschach / Goldach SG / Horn TG / Steinach / Arbon / Egnach / Salmsach / Romanshorn / Uttwil / Kesswil / Güttingen / Altnau / Münsterlingen / Bottighofen / Kreuzlingen / Gottlieben / Tägerwilen / Ermatingen / Salenstein / Berlingen / Steckborn / Mammern / Eschenz / Stein am Rhein / Öhningen / Gaienhofen / Moos (am Bodensee) / Radolfzell am Bodensee / Reichenau
Konstanz
ie ehemalige Reichsstadt Konstanz liegt am Seerhein, einem nur 4 Kilometer langen Fluss innerhalb des Bodensee-Beckens, der den Obersee mit dem etwas tiefer gelegenen Untersee verbindet. Der Beginn des Seerheins wird mit der alten Konstanzer Rheinbrücke definiert. Hier beginnt die Kilometrierung des Rheins. Die Altstadt mit dem Stadtteil ‚Paradies‘ liegt linksrheinisch am Abfluss des Bodensees und bildet damit das einzige linksrheinische Gebiet in ganz Baden-Württemberg. Im Süden ist Konstanz mit seiner Schweizerischen Zwillingsstadt Kreuzlingen zusammengewachsen. Die Grenze zur Schweiz verläuft mitten durch einzelne Häuserzeilen. Als Fußgänger oder Radfahrer gibt es mehrere Übergänge, wo nur noch Schilder darauf hinweisen, dass man eine Staatsgrenze überschreitet. An warmen Sommerabenden trifft man sich am Hafen. Mit Blick auf den Bodensee kann man hier flanieren, verweilen und essen gehen. Hier befindet sich auch das Konzilgebäude – ursprünglich eigentlich nur ein riesiges Warenlager. Während des Konzils von Konstanz fand in diesem Bauwerk sogar einmal eine Papstwahl statt. Das Konzil, das hier 1414 bis 1418 stattfand, war der größte mittelalterliche Kongress nördlich der Alpen. Er hatte zum Ziel, die zerspaltene katholische Kirche wieder zu einigen. Papst Johannes XXIII. hatte ihn einberufen, doch endete dieser auch mit seiner Absetzung. Im Zuge des Konzils wurde der berühmte böhmische Kirchenreformer Jan Hus in Konstanz verhaftet, verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Er gilt als Wegbereiter für die protestantische Lehre des Martin Luther. Ein Museum und der Hussenstein erinnern an den großen Reformator. Aber auch die ‚Imperia‘, die bissig satirische Riesenfigur am Hafen von Konstanz, spielt auf die Machtspielchen während des Konzils an. Das Kunstwerk von Peter Lenk gehört inzwischen zu den Wahrzeichen der Stadt.
Das prägende Gebäude der Altstadt ist das Münster ‚Unserer Lieben Frau‘, das zu den größten und bedeutendsten Kirchenbauten am Bodensee gehört. In der markanten Basilica minor fanden damals die Verhandlungen des Konzils statt. Der Aufstieg zum Westturm bietet einen prächtigen Blick über die Stadt und den Bodensee. Zwischen Münster und Seerhein erstreckt sich der älteste Teil von Konstanz, die Niederburg, auch Paradies genannt. Sie beeindruckt durch eine geschlossene mittelalterliche Bebauung mit Häusern aus dem 12. – 15. Jahrhundert. In der gesamten Altstadt finden sich zahlreiche historische Gebäude, teilweise hübsch bemalt und eindrucksvolle Plätze, auf denen es sich gut verweilen lässt. Der Obermarkt und die Markstätte bildeten die wichtigsten Plätze im Mittelalter, am Münsterplatz wurden sogar die Reste eines römischen Kastells gefunden. Auffällig ist die hohe Anzahl von Kirchen und ehemaligen Klöstern. In der Stephanskirche predigte einst sogar Huldrych Zwingli, einer der weiteren großen Kirchenreformer. Mehrere Kirchen wurden inzwischen profaniert. So dient die einstige Paulskirche heute als Kulturzentrum K9. Von den Klöstern überlebte nur das Kloster Zoffingen die Wirren von Reformation und Säkularisierung.
Die neueren Stadtteile von Konstanz befinden sich nördlich des Rheines auf der Halbinsel Bodanrück. Hier befindet sich der Fähranleger, an dem die riesigen Autofähren anlegen, die Konstanz mit Meersburg auf der anderen Seite des Überlinger Sees verbinden. In diesem Teil des Bodensees befindet sich auch das bekannteste Eiland des Sees: die Blumeninsel Mainau. Sie ist durch eine langgestreckte Brücke mit dem Festland verbunden und bietet dem Besucher eine prachtvolle farbige Blumenlandschaft und eine vielschichtige subtropische und tropische Vegetation. Sehenswert sind auch das barocke Deutschordenschloss und die hübsche Schlosskirche.
Sehenswertes:
 Das Konstanzer Münster gehört zu den größten, bedeutendsten und ältesten Kirchenbauten am Bodensee. Sie ist das höchste Gebäude der Altstadt und prägt als markantes Bauwerk das gesamte Stadtbild. Ihr Ursprung wird um das Jahr 600 vermutet. 1200 Jahre lang diente die Kathedrale als Sitz der Bischöfe von Konstanz. Nach der Auflösung des Bistums im Jahre 1821 wird das Gotteshaus nur noch als einfache katholische Pfarrkirche genutzt. Zwischen 1414 und 1418 wurden in ihr auch die offiziellen Verhandlungen des Konzils von Konstanz abgehalten, welches die Einheit der zersplitterten katholischen Kirche mit mehreren parallel zueinander agierenden Päpsten beenden sollte. In dieser Zeit wurden in dem Gotteshaus rund 200 Predigten mit überwiegend kirchenpolitischen Themen gehalten.
Das Konstanzer Münster gehört zu den größten, bedeutendsten und ältesten Kirchenbauten am Bodensee. Sie ist das höchste Gebäude der Altstadt und prägt als markantes Bauwerk das gesamte Stadtbild. Ihr Ursprung wird um das Jahr 600 vermutet. 1200 Jahre lang diente die Kathedrale als Sitz der Bischöfe von Konstanz. Nach der Auflösung des Bistums im Jahre 1821 wird das Gotteshaus nur noch als einfache katholische Pfarrkirche genutzt. Zwischen 1414 und 1418 wurden in ihr auch die offiziellen Verhandlungen des Konzils von Konstanz abgehalten, welches die Einheit der zersplitterten katholischen Kirche mit mehreren parallel zueinander agierenden Päpsten beenden sollte. In dieser Zeit wurden in dem Gotteshaus rund 200 Predigten mit überwiegend kirchenpolitischen Themen gehalten.
Die heutige dreischiffige Basilica minor gehört zu den größten romanischen Bauwerken im südwestdeutschen Raum. Der damalige Neubau entstand ab 1054 unter Einbeziehung des Querhauses der Vorgängerkirche und wurde 1089 geweiht. Der breite Turmbau mit dem integrierten Westportal entstand zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert im gotisch geprägten Stil, die Turmspitze wurde jedoch erst im 19. Jahrhundert aufgesetzt. Die gotischen Seitenkapellen waren im 15. Jahrhundert ergänzt worden. Die üppige Innenausstattung stammt überwiegend aus dem Barock, des Klassizismus und der Neugotik und wirkt dadurch sehr uneinheitlich.
Die vorromanische Mauritiusrotunde mit ihrem frühgotischen Grabaufbau ist das Ziel vieler Pilger auf dem Jakobsweg. Sie wurde im Jahre 940 errichtet und schließt sich südlich an das Münster an. Den Aufstieg in den 40 m hohen Westturm sollte man sich nicht entgehen lassen, denn er bietet einen prächtigen Blick über die Stadt und den Bodensee.
Vor dem mächtigen Münster Unserer Lieben Frau erstreckt sich der Münsterplatz. Schon im 4. Jahrhundert hatte hier ein römisches Kastell gestanden. Noch heute stehen hier zwei weitere sehenswerte mittelalterliche Gebäude. Am ‚Haus zur Kunkel‘ beeindrucken alte Wandmalereien aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Das ‚Haus zur Katz‘ entstand 1425 und diente einst als Zunfthaus. Der schmucke Bau gilt als das älteste Renaissancegebäude nördlich der Alpen und wurde dem Palazzo Vecchio in Florenz nachempfunden. Heute gehört das Haus zur Katz zum Kulturzentrum am Münsterplatz.
Im Jahr 2003 entdeckte man unter dem Münsterplatz die Überreste eines römischen Kastells, das wahrscheinlich im 4. Jahrhundert errichtet worden war. Es gehörte zu einer befestigten Verteidigungslinie, die entlang des gesamten Bodenseeufers verlief. Als sich die Römer im Jahr 401 aus der Region zurückzogen, wurde auch dieses Kastell aufgegeben. Die freigelegten Ruinen befinden sich in einem unterirdischen Raum, der im Rahmen einer Führung besichtigt werden kann.
Zwischen dem Münster und dem Seerhein erstreckt sich das älteste Stadtviertel von Konstanz. Es entstand im 7. Jahrhundert als Wohnviertel der bischöflichen Bediensteten. Die heutigen historischen Bauwerke wurden zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert errichtet. Der Großteil der Altstadt ist als ein geschlossenes Viertel erhalten und blieb seit dem Mittelalter nahezu unverändert. So ist in dem Labyrinth aus schmalen und engen Gässchen die mittelalterliche Atmosphäre noch spür- und erlebbar. Die vielen kleinen Lädchen laden zum Stöbern und Bummeln ein und das rustikale Ambiente der alten Weinlokale und Bierhäuser lässt einen schönen Abend gemütlich ausklingen.
 Im Überlinger See befindet sich nördlich von Konstanz die Insel Mainau. Mit ihrer Fläche von 45 ha. ist sie die drittgrößte, aber wohl bekannteste Insel im Bodensee. Von Südwesten ist sie über eine langgestreckte Brücke zu erreichen. Es führen aber auch Schiffsverbindungen auf die Mainau. Das Eiland ist im Besitz der Grafenfamilie Bernadotte. Sie legten auf dem Molassekalkfelsen eine bunte Park- und Gartenanlage an. Dank des mediterranen Klimas gedeiht hier eine üppige subtropische, teilweise sogar tropische Vegetation, die der Mainau zu Recht auch den Beinamen ‚Blumeninsel‘ einbrachte. Trotz des relativ hohen Eintrittsgeldes erfreuen sich im Sommer zahlreiche Besucher an der überbordenden bunten Blütenpracht von Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Rhododendren und Azaleen. Im 1856 angelegten Arboretum finden sich rund 500 verschiedene, teils sehr seltene Laub- und Nadelbaumarten, darunter Mammutbäume, Tulpenbäume und Zedern. Im italienisch geprägten und streng symmetrisch angelegten Rosengarten blühen zwischen Wasserspielen und Skulpturen rund 500 verschiedene Rosenarten. Ein besonderer Augenschmaus ist der Südgarten, wo im Herbst die herrlichsten Dahliensorten mit leuchtenden Farben miteinander wetteifern. Daneben gibt es Deutschlands größtes Schmetterlingshaus, ein Pfauengehege und einen Streichelzoo.
Im Überlinger See befindet sich nördlich von Konstanz die Insel Mainau. Mit ihrer Fläche von 45 ha. ist sie die drittgrößte, aber wohl bekannteste Insel im Bodensee. Von Südwesten ist sie über eine langgestreckte Brücke zu erreichen. Es führen aber auch Schiffsverbindungen auf die Mainau. Das Eiland ist im Besitz der Grafenfamilie Bernadotte. Sie legten auf dem Molassekalkfelsen eine bunte Park- und Gartenanlage an. Dank des mediterranen Klimas gedeiht hier eine üppige subtropische, teilweise sogar tropische Vegetation, die der Mainau zu Recht auch den Beinamen ‚Blumeninsel‘ einbrachte. Trotz des relativ hohen Eintrittsgeldes erfreuen sich im Sommer zahlreiche Besucher an der überbordenden bunten Blütenpracht von Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Rhododendren und Azaleen. Im 1856 angelegten Arboretum finden sich rund 500 verschiedene, teils sehr seltene Laub- und Nadelbaumarten, darunter Mammutbäume, Tulpenbäume und Zedern. Im italienisch geprägten und streng symmetrisch angelegten Rosengarten blühen zwischen Wasserspielen und Skulpturen rund 500 verschiedene Rosenarten. Ein besonderer Augenschmaus ist der Südgarten, wo im Herbst die herrlichsten Dahliensorten mit leuchtenden Farben miteinander wetteifern. Daneben gibt es Deutschlands größtes Schmetterlingshaus, ein Pfauengehege und einen Streichelzoo.
Wo einst die Burg Mainau stand, wurde zwischen 1739 und 1746 das barocke Deutschordenschloss erbaut. Die Dreiflügelanlage ist der Sitz der Grafenfamilie Bernadotte, die den Nordflügel bewohnt. Im Mitteltrakt finden wechselnde Ausstellungen statt. Der ganz in Weiß und Gold gehaltene ‚Weiße Saal‘ wird häufig als historische Kulisse für Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt.
Neben dem Schloss steht die prächtig ausgestattete barocke Schlosskirche St. Marien. Der berühmte Architekt Johann Caspar Bagnato (1696 – 1757) errichtete sie zwischen 1732 und 1739. Die Saalkirche gilt als sein Erstlingswerk. Bagnato, der später auf der Insel verstarb, wurde in der Krypta beigesetzt.
Der gegenüber liegende Gärtnerturm gehörte einst zu der mittelalterlichen Befestigungsanlage und beherbergt heute ein Restaurant, in dem man mit Blick auf den Bodensee speisen kann.
 Von der mittelalterlichen Stadtmauer, die Konstanz bis in das 19. Jahrhundert ringartig umschloss, ist nur noch wenig erhalten. Einst besaß die Stadt 20 Wachtürme und Stadttore in zwei hintereinander liegenden Befestigungswällen. Die zweite Ringmauer war im 17. Jahrhundert hinzugekommen. Drei Elemente sind noch erhalten. Der Rheintorturm war einst der einzige Zugang zur Stadt von Norden. Ihm war eine Holzbrücke über den Rhein vorgebaut, die direkt zum Tor führte. Das Turmgebäude stammt noch aus dem 13. Jahrhundert, wurde aber im 15. Jahrhundert noch einmal umgebaut. Das bedeutendste erhaltene Tor ist das Schnetztor. Der Fachwerkturm entstammt dem 14. Jahrhundert, besitzt eine Zwingeranlage und begrenzte einst die Stadt nach Süden. Der Pulverturm am Rhein dient heute als Domizil der Narrenzunft. Er gehörte zur inneren Ringmauer.
Von der mittelalterlichen Stadtmauer, die Konstanz bis in das 19. Jahrhundert ringartig umschloss, ist nur noch wenig erhalten. Einst besaß die Stadt 20 Wachtürme und Stadttore in zwei hintereinander liegenden Befestigungswällen. Die zweite Ringmauer war im 17. Jahrhundert hinzugekommen. Drei Elemente sind noch erhalten. Der Rheintorturm war einst der einzige Zugang zur Stadt von Norden. Ihm war eine Holzbrücke über den Rhein vorgebaut, die direkt zum Tor führte. Das Turmgebäude stammt noch aus dem 13. Jahrhundert, wurde aber im 15. Jahrhundert noch einmal umgebaut. Das bedeutendste erhaltene Tor ist das Schnetztor. Der Fachwerkturm entstammt dem 14. Jahrhundert, besitzt eine Zwingeranlage und begrenzte einst die Stadt nach Süden. Der Pulverturm am Rhein dient heute als Domizil der Narrenzunft. Er gehörte zur inneren Ringmauer.
Zu einer spektakulären Unterwasserreise lädt das Sea Life Centre ein. In 30 verschiedenen Aquarien und Schaubecken kann man über 3.000 Tiere beobachten, die am oder im Wasser leben, darunter Haie, Pinguine und Meeresschildkröten. Die Unterwasserwelt des Rheines wird in ihrer Entwicklung vom Quellteich über den Alpenrhein und den Bodensee bis zur Nordsee bei Rotterdam nachvollzogen. Besonderer Anziehungspunkt ist das 320.000 Liter fassende Rote-Meer-Becken mit seinen gefährlich anmutenden Riffhaien und Muränen. In einem 8 m langen Acryltunnel kann der Besucher mitten durch diese eindrucksvolle Meereslandschaft laufen.
Als hochinteressante Erlebnisausstellung präsentiert sich das Bodensee-Naturmuseum im Sea Life Centre. Das Museum zum Anfassen und Mitmachen gewährt einen Überblick über die Entstehungsgeschichte des Bodensees und die vielfältigen Lebensräume im und am See. Die umfangreiche Präsentation stellt die verschiedenen hier lebenden Fischarten, Amphibien, Reptilien, Säugetiere und Vögel vor. Darüber hinaus werden Fossilienfunde und Modelle von ausgestorbenen Tierarten, die hier während der Eiszeit lebten, gezeigt. Auf dem Außengelände gibt es eine Ausstellung der hier vorkommenden Gesteinsarten.
 Am Hafen von Konstanz steht die 9 m hohe Betonstatue der ‚Imperia‘. Die massige, 18 t schwere Figur dreht sich alle vier Minuten einmal um die eigene Achse und bezieht sich satirisch auf das Konzil von Konstanz im 15. Jahrhundert. Sie stellt eine Kurtisane in eindeutig erotischen Pose dar, die in ihren Händen zwei entblößte Männlein trägt: Der eine mit den Insignien des Kaisers, der andere mit denen des Papstes.
Am Hafen von Konstanz steht die 9 m hohe Betonstatue der ‚Imperia‘. Die massige, 18 t schwere Figur dreht sich alle vier Minuten einmal um die eigene Achse und bezieht sich satirisch auf das Konzil von Konstanz im 15. Jahrhundert. Sie stellt eine Kurtisane in eindeutig erotischen Pose dar, die in ihren Händen zwei entblößte Männlein trägt: Der eine mit den Insignien des Kaisers, der andere mit denen des Papstes.
Geschaffen wurde die Skulptur 1993 durch den bekannten Bildhauer Peter Lenk (* 1947), der in Bodman-Ludwigshafen lebt. In der Bodenseeregion stolpert man häufig über seine Werke. Mit seinen satirisch-bissigen Arbeiten deutet er auf gesellschaftliche Missstände hin. Die ‚Imperia‘ gehört zu seinen berühmtesten Werken.
Lenk sagte einmal zu der ‚Imperia‘, dass es sich bei den beiden kleinen Figuren nicht um den Papst und den Kaiser handelt, sondern lediglich um Gaukler, die sich die Insignien der weltlichen und geistigen Macht angeeignet haben. Der Betrachter möge selber interpretieren, inwieweit die echten Päpste und Kaiser auch gleichzeitig Gaukler waren…
 Das Konzil von Konstanz war der größte mittelalterliche Kongress nördlich der Alpen. Er fand zwischen 1414 und 1418 statt und hatte zum Ziel, die zerspaltene katholische Kirche wieder zu einigen. Zeitweilig gab es bis zu drei Päpste nebeneinander, die ihre jeweiligen Machtpositionen auch mit kriegerischer Gewalt festigen wollten. So residierten in der Reichsstadt Konstanz eine Zeit lang der Gegenpapst Johannes XXIII., Kaiser Sigismund und zahlreiche Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe. Neben dem Gastgeber Fürstbischof Otto III. von Hachberg waren insgesamt 600 Kleriker beteiligt. Im Zuge des Konzils wurde der Reformer Jan Hus in Konstanz verhaftet, verurteilt und auf dem Scheiterhaufen hingerichtet.
Das Konzil von Konstanz war der größte mittelalterliche Kongress nördlich der Alpen. Er fand zwischen 1414 und 1418 statt und hatte zum Ziel, die zerspaltene katholische Kirche wieder zu einigen. Zeitweilig gab es bis zu drei Päpste nebeneinander, die ihre jeweiligen Machtpositionen auch mit kriegerischer Gewalt festigen wollten. So residierten in der Reichsstadt Konstanz eine Zeit lang der Gegenpapst Johannes XXIII., Kaiser Sigismund und zahlreiche Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe. Neben dem Gastgeber Fürstbischof Otto III. von Hachberg waren insgesamt 600 Kleriker beteiligt. Im Zuge des Konzils wurde der Reformer Jan Hus in Konstanz verhaftet, verurteilt und auf dem Scheiterhaufen hingerichtet.
Am Ufer des Bodensees steht das mächtige Konzilgebäude. Es wurde 1388 als Warenlager erbaut und diente lange Zeit als Umschlagsplatz für den Konstanzer Hafen. Im Jahre 1417 fand in dem dreistöckigen Gebäude das Konklave zur Wahl von Papst Martin V. statt. So bürgerte sich für das Hafenlager der Begriff ‚Konzilgebäude‘ ein. Heute nennt man es umgangssprachlich nur noch ‚das Konzil‘. Es beherbergt ein Gasthaus mit mehreren Tagungsräumen.
Nördlich des Rheines außerhalb der Altstadt von Konstanz stehen die alten Gebäude der Reichsabtei des Benediktinerordens. Dieser war bereits im 10. Jahrhundert gegründet worden. Die heutigen Klosterbauten entstanden allerdings erst 1769. Doch der Konvent überlebte die Säkularisierung nicht und wurde 1802 aufgelöst. Danach dienten die Abteigebäude zunächst als Adelswohnsitz, später als Militärkrankenhaus und als Kaserne. Noch bis 1977 waren hier französische Soldaten stationiert. Die Klosterkirche war inzwischen abgerissen worden. Im Westflügel der Anlage befindet sich heute das Stadtarchiv, im Ost- und Mittelflügel das Archäologische Landesmuseum mit seiner zentralen Schausammlung. Die Ausstellung zeigt nachgestellte Grabungsstätten, jungsteinzeitliche, bronzezeitliche und römische Siedlungsplätze sowie Darstellungen alter Burg-, Manufaktur- und Stadtanlagen. Ein moderner Anbau beherbergt mehrere Schiffsfunde, darunter das älteste Schiff vom Bodensee, das auf das Jahr 1340 datiert wurde.
Das 1454 erbaute einstige Zunfthaus der Metzger beherbergt heute die umfangreiche heimatkundliche Sammlung des Rosgartenmuseums. Das Museum existiert bereits seit 1870 und geht auf die Sammlung des Stadtrates und Apothekers Ludwig Leiner zurück, der seinerzeit mittelalterliche Kunstschätze und historisch bedeutende Gegenstände zusammentrug, um sie vor dem Verfall zu bewahren. Inzwischen besitzt das Museum eine ansehnliche Sammlung von Exponaten aus den Bereichen Kunst, Kultur und Geschichte, von der Frühgeschichte bis zur Moderne. Alle Gegenstände stammen aus Konstanz oder aus der Bodenseeregion. Der Prähistorische Saal, der inzwischen selber unter Denkmalschutz steht, stellt mit einer Museumseinrichtung des 19. Jahrhunderts ein Museum im Museum dar. Sehenswert ist der Zunftsaal der Metzger, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann.
 Die Galerie zeigt in jährlich mehrfach wechselnden Kunstschauen Gemälde, Druckgraphiken und Plastiken aus dem eigenen Bestand. Das umfangreiche Konvolut besteht aus rund 7.000 Werken und geht auf die Sammlung des Theologen Ignaz Heinrich Karl Freiherr von Wessenberg (1774 – 1860) zurück. Dieser hatte seinerzeit auch eine riesige Privatbibliothek von über 20.000 Buchbänden besessen, die heute als Wessenberg-Bibliothek innerhalb der Bibliothek der Universität Konstanz für Forschungszwecke zugänglich ist.
Die Galerie zeigt in jährlich mehrfach wechselnden Kunstschauen Gemälde, Druckgraphiken und Plastiken aus dem eigenen Bestand. Das umfangreiche Konvolut besteht aus rund 7.000 Werken und geht auf die Sammlung des Theologen Ignaz Heinrich Karl Freiherr von Wessenberg (1774 – 1860) zurück. Dieser hatte seinerzeit auch eine riesige Privatbibliothek von über 20.000 Buchbänden besessen, die heute als Wessenberg-Bibliothek innerhalb der Bibliothek der Universität Konstanz für Forschungszwecke zugänglich ist.
Das Eiland gehört mit einer Fläche von 1,8 ha zu den kleineren Inseln im Bodensee. Sie ist durch einen nur 6 m breiten Graben von der Altstadt getrennt und somit nicht sofort als Insel erkennbar. Eine Brücke führt über den schmalen Graben hinüber. Schon die Römer hatten hier ein Kastell errichtet. Zuvor hatte auf der Insel eine keltische Fischersiedlung bestanden. Im 13. Jahrhundert übernahmen Dominikanermönche das Landstück, um darauf ein Kloster zu errichten, in dem später auch der berühmte Mystiker und Dichter Heinrich Suso lebte. Im Jahre 1415 wurde in dem Kloster der Reformator Jan Hus festgesetzt, bevor er als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Dominikanerkloster aufgelöst und die Gebäude wurden zunächst als Fabrik genutzt. Nach einer umfangreichen Renovierung befindet sich heute ein Luxushotel in dem alten Gemäuer. Der mittelalterliche Kreuzgang mit seinen großen Wandbildern, die allerdings erst im späten 19. Jahrhundert entstanden, ist noch erhalten. Die ehemalige Klosterkirche mit den alten Märtyrer-Fresken wird vom Hotel als Festsaal genutzt.
Der aus Tschechien stammende Theologe Jan Hus (um 1369 – 1415) war einer der bedeutendsten Kirchenreformer des Mittelalters und gilt als Wegbereiter für die Lehren Martin Luthers. Auf dem Konzil von Konstanz wurde er gemeinsam mit seinem Wegbegleiter Hieronymus von Prag wegen Ketzerei zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt.
Das historische Fachwerkgebäude aus dem 15. Jahrhundert, in dem sich heute das Hus-Museum befindet, soll im November 1414 die letzte Herberge von Jan Hus gewesen sein, bevor er verhaftet wurde. Das Museum zeigt Dokumente und Bilder über das Leben und Wirken des Kirchenreformers sowie zur Hussittenbewegung, die nach dessen Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen entstand. Die Hussitten agierten vor allem gegen die böhmischen Könige, die damals in Personalunion auch das Amt des deutschen Kaisers bekleideten sowie gegen die Katholische Kirche. Die Auseinandersetzungen gipfelten in den Jahren 1419 bis 1434 in den Hussittenkriegen.
Der aus Tschechien stammende Theologe Jan Hus (um 1369 – 1415) war einer der bedeutendsten Kirchenreformer des Mittelalters und gilt als Wegbereiter für die Lehren Martin Luthers. Auf dem Konzil von Konstanz wurde er gemeinsam mit seinem Wegbegleiter Hieronymus von Prag wegen Ketzerei zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt.
Der Hussenstein ist ein großer Findling mit einer Innschrift, der an die grausame Verbrennung des religiösen Vordenkers an dieser Stelle erinnert. An jedem 6. Juli, dem Todestag von Jan Hus und Hieronymus von Prag, findet hier eine Gedenkfeier statt. Hus, dessen Name aus dem tschechischen übersetzt ‚Gans‘ bedeutet, soll kurz vor der Vollstreckung gesagt haben: ‚Heute bratet ihr eine Gans. Aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen!‘
Das bereits 1607 eingerichtete Theater gilt als die älteste dauerhaft bespielte Sprechbühne Deutschlands. Ursprünglich war sie ein Teil vom Gymnasium des Konstanzer Jesuitenklosters und die ersten Schauspieler waren Jesuitenschüler. Die heutige Aufteilung von Bühnenturm und Zuschauerraum entstand bei einem Umbau in den 1930er Jahren. Das Theater bietet Platz für insgesamt 400 Personen.
Die älteste Kirche in Konstanz ist die Stephanskirche. Sie wurde bereits in der späten Römerzeit gegründet und befand sich zunächst außerhalb der ersten Siedlung von Konstanz. Vermutlich handelte es sich bei dem ersten Gotteshaus um ein Holzgebäude. Um 900 siedelte sich an der Kirche ein Kollegiatstift an. Während dieser Zeit entwickelte sich um St. Stephan eine eigene Siedlung und 1130 wurde die Kirche dann zu einer romanischen Basilika ausgebaut. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche nochmals erheblich ausgebaut und erhielt dabei ihr heutiges Aussehen. In der Reformationszeit war St. Stephan zeitweilig zwinglisch. Huldrych Zwingli (1484 – 1531) selber predigte in der Kirche. Von der wertvollen Innenausstattung ist das Sakramentshäuschen von 1594 erwähnenswert. Von der barocken Ausstattung (17./18. Jhd.) sind nur noch die Kanzel, mehrere Figuren und Teile des Orgelprospektes erhalten. Der Hochaltar von 1863 ist neugotisch.
Von dem 1268 gegründeten innerstädtischen Augustinerkloster ist nur die ehemalige Stiftskirche erhalten. Nach der Auflösung des Klosters im Jahre 1802 wurden die restlichen Ordensgebäude abgebrochen. In der dreischiffigen gotischen Basilika beeindrucken die spätgotischen Wandgemälde. Sie wurden von Kaiser Sigismund gestiftet und stammen noch aus der Zeit des Konstanzer Konzils im 15. Jahrhundert. Mitte des 18. Jahrhunderts erhielt das Gotteshaus ein barockes Spiegelgewölbe mit reichhaltigen Stuckaturen. Gleichzeitig wurden die Kirchenwände mit Gemälden ausgeschmückt.
Das evangelische Gotteshaus mit dem schlanken Turm und dem spitzen Turmhelm wurde zwischen 1865 und 1873 erbaut. Dank der hervorragenden Akustik wird die Kirche am Lutherplatz sehr häufig für Konzerte genutzt.
Die ehemalige Paulskirche stammt ursprünglich aus romanischer Zeit. Das Gebäude befindet sich mitten in der Altstadt, wurde aber bereits im 19. Jahrhundert profaniert. Heute dient es als kommunales Kunst- und Kulturzentrum K9. Hier finden Kabarett- und Theaterveranstaltungen, Konzerte, Performances und Discos statt. Im Inneren sind noch zahlreiche Details aus dem ehemaligen Gotteshaus zu entdecken. Daneben gibt es auch eine Café-Bar mit einem gemütlichen Biergarten im Außenbereich.
Außerhalb der Stadtmauern von Konstanz hatte im heutigen Stadtteil Allmannsdorf bereits im 13. Jahrhundert eine Kirche gestanden. Der markante Kirchturm stammt noch aus dieser Zeit und mutet wie ein wehrhafter Wachturm an. Er gehört heute zu den Wahrzeichen von Konstanz. Das ehemalige gotische Kirchenschiff wurde 1845 abgetragen und durch einen Neubau ersetzt.
Ursprünglich war die Christuskirche in der Konstanzer Altstadt als Jesuitenkirche erbaut worden. Sie entstand zwischen 1604 und 1607 im Stil der Spätrenaissance, wurde aber bereits 75 Jahre später barockisiert. Nachdem der Jesuitenorden 1733 aufgelöst wurde, hielt man in der Kirche zunächst Schulgottesdienste ab. Noch immer sind im Chorgestühl die Ritzereien von Schülern aus dem 18. und 19. Jahrhundert erhalten. Diese Unart ist also keinesfalls nur ein Unfug der Neuzeit! Seit 1904 wurde das Gotteshaus dann durch die Alt-Katholische Gemeinde genutzt. Die Ausstattung entstammt dem Stil des Rokoko. Sehenswert sind der Hochaltar mit vergoldetem Tabernakelaufsatz, die beiden Seitenaltäre, das Madonnenbild aus dem 18. Jahrhundert sowie die Kanzel mit ihrem reichen Schnitzwerk.
Im Jahre 1257 gründete Bischof Eberhard II. von Konstanz das Dominikanerinnenkloster. Die Schwesterngemeinschaft überlebte als einziges Konstanzer Kloster sowohl die Reformation als auch die Säkularisierung. Seit 1775 hatten die Schwestern hier eine Mädchenschule betrieben. Bis heute ist der Konvent von Nonnen bewohnt. Die Klosterkirche St. Katharina wurde im 18. Jahrhundert barock umgestaltet. Trotzdem sind noch immer spätromanische und gotische Bauelemente deutlich erkennbar.
Das Mitte des 13. Jahrhunderts gegründete Franziskanerkloster wurde im Zuge der Säkularisierung aufgehoben. Im ausgehenden 17. Jahrhundert hatte man die Gebäude des Bettelordenklosters noch barockisiert und teilweise sogar neu aufgebaut. Die Stadt Konstanz übernahm die historischen Gebäude nach der Auflösung des Konvents und nutzt sie seit 1845 als Schulhaus und Stadthalle.
Als während des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1632 die Schweden vor Konstanz lagen, gelobten die Bürger den Bau einer Kapelle, sollten die Belagerer wieder abziehen. Die schwedischen Heerscharen zogen im folgenden Jahr tatsächlich wieder ab und so entstand 1638 eine schlichte Kapelle, die der Gnadenkapelle im italienischen Loreto nachempfunden wurde. Sehenswert ist ein Gnadenbild aus gotischer Zeit, das sich im Innenraum hinter dem Altar befindet.
Die offene überdachte Bethalle vor der Kapelle wird auch heute noch für Gottesdienste genutzt.
Das siebenstöckige Gebäude in der Hohenhausgasse wurde 1294 durch Bischof Heinrich von Klingenberg und seinem Bruder Albrecht als repräsentatives Bürgerhaus erbaut. Lange Zeit war es das höchste Profangebäude in Konstanz. Die Wandmalereien stammen allerdings erst aus dem letzten Jahrhundert.
 Im 16. Jahrhundert diente das historische Rathaus noch als Zunfthaus der Leinenweber. 1593 erfolgte der Umbau im Renaissance-Stil. Die Fassadenmalereien an der Vorderfront entstanden 1864 und stellen Szenen aus der Stadtgeschichte dar. Ein Bilderfries beschreibt den historischen Friedensschluss von Konstanz im Jahre 1183 zwischen Kaiser Friedrich I. Barbarossa und den Städten der Lombardei und die Auseinandersetzung zwischen dem katholischen Kaiser Karl V. und der protestantischen Bevölkerung im Jahre 1548. Sehenswert ist der im Renaissancestil gestaltete Innenhof.
Im 16. Jahrhundert diente das historische Rathaus noch als Zunfthaus der Leinenweber. 1593 erfolgte der Umbau im Renaissance-Stil. Die Fassadenmalereien an der Vorderfront entstanden 1864 und stellen Szenen aus der Stadtgeschichte dar. Ein Bilderfries beschreibt den historischen Friedensschluss von Konstanz im Jahre 1183 zwischen Kaiser Friedrich I. Barbarossa und den Städten der Lombardei und die Auseinandersetzung zwischen dem katholischen Kaiser Karl V. und der protestantischen Bevölkerung im Jahre 1548. Sehenswert ist der im Renaissancestil gestaltete Innenhof.
Im Mittelalter war der Obermarkt neben der Marktstätte der wichtigste Platz der Reichsstadt. Hier befanden sich die Gerichtsstätte und der Pranger. An diesem wurden Mitbürger wegen minderer Vergehen gefesselt zur Schau gestellt, um sie dem Spott des Volkes auszusetzen. Das Anprangern war eine Ehrenstrafe. Auch heute ist der Obermarkt einer der zentralen Plätze von Konstanz und Anlaufpunkt einer jeden touristischen Führung, denn er wird von einer Vielzahl von historisch bemerkenswerten Bauten umgeben. Dazu gehören im Norden die Häuser ‚Zum Egli‘ und ‚Zum Kemlin‘ (15. Jhd.), in denen sich heute das Hotel Barbarossa befindet, im Osten das spätgotische Hochhaus ‚Zum Hohen Hafen‘ mit seinen berühmten Wandgemälden (um 1900), im Süden das ‚Malhaus‘ und der ‚Fischgrat‘, der im 13. Jahrhundert auch als Richtstätte diente und im Westen das Haus ‚Zum großen Mertzen‘ mit seinem auffälligen Giebel aus dem frühen 17. Jahrhundert.
An der Marktstätte steht das 1774 erbaute Haus ‚Zum Wolf‘. Es gehört damit zu den wenigen Neubauten in Konstanz in dieser Zeit. Bemerkenswert ist die in der Stadt einzigartige und reich mit Ornamenten verzierte Rokokofassade.
Neben dem Obermarkt war die Münzstätte einst der wichtigste Platz der Reichsstadt Konstanz. Hier befindet sich auch der 1897 vom Bildhauer Hans Baur geschaffene und in den 1980er Jahren umgestaltete Kaiserbrunnen. Er besitzt zahlreiche Anspielungen auf Begebenheiten aus der Vergangenheit der Stadt.
Bereits im 17. Jahrhundert hatte auf der Halbinsel zwischen Obersee und Überlinger See ein Rebgut gestanden. Nach dem Abriss entstand 1889/90 auf den alten Fundamenten im Stil der Neo-Renaissance das Schloss Seeheim. 45 Jahre lang wurde es durch den Dichter Wilhelm von Scholz bewohnt. Heute beherbergt es eine Akademie und ein Café-Restaurant.
Radrouten die durch Konstanz führen:
Allensbach
uf der Halbinsel Bodanrück zwischen Konstanz und Bodan-Ludwigshafen befindet sich der Ort Allensbach. Im Norden wird das Gemeindegebiet vom Überlinger See, im Süden vom Untersee begrenzt. Bekannt geworden ist der idyllisch gelegene Ort durch das Institut für Demoskopie, das uns bei jeder Wahl die neusten Prognosen und Hochrechnungen präsentiert. Das Gebiet wurde bereits in der Jungsteinzeit besiedelt. Die Grabungsstätten am Strandbad gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe ‚Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen‘. Auch die Römer haben hier Spuren hinterlassen. Im Mittelalter besaß Allensbach sogar die Stadtrechte und eine Stadtmauer. Doch seit der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, bei dem der Marktflecken stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, ruhten die Stadtrechte – bis zum heutigen Tage! Wahrzeichen des Ortes ist die Nikolauskirche mit ihrem markanten Zwiebelturm. Drei Schlösser liegen verstreut im Hinterland des betulichen Dorfes. Ein besonderes Naturspektakel bietet die Marienschlucht bei Kargegg, wo sich ein Bächlein tief in den Abhang zum Bodensee eingefräst hat. Ein Holztreppensteg führt hinunter zu einem Schiffsanleger mit Anschluss nach Überlingen, Bodman und Ludwigshafen.
Sehenswertes:
Fritz Mühlenweg (1898 – 1961) war ein Kaufmann, der zwischen 1927 und 1932 drei Mal die Mongolei bereiste. Dabei hatte er auch an der letzten Ostasien-Expedition des Sven Hedin teilgenommen. Seine Reisen, die Erfahrungen und die Eindrücke verarbeitete er später in zwei Romanen, zahlreichen Erzählungen und Bildern. Sein preisgekröntes Buch ‚In geheimer Mission durch die Wüste Gobi‘ machte ihn zum Bestsellerautor. Mühlenweg zog 1935 nach Allensbach, wo er bis zu seinem Tode lebte. Das Mühlenweg-Museum in den oberen Räumen des Bahnhofes erzählt die Lebensgeschichte des Literaten. Neben zahlreichen Gegenständen aus seinem Nachlass werden Fotographien und ein Expeditionsfilm gezeigt.
Der Heimatgeschichtsverein Arbeitsgemeinschaft Allensbach e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, bewahrenswertes aus der Region des Bodanrück zu erhalten und zu pflegen. Die Sammlung umfasst heimatgeschichtliche und volkskundliche Exponate sowie Gemälde einheimischer Künstler. Besonderes Augenmerk wird auf die jungsteinzeitlichen Funde gelegt, die man im Bereich des heutigen Strandbades geborgen hatte. Einst hatte hier eine Pfahlbausiedlung bestanden. Die Grabungsstätte gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Die katholische Kirche St. Nikolaus ist das Wahrzeichen von Allensbach. Der markante Zwiebelturm wurde 1698 erbaut. Das Langschiff ist etwas jünger. Es entstand erst zwischen 1732 und 1735. Bemerkenswert sind der Hochaltar von 1804 sowie zwei ältere Seitenaltäre, die aus der Zeit des Rokoko stammen.
Erhaben steht auf einer kleinen Anhöhe über dem Dorf Freudental das gleichnamige Schloss. Das zweistöckige Barockbauwerk besitzt zwei hübsche gegliederte Volutengiebel, die außen durch Kugeln und Obelisken geschmückt werden. Die nordöstliche Seite wird von einem Mittelrisalit beherrscht, der die obere Fensterreihe etwas überragt. Schloss Freudental wurde 1698 bis 1700 durch Franz Dominik von Paßberg erbaut. Mehrfach wechselten in der Folgezeit die Besitzer und im 19. Jahrhundert blieb es lange Zeit sogar vollständig unbewohnt. Später diente das Gebäude dann als Kriegsgefangenenstätte, als Kinderheim, als Forschungslaboratorium und als Flüchtlingslager. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten kann man das Schloss heute für Veranstaltungen und Tagungen mieten.
Das Dorf Langenrain wurde als Siedlung erstmals 1288 genannt. Damals veräußerten die Herren von Bodman Teile ihrer Güter an das Kloster Salem, später auch an die Herren von Homburg, doch beide Male fiel der Besitz wieder an die Familie Bodman zurück. Im 18. Jahrhundert wurde das heutige Barockschloss und die Kirche St. Josef durch die Herren von Ulm-Langenrain erbaut, die das Gut durch Erbschaft erhalten hatten. Als das Geschlecht mit der Stiftsdame Maria Antonia von Ulm-Langenrain 1814 ausstarb, fiel das Schloss erneut an die Familie Bodman, die in Langenrain auch heute noch wesentliche Ländereien besitzt. Das Bodmansche Barockschloss wird heute als Seminargebäude durch das Institut für Weiterbildung der Fachhochschule Konstanz genutzt.
Nahe des Dorfes Hegne, östlich vom Kernort Allensbach, steht das Schloss Hegne. Aus dem ehemals freistehenden Adelssitzes ist heute ein riesiger Gebäudekomplex geworden, der als Kloster der ‚Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz‘ dient. Das mittelalterliche Schloss stammt vermutlich aus dem 16. Jahrhundert. Ein genaueres Datum ist nicht bekannt. Es wird aber vermutet, dass es bereits eine Burg als Vorgängerbau gegeben hat. 1591 fiel es an den Konstanzer Hochstift. Die Bischöfe bauten das Anwesen zu einem prächtigen Renaissanceschloss aus, um dieses dann als Sommerresidenz zu nutzen. Erst 1803 fiel Schloss Hegne im Zuge der Säkularisierung wieder an weltliche Besitzer. Die Eigentümer wechselten zunächst in rascher Folge. Bis 1882 wurde das Anwesen im Neorenaissancestil überarbeitet, wobei die gesamte Innenarchitektur verändert wurde. Die Außenbefestigung mit den beiden Ecktürmen und der achteckige Treppenturm blieben jedoch in alter Bausubstanz erhalten. 1892 wurde das Schloss schließlich zum Kloster umfunktioniert und immer weiter ausgebaut. Die Klosterkirche St. Konrad wird von zahlreichen Pilgern aufgesucht, da sich in der Krypta das Grab der Ulrika von Hegne befindet. Während das Kloster als Pflegeheim, als Tagungs- und Gästehaus sowie als Sitz der Ordensprovinz Baden-Württemberg dient, ist im eigentlichen Schloss das Noviziat untergebracht.
Im Norden der Halbinsel Bodanrück fällt das Gelände bei Kargegg steil zum Überlinger See ab. Ein kleiner Bach hat hier eine tiefe Schlucht in den fast 100 m tiefen Steilhang gefräst, die teilweise gerade einmal einen Meter Breite misst. Ein Holzsteg führt von der oberen Aussichtsplattform am niederstürzenden Bachlauf entlang bis hinunter zum See. Unten befindet sich ein Landesteg mit Schiffsverbindungen nach Bodman, Ludwigshafen und Überlingen. Am oberen Rand des Abhanges finden sich noch die Mauerreste der vor langer Zeit geschleiften Burgruine Kargegg. Der überwiegende Teil des Weges darf übrigens aus Sicherheitsgründen von Radfahrern nicht genutzt werden. Ein kleiner Fußmarsch lohnt sich aber in jedem Fall!
Auf einem 74 ha großen Gelände werden in verschiedenen Gehegen mehr als 300 Wildtiere gehalten. Neben Rot-, Schwarz- und Damwild finden sich in dem weitläufigen Park auch Braunbären, Wisente und Luchse, aber auch Kleintiere wie Esel und Ponys. Besonders beliebt sind die Flugvorführungen der Falknerei, bei der man verschiedene Greifvögel wie Falken, Adler und Eulen in Aktion bestaunen kann.
Radrouten die durch Allensbach führen:
Bodman-Ludwigshafen
m westlichen Ende des Überlinger Sees liegt die Doppelgemeinde Bodman-Ludwigshafen. Sie entstand 1975 aus der Zusammenlegung der beiden zuvor selbstständiger Gemeinden.
Auf der Südseite des Bodenseearms liegt Bodman. Die Gegend war schon in der Jungsteinzeit besiedelt. Die hier gefundenen Pfahlbausiedlungen gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auch römische Spuren aus dem 1. Jhd. n. Chr. sind nachweisbar. Im 9. Jhd. stand hier die Kaiserpfalz ‚Potamico‘ der Karolinger, die namensgebend für den Bodensee wurde: aus Potamico wurde Bodman und daraus wurde der Begriff ‚Bodensee‘ abgeleitet. Die Grafenfamilie von Bodman ist seit dem 13. Jhd. hier ansässig. Das Schloss Bodan ist seit 1760 der Stammsitz der Familie, ihre Familiengruft befindet sich in der Kirche St. Peter und Paul. Die oberhalb des Ortes auf einer Kuppe des Bodanrücks liegende Ruine Alt-Bodman ist das Wahrzeichen des Überlinger Sees. Am Ortsausgang Richtung Ludwigshafen befindet sich eine Freilichtausstellung mit zahlreichen Skulpturen des bekannten hier lebenden Bildhauers Peter Lenk.
Am Westufer des Sees liegt Ludwigshafen, das ehemalige Sernatingen. Bereits 1145 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Im Jahre 1826 ließ der Großherzog Ludwig von Baden hier einen großen Hafen mit dem Großherzoglich Badischen Hauptzollamt erbauen. Ziel war es, den Güterschiffsverkehr auf dem Bodensee zu fördern und den Ort zu einem wichtigen Umschlagspunkt auszubauen. Doch die aufkommende Eisenbahn machte diese ehrgeizigen Ambitionen zunichte. Das heutige Wahrzeichen des Ortes, das Zollhaus verblieb als stummer Zeuge dieser fehlgeschlagenen Pläne und dient heute als Rathaus sowie als Bürger- und Gästezentrum. Im Zweiten Weltkrieg war Ludwigshafen Ziel mehrerer Luftangriffe, die den Ort schwer beschädigten.
Zwischen den beiden Ortsteilen liegt das Naturschutzgebiet Honsele. Das über 130 ha große Ried ist Brut- und Rastgebiet für zahlreiche Vogelarten, wie Eisvögel, Zwergtaucher und die Nachtigall.
Sehenswertes:
 Inmitten einer weitläufigen englischen Parkanlage steht das klassizistische Schloss Bodman. Es wurde 1831/32 als Nachfolgebau eines Mitte des 18. Jahrhunderts errichteten Schlosses erbaut. Die Eckrisalite wurden 1907/09 ergänzt. Seit 1760 ist das Schloss der Stammsitz der Grafenfamilie von Bodman, die auch heute noch das Anwesen bewohnt. Aus diesem Grunde kann nur der Schlosspark besichtigt werden.
Inmitten einer weitläufigen englischen Parkanlage steht das klassizistische Schloss Bodman. Es wurde 1831/32 als Nachfolgebau eines Mitte des 18. Jahrhunderts errichteten Schlosses erbaut. Die Eckrisalite wurden 1907/09 ergänzt. Seit 1760 ist das Schloss der Stammsitz der Grafenfamilie von Bodman, die auch heute noch das Anwesen bewohnt. Aus diesem Grunde kann nur der Schlosspark besichtigt werden.
Nicht weit entfernt steht der alte Schlosstorkel von 1772, der noch bis 1960 zum Pressen der hier angebauten Weinreben genutzt wurde.
Hoch über dem Ort Bodman auf einem Hang des Bodanrücks steht weithin sichtbar die Ruine Alt Bodman. Die über einen Fußweg zu erreichende ehemalige Burg ist das Wahrzeichen des Überlinger Sees. Sie war zu Beginn des 14. Jahrhunderts erbaut worden, nachdem die Vorgängerburg auf dem benachbarten Frauenberg niedergebrannt war. Die neue Burg geriet sehr viel repräsentativer und wehrhafter. Trotzdem wurde sie während des Schwabenkrieges 1499 schwer beschädigt. Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges wurde sie 1643 durch die Franzosen schließlich niedergebrannt und danach nicht wieder aufgebaut. Die Grafenfamilie von Bodman ließ sich später im neuen Schloss innerhalb des Ortes nieder. Um 1900 ließ der Graf von und zu Bodman an den einstigen mächtigen Wohnturm eine Aussichtsplattform anbringen. Auch der ehemalige Palas, Teile der Zwinger und der Umfassungsmauern sind noch erstaunlich gut erhalten. Die Ruine wurde inzwischen renoviert und ist heute der Öffentlichkeit zugänglich.
 Der Großherzog Ludwig von Baden hatte im 19. Jahrhundert große Pläne mit dem damaligen Ort Sernatingen. Er wollte den Güterschiffsverkehr fördern und ließ deshalb 1826 einen großen Hafen erbauen, den er Ludwigshafen nannte. Dabei entstand das mächtige Hauptzollamt als Warenumschlagplatz und Lagerhalle, das noch heute das Seeufer beherrscht. Wenig später wurde auch der gesamte Ort stolz in ‚Ludwigshafen‘ umbenannt. Allein der Erfolg des Projektes blieb aus, denn der aufkommende Eisenbahnverkehr machte die Wassertransportpläne zunichte und die avisierte Blüte Ludwigshafens fiel damit aus. Das Zollhaus, das heute das Wahrzeichen des Ortes ist und ein alter, gut erhaltener Holzkran erinnern noch an diese Zeit. Heute befindet sich in dem Gebäude das Rathaus, Tagungs- und Ausstellungsräume sowie das Bürger- und Gästezentrum.
Der Großherzog Ludwig von Baden hatte im 19. Jahrhundert große Pläne mit dem damaligen Ort Sernatingen. Er wollte den Güterschiffsverkehr fördern und ließ deshalb 1826 einen großen Hafen erbauen, den er Ludwigshafen nannte. Dabei entstand das mächtige Hauptzollamt als Warenumschlagplatz und Lagerhalle, das noch heute das Seeufer beherrscht. Wenig später wurde auch der gesamte Ort stolz in ‚Ludwigshafen‘ umbenannt. Allein der Erfolg des Projektes blieb aus, denn der aufkommende Eisenbahnverkehr machte die Wassertransportpläne zunichte und die avisierte Blüte Ludwigshafens fiel damit aus. Das Zollhaus, das heute das Wahrzeichen des Ortes ist und ein alter, gut erhaltener Holzkran erinnern noch an diese Zeit. Heute befindet sich in dem Gebäude das Rathaus, Tagungs- und Ausstellungsräume sowie das Bürger- und Gästezentrum.
Auf dem Frauenberg über dem Überlinger See steht weithin sichtbar das Kloster Frauenberg. Ursprünglich hatte hier die Burg der Ritter von Bodman gestanden, doch diese war bei einem verheerenden Feuer im Jahre 1307 niedergebrannt. Der Graf hatte den Burgplatz danach dem Zisterzienserkloster Salem überlassen, um auf einer benachbarten Bergkuppe eine neue Burg zu erbauen. Schon 1309 war die neue Kapelle fertig gestellt worden.
Das Klostergebäude ist wohl auf den Grundmauern der alten Burganlage errichtet worden, wurde aber in seiner Geschichte vielfach umgebaut. Der derzeitige Bau entstand zwischen 1610 und 1613, wobei das heutige Erscheinungsbild wohl dem Aussehen von 1800 entspricht. Nach der Auflösung des Klosters dienten die Gebäude als Jagdschloss, Jugendherberge und als Puppenmuseum. Erst 1982 zog mit der ‚Communitas Agnus Dei‘ wieder eine katholische Gemeinschaft in das Kloster ein. Die alte Wallfahrtskapelle ist für Besucher zugänglich.
Hinter der Szenerie: Der gerettete Stammhalter Am 16. September des Jahres 1307 ereignete sich auf der Burg der Ritter von Bodman eine grausame und folgenschwere Katastrophe. Die gesamte Familie saß beisammen, während ein furchtbares Unwetter aufzog. Ein Blitz schlug in das Gemäuer ein und die Burg fing Feuer. Die Flammen umschlossen die Gesellschaft und sieben Familienmitglieder sowie drei Bedienstete verloren in der Feuersbrunst ihr Leben. Neben dem Grafen überlebte auch sein einjähriger Sohn, der Stammhalter des Geschlechtes. Die Amme hatte ihn geistesgegenwärtig in einen eisernen Kessel gesetzt und diesen mitsamt dem Knaben den Berghang hinunterrollen lassen. Der Junge blieb tatsächlich unverletzt! An der Stelle, wo der Kessel zu Liegen kam, erinnert noch heute ein Sandsteinobelisk an diese glückliche Fügung. Der Graf überließ den Burgplatz aus Dankbarkeit dem Zisterzienserkloster Salem unter der Bedingung, dort eine Kapelle und ein Priesterhaus zu errichten.
 Das älteste Gebäude Bodmans wurde im 15. Jahrhundert erbaut, wobei Mauerteile eines Vorgängerbaus übernommen wurden. Die Kirche besitzt einen seitlichen Kirchturm und im Inneren eine sehenswerte Kassettendecke aus dem 17. Jahrhundert. Zu den wertvollen Kunstschätzen gehören zwei Holztafelgemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert. In der gräflichen Gruftkapelle im hinteren Teil des Gotteshauses wurden die Ritter von Bodman beigesetzt.
Das älteste Gebäude Bodmans wurde im 15. Jahrhundert erbaut, wobei Mauerteile eines Vorgängerbaus übernommen wurden. Die Kirche besitzt einen seitlichen Kirchturm und im Inneren eine sehenswerte Kassettendecke aus dem 17. Jahrhundert. Zu den wertvollen Kunstschätzen gehören zwei Holztafelgemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert. In der gräflichen Gruftkapelle im hinteren Teil des Gotteshauses wurden die Ritter von Bodman beigesetzt.
Die dem hl. Otmarius geweihte Kirche wurde in den 1960er Jahren neu aufgebaut, nachdem das alte Kirchenschiff wegen Baufälligkeit weitgehend abgetragen wurde. Dennoch stammen einige alte Bauteile noch aus dem 13. bzw. 14. Jahrhundert. Der 52m hohe Kirchturm besitzt einen markanten Treppengiebel und eine hübsche sechseckige Turmspitze. Sehenswert sind der Hochaltar aus dem frühen 18. Jahrhundert sowie die beiden Seitenaltäre.
 In der Bodenseeregion stolpert man häufig über die Werke des bekannten Bildhauers Peter Lenk (*1947), der in Bodman lebt. Mit seinen satirisch-bissigen Arbeiten deutet er auf gesellschaftliche Missstände hin. Zu seinen berühmtesten Werken zählt die ‚Imperia‘ am Konstanzer Hafen und das 10 x 4 m große Relief ‚Ludwigs Erbe‘ neben dem Hauptzollamtes von Ludwigshafen. Das Triptychon aus dem Jahre 2008 ist eine deftige Abrechnung mit der Habgier und dem Egoismus in der heutigen Zeit. Dabei werden auch mehrere deutsche Politgrößen als Global Player dargestellt…
In der Bodenseeregion stolpert man häufig über die Werke des bekannten Bildhauers Peter Lenk (*1947), der in Bodman lebt. Mit seinen satirisch-bissigen Arbeiten deutet er auf gesellschaftliche Missstände hin. Zu seinen berühmtesten Werken zählt die ‚Imperia‘ am Konstanzer Hafen und das 10 x 4 m große Relief ‚Ludwigs Erbe‘ neben dem Hauptzollamtes von Ludwigshafen. Das Triptychon aus dem Jahre 2008 ist eine deftige Abrechnung mit der Habgier und dem Egoismus in der heutigen Zeit. Dabei werden auch mehrere deutsche Politgrößen als Global Player dargestellt…
Am Ortsausgang von Bodman in Richtung Ludwigshafen befindet sich eine Freilichtausstellung mit zahlreichen Skulpturen des Künstlers.
Eine wunderschöne kurze Wanderung bietet der Pfad durch den Gießbach-Tobel im Nordosten von Ludwigshafen. Als Tobel wird ein trichterförmiges Tal bezeichnet, das sich zu einem schluchtartigen Ausgang verengt. Der Schluchtweg, der sich durch den Tobel windet, beginnt an der Straße ‚An der Schnabelburg‘ und dauert ungefähr eine halbe Stunde. Allerdings wird festes Schuhwerk für diese Wanderung empfohlen, denn der geschwungene Waldweg ist schmal und unbefestigt.
Radrouten die durch Bodman-Ludwigshafen führen:
Sipplingen
dyllisch am nördlichen Steilufer des Überlinger Sees liegt die kleine Gemeinde Sipplingen. Mit seinen vielen Fachwerkbauten und den kleinen Gässchen besitzt das Dorf einen eher beschaulichen Charakter. Mit den ehemaligen Burgen Haldenberg, Hohenfels und Hüneberg stehen noch drei Ruinen auf den Hügeln nahe dem Ort.
Als Siedlungsgebiet wurde diese Gegend bereits in der Steinzeit genutzt. Durch archäologische Ausgrabungen konnten rund 20 einzelne Siedlungen nachgewiesen werden, die alle zwischen 3.000 und 6.000 Jahre alt sind. Die Ausgrabungsstätte ist eine der größten und besterhaltenen Pfahlbauansammlungen am Bodensee und gehört seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ein bedeutendes Fundstück ist ein aus Lindenbast geflochtener prähistorischer Schuh, der auf die Zeit um 2900 v. Chr. datiert wird. Eine Ausstellung in der Tourist-Information informiert über die einstigen Pfahlbausiedlungen auf dem heutigen Gemeindegebiet.
Sehenswertes:
Oberhalb der Gemeinde Sipplingen stehen auf einer Bergkuppe die Überreste der Burg Hohenfels, oftmals auch Ruine Alt-Hohenfels genannt. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts durch die Herren von Hohenfels, Ministeriale der Bischöfe von Konstanz, erbaut. Nachdem die Höhenburg 1641 während des Dreißigjährigen Krieges zerstört wurde, baute man sie nicht wieder auf. Die Burg zerfiel. Heute sind nur noch einige Mauerreste vom Wohnturm und der Ringmauer erhalten.
Im Naturschutzgebiet Sipplinger Dreieck befindet sich auch der Hüneberg. Auf der Höhe dieser Erhebung befinden sich im Wald verborgen die Reste einer alten Burganlage. Sie wurde vermutlich im 12. Jahrhundert durch die Herren von Hüneberg, Ministeriale des Klosters Reichenau, erbaut. Als das Adelsgeschlecht im 14. Jahrhundert ausstarb, verfiel vermutlich auch deren Burg. Von der ehemals stolzen Anlage sind noch rund 6 m hohe Mauerreste sowie Teile des ehemaligen Verteidigungsgrabens zu erkennen.
Mitten in dem von historischen Fachwerkhäusern geprägten Zentrum des Ortes Sipplingen steht die katholische Pfarrkirche St. Martin. Sie wurde im 15. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut und ist mit ihrem weißen Turm und dem spitzen Helm schon von weitem sichtbar. Die Einrichtung des hellen Innenraumes wurde später barock umgestaltet.
Das rund 15 ha große Naturschutzgebiet Sipplinger Dreieck liegt östlich des Kernortes und bietet mit den ‚Sieben Churfirsten‘ eine interessante geologische Besonderheit. Die Felsformation besteht aus sieben rund 5 – 7 m hohen säulenartigen Sandsteinblöcken. Sie besitzen jeweils einen härteren Stein als Haube, der den darunterliegenden Sandstein vor Erosion schützte und gleichzeitig an die Mütze eines Churfirsten erinnert.
Überlingen
m Fuße der Molassefelsen liegt am nördlichen Bodenseeufer die Große Kreisstadt Überlingen. Der nordwestliche Arm des Sees wurde nach der Stadt ‚Überlinger See‘ benannt. Das Hinterland wird von einer durch die letzte Eiszeit ausgebildeten wunderschönen hügligen Moränenlandschaft geprägt. Bereits 1180 wurde dem Ort durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa das Marktrecht verliehen. 1211 erhielt Überlingen auch die Stadtrechte zugesprochen. Vier Wachtürme und zwei alte Stadttore zeugen noch von der doppelten Befestigung im Mittelalter, die die Stadt vor angreifenden Feinden schützen sollte. Tatsächlich war Überlingen während des Dreißigjährigen Krieges heftig umkämpft. Heute geht es hier sehr viel friedlicher zu. Überlingen besitzt die längste Uferpromenade am Bodensee und einen schön gelegenen Mantelhafen. Personenschifffahrtsverbindungen führen von hier nach Meersburg, Ludwigshafen, Bodman, auf die Insel Mainau und zur Marienschlucht. Als Mitglied der Bewegung ‚Cittaslow‘ hat man sich der Entschleunigung zugunsten der Lebensqualität in den Städten verschrieben. Das Wahrzeichen der Stadt ist das weithin sichtbare Münster St. Nikolaus mit seinem imponierenden Schnitzaltar. Unbedingt sehenswert ist das Rathaus mit seinem prachtvoll ausgeschmückten Ratssaal, die Franziskanerkirche und die Sylvesterkapelle im Ortsteil Goldbach, die zu den ältesten erhaltenen Kirchenbauten im gesamten südwestdeutschen Raum zählt und wertvolle Freskenmalereien aus dem 9. und 10. Jahrhundert besitzt.
Sehenswertes:
 Schon von weitem ist der Nordturm des Münsters von Überlingen zu sehen. Das Gotteshaus wurde um 1350 im spätgotischen Stil erbaut und bis 1576 mehrfach zu einer fünfschiffigen Basilika ausgebaut, wobei das Ulmer Münster als Vorbild gedient haben soll. Das Münster sollte eigentlich einen symmetrischen Doppelturm erhalten, doch der Bau des Südturmes wurde nie vollendet. Später wurde der unfertigen Bauruine einfach ein Krüppelwalmdach aufgesetzt. Der Nordturm war im ausgehenden 15. Jahrhundert entstanden, 1576 wurde er gotisiert.
Schon von weitem ist der Nordturm des Münsters von Überlingen zu sehen. Das Gotteshaus wurde um 1350 im spätgotischen Stil erbaut und bis 1576 mehrfach zu einer fünfschiffigen Basilika ausgebaut, wobei das Ulmer Münster als Vorbild gedient haben soll. Das Münster sollte eigentlich einen symmetrischen Doppelturm erhalten, doch der Bau des Südturmes wurde nie vollendet. Später wurde der unfertigen Bauruine einfach ein Krüppelwalmdach aufgesetzt. Der Nordturm war im ausgehenden 15. Jahrhundert entstanden, 1576 wurde er gotisiert.
Das Innere des Gotteshauses ist gefüllt mit kostbaren Kunstschätzen. Das bedeutendste Kunstwerk ist der prächtige geschnitzte Hochaltar von 1616. Er stammt vom Holzschnitzer Jörg Zürn und gilt als Meisterwerk des deutschen Manierismus. Weitere 13 Altäre zieren die Seitenschiffe des Münsters. Besonders sehenswert sind der Marienaltar, ebenfalls von Jörg Zürn im Jahre 1610 geschaffen, der Rosenkranzaltar von David Zürn von 1631 sowie der Kinderfreund-Altar und der Herz-Jesu-Altar von Josef Eberle.
Die großen Holzfiguren von Jesus Christus sowie den zwölf Aposteln, die an den Pfeilern des Mittelschiffs stehen, stammen von 1552. Beachtenswert sind die Fresken in der südlichen Vorhalle (1563) und das große Fresko über dem Chorbogen (1722).
Die wertvolle Marienorgel wurde 1761 vom Orgelbaumeister Johann Philipp Seuffert erbaut. Das historische Musikinstrument ist allerdings nicht die Hauptorgel des Münsters und wurde erst 1975 aufgestellt, nachdem es an ihrem ursprünglichen Standort in Erlabrunn abgebaut worden war.
Neben dem Münster steht in der Altstadt Überlingens noch eine zweite große Kirche. Die Franziskanerkirche gehörte einst als Klosterkirche zum Franziskanerkonvent. Das Gotteshaus war 1348 erbaut und im 15. Jahrhundert noch einmal zu einer dreischiffigen Basilika erweitert worden. Wie für viele Franziskanerkirchen typisch, besitzt auch das Überlinger Gotteshaus keinen Kirchturm, sondern lediglich einen kleinen Dachreiter. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gestaltete man die ursprünglich gotische Kirche barock um. Nach der Säkularisierung im Jahre 1808 wurden die Klostergebäude zunächst noch von Kapuzinermönchen bewohnt, ehe danach eine sehr wechselvolle Geschichte begann. Der Komplex diente als Schule, Kaserne, Amtsgericht und als Krankenhaus. Ende des 19. Jahrhunderts schließlich wurde das ehemalige Kloster zum Seniorenheim ‚St. Franziskus‘ umgewandelt. In der Kirche finden heute wieder Gottesdienste statt. Sie wird aufgrund ihrer hervorragenden Akustik auch häufig für Konzerte genutzt.
Die Franziskanerkirche besitzt einen prächtigen barocken Hauptaltar und sechs Nebenaltäre. Wie auch die Kanzel, stammen alle Altäre von Franz Anton Dirr und wurden zwischen 1754 und 1766 erschaffen. Auch das prächtige Orgelprospekt stammt aus dieser Zeit. Das originale Instrument fiel jedoch inzwischen mehreren Umbauten vollständig zum Opfer. Von der ursprünglichen gotischen Ausstattung haben sich nur eine Statue Johannes des Täufers aus dem 14. Jhd. sowie ein großes Kruzifix aus der Zeit um 1350 erhalten.
Nachdem Überlingen im Jahre 1211 das Stadtrecht verliehen bekommen hat, wurde der Ort Mitte des 13. Jahrhunderts mit einer Stadtmauer befestigt. Der Mauerring umzog das Areal der heutigen Altstadt. Um 1450 begann man, eine zweite, äußere Stadtmauer zu errichten, die auch die Vorstadt vor feindlichen Übergriffen schützen sollte. Von den einst 15 Wehrtürmen bestehen heute noch vier: der um 1500 errichtete runde Gallerturm, der 1657 als Rondell errichtete dreistöckige Rosennobel, der um 1520 erbaute und später erhöhte St. Johann Turm sowie der Wagsauterturm, der allerdings erst 1958 rekonstruiert wurde.
Der innere Mauerring besaß einst drei Stadttore, von denen das 1494 errichtete Franziskanertor (vormals Barfüßertor) als einziges erhalten blieb. Vom äußeren Ring steht heute nur noch das Aufkircher Tor.
Das stolze Patrizierpalais gilt als das älteste Renaissancegebäude Deutschlands. Es wurde von Andreas Reichlin von Meldegg (um 1400 – 1477) im Stil der florentinischen Frührenaissance erbaut. Der Arzt und Apotheker hatte sich 1455 in Überlingen niedergelassen. Zuvor war er Leibarzt von Kaiser Friedrich III. sowie von Papst Pius II. gewesen.
In dem historischen Gebäude ist bereits seit 1913 das Städtische Museum untergebracht. Neben der originalen Möblierung des Hauses werden hier heimatkundliche Gegenstände aus dem Alltag und dem Brauchtum präsentiert, darunter auch Gemälde, Puppen und Krippen.
 Das historische Rathaus der Stadt Überlingen steht in unmittelbarer Nachbarschaft des Münsters in der Altstadt. Es entstand in zwei wesentlichen Bauphasen im 14. und 15. Jahrhundert und beherbergt noch heute die Stadtverwaltung. Die repräsentative und neuere Hauptfront des zweistöckigen Ratsgebäudes besteht aus Rorschacher Sandstein. Im Obergeschoss befindet sich der im spätgotischen Stil ausgeschmückte Ratssaal. Auffällig sind die Balken mit ihren reich geschnitzten Ornamenten und die edlen holzgetäfelten Wände. Der untere Eingangsbereich wird heute als Café genutzt. Rechts davon, leicht vorstehend und das Rathaus ein wenig überragend, steht der Pfennigturm. Dieser beherbergte einst die reichstädtische Münze. Das stolze denkmalgeschützte Gebäude erinnert ein wenig an einen italienischen Palazzo.
Das historische Rathaus der Stadt Überlingen steht in unmittelbarer Nachbarschaft des Münsters in der Altstadt. Es entstand in zwei wesentlichen Bauphasen im 14. und 15. Jahrhundert und beherbergt noch heute die Stadtverwaltung. Die repräsentative und neuere Hauptfront des zweistöckigen Ratsgebäudes besteht aus Rorschacher Sandstein. Im Obergeschoss befindet sich der im spätgotischen Stil ausgeschmückte Ratssaal. Auffällig sind die Balken mit ihren reich geschnitzten Ornamenten und die edlen holzgetäfelten Wände. Der untere Eingangsbereich wird heute als Café genutzt. Rechts davon, leicht vorstehend und das Rathaus ein wenig überragend, steht der Pfennigturm. Dieser beherbergte einst die reichstädtische Münze. Das stolze denkmalgeschützte Gebäude erinnert ein wenig an einen italienischen Palazzo.
Nicht weit entfernt am Münsterplatz steht die alte Stadtkanzlei. Das schmucke Gebäude wurde 1599 errichtet und gilt als eines der schönsten Renaissancebauwerke der Bodenseeregion. Heute beherbergt die Kanzlei das Stadtarchiv.
 Direkt am Ufer des Überlinger Sees steht das frühklassizistische Gebäude der Greth. Es wurde 1788 umgebaut und besitzt noch Stilelemente aus dem Spätbarock. Tatsächlich ist das Kerngebäude jedoch wesentlich älter. Die Eichenpfähle, die als tragendes Fundament für das Handels- und Kornhaus in die feuchte Uferböschung geschlagen wurden, stammen noch aus dem späten 14. Jahrhundert. Vermutlich gab es sogar noch einen wesentlich älteren Vorgängerbau. Das im Volksmund nur ‚die Greht‘ genannte ehemalige Handels- und Kornhaus steht seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter Denkmalschutz.
Direkt am Ufer des Überlinger Sees steht das frühklassizistische Gebäude der Greth. Es wurde 1788 umgebaut und besitzt noch Stilelemente aus dem Spätbarock. Tatsächlich ist das Kerngebäude jedoch wesentlich älter. Die Eichenpfähle, die als tragendes Fundament für das Handels- und Kornhaus in die feuchte Uferböschung geschlagen wurden, stammen noch aus dem späten 14. Jahrhundert. Vermutlich gab es sogar noch einen wesentlich älteren Vorgängerbau. Das im Volksmund nur ‚die Greht‘ genannte ehemalige Handels- und Kornhaus steht seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter Denkmalschutz.
Obwohl der Namen diesen Eindruck erweckt, war die Gunzoburg nie eine wehrhafte Wehranlage – wohl aber ein großes und edles Patrizierhaus. Das Gebäude stammt wohl aus dem 13. oder 14. Jahrhundert, obwohl eine Inschrift besagt, dass 641 in diesem Gebäude Gunzo, der Herzog von Schwaben und Alemannien residiert haben soll. Allerdings hat es den Ort Überlingen zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht gegeben…
Heute befindet sich in dem historischen Gebäude eine Galerie.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand auf einem kleinen Hügel östlich von Überlingen eine schmucke, neobarocke Villa, die der Bauherr Rittmeister Otto Ziesig großzügig ‚Schloss Rauenstein‘ taufte. Das zweistöckige Gebäude mit den beiden Eckrisaliten besitzt auf seinem Mitteldach einen markanten Spitzaufsatz. Die Villa dient heute als Hochschule sowie der Industrie- und Handelskammer.
In dem 2,7 ha großen öffentlich zugänglichen Schlosspark wurde ein Apfellehrpfad angelegt, der die verschiedenen am Bodensee kultivierten Apfelsorten vorstellt.
 Bereits im frühen 13. Jahrhundert hatte das Zisterzienserkloster Salem in Überlingen ein Pflegehof betrieben. Im 16. Jahrhundert dehnte die Abtei ihre Besitzungen in der Stadt aus und erwarb zwei weitere Höfe, die um 1530 zum neuen Stadthof der Reichsabtei umgebaut wurden. Hier wurde bis zur Säkularisierung im Jahre 1803 der Pflegehof weiterbetrieben. In welchem Umfang die alte Bausubstanz in das neue Gebäude übernommen wurde, ist allerdings nicht geklärt. Der spätgotische zweiteilige Häuserkomplex mit den markanten Treppengiebeln und den Spitzbogenfenstern diente sogar als Herberge für Kaiser Ferdinand I., als dieser 1563 die Reichsstadt Überlingen besuchte. Die Zinnen auf dem Verbindungs-Torbau dienten übrigens nicht der Verteidigung, sie hatten nur herrschaftssymbolische Bedeutung. Nach der Auflösung des Pflegehofes diente der Salmansweiler Hof zunächst als Brauhaus und Gaststätte, heute beherbergt er mehrere Wohnungen und ein Ladenlokal.
Bereits im frühen 13. Jahrhundert hatte das Zisterzienserkloster Salem in Überlingen ein Pflegehof betrieben. Im 16. Jahrhundert dehnte die Abtei ihre Besitzungen in der Stadt aus und erwarb zwei weitere Höfe, die um 1530 zum neuen Stadthof der Reichsabtei umgebaut wurden. Hier wurde bis zur Säkularisierung im Jahre 1803 der Pflegehof weiterbetrieben. In welchem Umfang die alte Bausubstanz in das neue Gebäude übernommen wurde, ist allerdings nicht geklärt. Der spätgotische zweiteilige Häuserkomplex mit den markanten Treppengiebeln und den Spitzbogenfenstern diente sogar als Herberge für Kaiser Ferdinand I., als dieser 1563 die Reichsstadt Überlingen besuchte. Die Zinnen auf dem Verbindungs-Torbau dienten übrigens nicht der Verteidigung, sie hatten nur herrschaftssymbolische Bedeutung. Nach der Auflösung des Pflegehofes diente der Salmansweiler Hof zunächst als Brauhaus und Gaststätte, heute beherbergt er mehrere Wohnungen und ein Ladenlokal.
 Direkt am Ufer des Überlinger Sees steht in Goldbach die kleine romanische Sylvesterkapelle. Sie ist berühmt für ihre außergewöhnlichen Wandmalereien. Die ältesten dieser Fresken entstanden in der Karolingerzeit Mitte des 9. Jahrhunderts. Mönche aus dem Kloster Reichenau schufen diese Wandbilder, die als die ältesten im gesamten Bodenseeraum gelten. Ein weiterer Bilderzyklus entstand in Ottonischer Zeit im frühen 10. Jahrhundert. Die schlichte Kapelle selber wurde um 840 errichtet und diente zunächst auch als Pfarrkirche. Mehrfach wurden die Wandbilder übermalt, so dass die wahre Bedeutung der Kirchenausschmückung erst bei der Freilegung um 1900 deutlich wurde. Leider haben die wertvollen Gemälde stark gelitten, einige Bilder gingen sogar vollständig verloren.
Direkt am Ufer des Überlinger Sees steht in Goldbach die kleine romanische Sylvesterkapelle. Sie ist berühmt für ihre außergewöhnlichen Wandmalereien. Die ältesten dieser Fresken entstanden in der Karolingerzeit Mitte des 9. Jahrhunderts. Mönche aus dem Kloster Reichenau schufen diese Wandbilder, die als die ältesten im gesamten Bodenseeraum gelten. Ein weiterer Bilderzyklus entstand in Ottonischer Zeit im frühen 10. Jahrhundert. Die schlichte Kapelle selber wurde um 840 errichtet und diente zunächst auch als Pfarrkirche. Mehrfach wurden die Wandbilder übermalt, so dass die wahre Bedeutung der Kirchenausschmückung erst bei der Freilegung um 1900 deutlich wurde. Leider haben die wertvollen Gemälde stark gelitten, einige Bilder gingen sogar vollständig verloren.
Die Michaelskirche im Überlinger Stadtteil Aufkirch war die ursprüngliche Pfarrkirche der Stadt. Die Saalkirche steht auf einer Anhöhe oberhalb des Kernortes. Teile des Gotteshauses stammen noch aus der Zeit um 1000. Mitte des 14. Jahrhundert wechselten die Pfarrrechte an das Münster in Überlingen und die Kirche wurde durch den Deutschen Orden auf der Insel Mainau weiter betreut. In dieser Zeit war auch der Chor entstanden. Der markante Turm mit dem spätgotischen Staffelgiebel stürzte 1950 ein, wurde bald darauf aber wieder aufgebaut.
Die Ursprünge der Rautermühle in Bambergen gehen bis in das 13. Jahrhundert zurück. Schon 1280 wurde die Wassermühle erstmals in einer alten Urkunde erwähnt. Über lange Jahrhunderte diente sie als Getreide- und Ölmühle. Anfang des letzten Jahrhunderts wurde die Mühle in einen landwirtschaftlichen Betrieb integriert, der auch heute noch die wirtschaftliche Grundlage für die Einrichtung bildet. 1994 eröffnete auf dem weitläufigen Gelände der Tierpark. Auf einem Rundweg werden in zahlreichen Freigehegen rund 180 verschiedene Tierarten gehalten. Man ist stolz auf den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als größte Sammlung aussterbender Tierrassen. So tummeln sich auf dem Gelände allerlei Nutztiere, wie Pferde, Schweine, Kühe, Schafe, Ziegen und Hühner, aber auch fremdländische Tierarten, wie Kamele, Nasenbären, Otter oder die lustigen Erdmännchen.
Auf der Musikantenbühne finden in den Sommermonaten regelmäßig Konzerte, vorwiegend mit volkstümlichen Musikern, statt.
Heinrich Seuse (1295 – 1366), genannt Suso, war ein Theologe, Dichter und Mystiker. Er entstammte einem Thurgauer Adelsgeschlecht und wirkte vor allem in Konstanz, am Oberrhein, in Ulm und in der Schweiz. Bereits 13jährig trat er dem Dominikanerorden in Konstanz bei. Seine Texte widmen sich den Inhalten von ‚Mystik‘, ‚Askese‘ und ‚Leiden‘ und gehören zu den wichtigsten mittelalterlichen Beiträgen zu diesen Themen. In der katholischen Kirche wird er als Seliger verehrt.
Das Suso-Haus in Überlingen gilt als Geburtsort des Mystikers. Nachdem es lange Zeit leer stand, wurde es nach einer umfangreichen Renovierung im Jahre 2010 als Haus der Literatur und Spiritualität eröffnet. Es soll als Ort der Erinnerung an die Lehre Susos vom menschlichen Weg dienen und den Besucher zum kreativ-schöpferischen Tun inspirieren. In dem mittelalterlichen Gebäude finden Führungen, Vorträge, Workshops und Meditationen statt.
 Mit dem Stadtgarten besitzt Überlingen eine sehenswerte botanische Gartenanlage. Bedingt durch die günstigen klimatischen Bedingungen konnten hier eine Vielzahl exotischer Pflanzen kultiviert werden. Hier wachsen bis zu 6 m hohe Kakteen, Bananenstauden, der Riesen-Lebensbaum, Magnolien und Fuchsien. 1939 wurde der Rosengarten im französischen Stil angelegt.
Mit dem Stadtgarten besitzt Überlingen eine sehenswerte botanische Gartenanlage. Bedingt durch die günstigen klimatischen Bedingungen konnten hier eine Vielzahl exotischer Pflanzen kultiviert werden. Hier wachsen bis zu 6 m hohe Kakteen, Bananenstauden, der Riesen-Lebensbaum, Magnolien und Fuchsien. 1939 wurde der Rosengarten im französischen Stil angelegt.
Der Stadtgarten mit seinen Blumenrabatten, seinem Teich und seinem Springbrunnen verbreitet schon fast ein mediterranes Flair. Im oberen Teil des Parks befindet sich ein Aussichtspavillon und ein Rehgehege.
Uhldingen-Mühlhofen
er staatlich anerkannte Erholungsort am Bodensee wurde bereits in der Steinzeit und in der Bronzezeit besiedelt. Die archäologische Ausgrabungsstätte der Pfahlbausiedlungen gehört zum UNESO-Weltkulturerbe. Das beliebte Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen hat die im See stehenden Holzhäuser rekonstruiert und bietet so einen interessanten Einblick, wie das Leben der Menschen in prähistorischer Zeit ausgesehen haben muss. Münzfunde sprechen dafür, dass die Gegend auch zur Zeit der römischen Besatzung besiedelt war. Hoch über dem Bodensee thront die Wallfahrtskirche Birnau. Ein Besuch des barocken Juwels mit der prachtvollen Rokoko-Inneneinrichtung gehört zum Pflichtprogramm. Von der Terrasse hat man einen einzigartigen Blick über den Bodensee bis in die Schweizer Alpen.
Sehenswertes:
 Nördlich der Alpen fand man bei archäologischen Ausgrabungen Pfahlbausiedlungen, die in der Steinzeit bzw. der Bronzezeit angelegt wurden. Sie werden auf den Zeitraum zwischen 5.000 und 500 v.Chr. datiert. Diese Pfahlbauten sind in dieser Region ein verbreitetes Phänomen und in allen sechs Alpenländern vorzufinden. In den Seen und Mooren sind die Überreste dieser Pfahlbaukultur durch den Sauerstoffabschluss teilweise erstaunlich gut erhalten. So wurden insgesamt 111 Grabungsstätten im Jahre 2011 unter den Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes gestellt. 18 Fundstellen befinden sich davon in Deutschland. Einige der bedeutendsten Grabungsstätten befinden sich am Bodensee. Bei Gaienhofen auf der Halbinsel Höri fand man den ältesten Hausgrundriss Europas, der aufgrund einer dendrochronologischen Untersuchung auf das Baujahr 3915 v. Chr. datiert wurde.
Nördlich der Alpen fand man bei archäologischen Ausgrabungen Pfahlbausiedlungen, die in der Steinzeit bzw. der Bronzezeit angelegt wurden. Sie werden auf den Zeitraum zwischen 5.000 und 500 v.Chr. datiert. Diese Pfahlbauten sind in dieser Region ein verbreitetes Phänomen und in allen sechs Alpenländern vorzufinden. In den Seen und Mooren sind die Überreste dieser Pfahlbaukultur durch den Sauerstoffabschluss teilweise erstaunlich gut erhalten. So wurden insgesamt 111 Grabungsstätten im Jahre 2011 unter den Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes gestellt. 18 Fundstellen befinden sich davon in Deutschland. Einige der bedeutendsten Grabungsstätten befinden sich am Bodensee. Bei Gaienhofen auf der Halbinsel Höri fand man den ältesten Hausgrundriss Europas, der aufgrund einer dendrochronologischen Untersuchung auf das Baujahr 3915 v. Chr. datiert wurde.
Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen liegt in unmittelbarer Nähe einer dieser Ausgrabungsstätten. Die begehbaren Rekonstruktionen von Holzbauten aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit bieten die Möglichkeit, sich ein Bild davon zu machen, wie das Leben der sesshaft werdenden Menschen damals ausgesehen hat. Täuschend echt wirkende Figuren beleben die Szenerie, die der Besucher auf seinem Gang über die langen Holzstege entdecken kann. Bei den Führungen wird ein höchst informatives Gesamtbild des Lebens und der Arbeit in der Frühgeschichte vermittelt. Das Museum zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen am Bodensee.
 Umgeben von Weinbergen und Streuobstwiesen steht erhöht am Hang weithin sichtbar die Wallfahrtskirche Birnau. Die zwischen 1746 und 1749 für das Kloster Salem erbaute barocke Kirche ist berühmt für ihre prächtige Rokoko-Innenausstattung. Der Chor wurde nach Norden ausgerichtet, und somit ergibt sich von der Terrasse vor dem Haupteingang ein atemberaubender Ausblick über den Bodensee und die Insel Mainau bis in die Schweizer Alpen.
Umgeben von Weinbergen und Streuobstwiesen steht erhöht am Hang weithin sichtbar die Wallfahrtskirche Birnau. Die zwischen 1746 und 1749 für das Kloster Salem erbaute barocke Kirche ist berühmt für ihre prächtige Rokoko-Innenausstattung. Der Chor wurde nach Norden ausgerichtet, und somit ergibt sich von der Terrasse vor dem Haupteingang ein atemberaubender Ausblick über den Bodensee und die Insel Mainau bis in die Schweizer Alpen.
Eine erste Marienkapelle ‚Alt-Birnau‘ hatte es bereits im 13. Jahrhundert bei Nußdorf gegeben. Doch Streitigkeiten führten zu einer Verlegung und dem imposanten Neubau an der heutigen Stelle. Das wertvolle und prunkvolle Interieur mit den üppigen Stuckaturen, den aufwendigen Altären und den Skulpturen stammt überwiegend von Joseph Anton Feuchtmayer, die Fresken wurden von Gottfried Bernhard Göz geschaffen. Die bekannteste Figur der Kirche ist der ‚Honigschlecker‘, ein reizender Putto, der sich genüsslich an einem Bienenkorb labt. Er bezieht sich auf den Ordensvater der Zisterzienser, Bernhard von Clairveaux, dem die Worte wie Honig von den Lippen geflossen sein sollen. Beeindruckend sind auch der Altar der vierzehn Nothelfer in der Seitenkapelle sowie die reich verzierte barocke Kanzel. Die Birnau, wie die Marienwallfahrtskirche im Volksmund genannt wird, ist seit 1946 Pfarrkirche der Orte Deisendorf und Nußdorf. 1971 erhob sie Papst Paul VI. zur Basilika minor.
 Unterhalb der Basilika Birnau, direkt am Ufer des Bodensees, steht das barocke Schloss Maurach. Der Begriff ‚Schloss‘ ist allerdings nicht ganz zutreffend, denn das Gut diente nie als Adelssitz, sondern als Wirtschaftsgebäude und Sommersitz der Mönche des Kloster Salem. Erstmals schriftlich erwähnt wurde der Gutshof schon 1155. Der Ausbau zu der heutigen repräsentativen Anlage erfolgte erst ab 1722. Neben den Nutzgebäuden gab es hier Wohnungen für die Mönche und die Bediensteten, eine Kapelle und einen Garten. Heute wird das Anwesen für Tagungen und schulische Veranstaltungen genutzt.
Unterhalb der Basilika Birnau, direkt am Ufer des Bodensees, steht das barocke Schloss Maurach. Der Begriff ‚Schloss‘ ist allerdings nicht ganz zutreffend, denn das Gut diente nie als Adelssitz, sondern als Wirtschaftsgebäude und Sommersitz der Mönche des Kloster Salem. Erstmals schriftlich erwähnt wurde der Gutshof schon 1155. Der Ausbau zu der heutigen repräsentativen Anlage erfolgte erst ab 1722. Neben den Nutzgebäuden gab es hier Wohnungen für die Mönche und die Bediensteten, eine Kapelle und einen Garten. Heute wird das Anwesen für Tagungen und schulische Veranstaltungen genutzt.
Einen spannenden und lebensnahen Einblick in die Lebenswelt der Schlangen, Echsen und Spinnen verspricht ein Besuch im Reptilienhaus Unteruhldingen. Hier kann man eine Grüne Mamba, eine Klapperschlange, eine Python, Leguane und Warane in ihrer natürlichen artgerechten Umgebung beobachten, denn bei der Präsentation der exotischen Tiere in den Terrarien wird besonderer Wert auf den natürlichen Lebensraum gelegt.
Nach einer alten Überlieferung hielt der hl. Gallus im Jahre 613 in Seefelden einen Gottesdienst, in dem er ein vom Teufel besessenes Mädchen heilte. Nachweisbar ist diese Geschichte allerdings nicht. Auch die Vermutungen, die Kirche hätte einmal zu einer Burg gehört, und im Kirchturm hätte es einmal eine Kapelle gegeben, lassen sich nicht wirklich belegen.
Auch lässt sich ein genaues Baudatum der katholischen Pfarrkirche nicht nachweisen. Sicher ist nur, dass sie zu den ältesten Kirchen der Region zählt. Das heutige Langhaus entstand wohl im 15. Jahrhundert, aber es gab zumindest einen, möglicherweise auch mehrere Vorgängerbauten. Der Kirchturm, auch so viel ist gesichert, ist im unteren und mittleren Teil um einiges älter als der Kirchensaal und gehörte damit mit Sicherheit zu einem älteren und inzwischen abgetragenen Gotteshaus.
Die kleine Kapelle mit dem Zwiebeltürmchen prägt das Ortsbild von Oberuhldingen. Sie wurde im 16. Jahrhundert erbaut und 1711 im barocken Stil umgestaltet. Seitdem wurde das dem hl. Wolfgang von Regensburg geweihte Gotteshaus baulich kaum mehr verändert.
Im Zentrum von Unteruhldingen steht an einem kleinen Verkehrskreisel die kleine St. Quiriniuskapelle. Sie wurde 1505 im spätgotischen Stil erbaut und besitzt einen turmartigen Dachreiter mit hohem spitzem Helm. Der Altar zeigt seitlich zwei Märtyrerinnen der Frühchristenheit und symbolisiert oben die Dreifaltigkeit.
Auf einer riesigen Fläche von rund 10.000 m² eröffnete 2013 das Traktormuseum in Gebhardsweiler. Mit über 150 verschiedenen Traktoren erzählt es in verschiedenen Eventsälen die Geschichte der Motorisierung in der Landwirtschaft. Dabei wurden die ältesten Ausstellungsstücke in der Zeit um 1900 erbaut. Die Zugmaschinen stehen in verschiedenen dörflich typischen Installationen, um den jeweiligen zeitlichen Bezug zu verdeutlichen.
Meersburg
as kleine Städtchen Meersburg lädt zu einem Besuch in der Vergangenheit ein. Malerisch am Hang und am Ufer des Bodensees gelegen, mit engen Gassen, hübschen Winkeln und zwei beeindruckenden Schlossanlagen, verbreitet die Stadt ein mittelalterliches Flair. Meersburg teilt sich in eine Unterstadt, die direkt am Bodensee liegt und eine darüber liegende Oberstadt. Am höchsten Punkt der Oberstadt steht die katholische Stadtkirche, deren Kirchturm einst auch als Wachturm diente.
Die Meersburg mit ihrer markanten Silhouette ist das Wahrzeichen der gesamten Bodensee-Region. Die alte Wehrburg gehörte lange den Fürstbischöfen von Konstanz und diente eine Zeit lang auch als deren Residenz, bevor das benachbarte ‚Neue Schloss‘ als Residenzschloss eingerichtet wurde. Beide Bauwerke sind der Öffentlichkeit als Museum zugänglich. Darüber hinaus besitzt Meersburg eine sehr vielfältige Museumslandschaft mit mehreren verschiedenen Kunstausstellungen, dem Zeppelinmuseum, dem Stadtmuseum und der Bibelgalerie. Und nach dem Kulturgenuss lädt die Promenade am Bodensee mit seinen Cafés und Restaurants zum Verweilen ein.
Sehenswertes:
 Wann die Burg Meersburg entstand, ist nicht vollständig geklärt. Es wird vermutet, dass der Burgfried, der Dagobertturm, bereits im Jahre 630 durch den Merowingerkönig Dagobert I. erbaut wurde. Damit wäre das Gemäuer die älteste bewohnte Burg Deutschlands. Doch gesichert ist diese Annahme nicht. Das Wahrzeichen der gesamten Region wurde erstmals im Jahre 988 in einer Urkunde Kaiser Ottos III. erwähnt. Die Ähnlichkeiten im Aufbau der Burg legen die Vermutung nahe, dass sie in der heutigen Form im 12. oder frühen 13. Jahrhundert entstand. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts befand sich das Kastell im Besitz der Fürstbischöfe von Konstanz. Mehrere Male wurde die Wehranlage belagert, aber nie zerstört. Im 16. Jahrhundert wurde die Höhenburg eine Zeitlang auch als Hauptwohnsitz der Fürstbischöfe genutzt. Der Staffelgiebel am Turm zeugt noch als bauliche Veränderung von dieser Zeit. Nachdem das Neue Schloss als Residenz fertig gestellt worden war, diente die Alte Burg nur noch der fürstbischöflichen Verwaltung und fiel im Zuge der Säkularisierung an das Land Baden. Zwischenzeitlich diente die Burg nun als Amtsgericht, ehe es 1838 in Privatbesitz gelangte. Ab 1841 verbrachte die berühmte westfälische Dichterin Annette von Droste-Hülshoff viel Zeit auf der Burg bei ihrer Schwester Jenny und ihrem Schwager. 1848 verstarb sie auf der Burg.
Wann die Burg Meersburg entstand, ist nicht vollständig geklärt. Es wird vermutet, dass der Burgfried, der Dagobertturm, bereits im Jahre 630 durch den Merowingerkönig Dagobert I. erbaut wurde. Damit wäre das Gemäuer die älteste bewohnte Burg Deutschlands. Doch gesichert ist diese Annahme nicht. Das Wahrzeichen der gesamten Region wurde erstmals im Jahre 988 in einer Urkunde Kaiser Ottos III. erwähnt. Die Ähnlichkeiten im Aufbau der Burg legen die Vermutung nahe, dass sie in der heutigen Form im 12. oder frühen 13. Jahrhundert entstand. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts befand sich das Kastell im Besitz der Fürstbischöfe von Konstanz. Mehrere Male wurde die Wehranlage belagert, aber nie zerstört. Im 16. Jahrhundert wurde die Höhenburg eine Zeitlang auch als Hauptwohnsitz der Fürstbischöfe genutzt. Der Staffelgiebel am Turm zeugt noch als bauliche Veränderung von dieser Zeit. Nachdem das Neue Schloss als Residenz fertig gestellt worden war, diente die Alte Burg nur noch der fürstbischöflichen Verwaltung und fiel im Zuge der Säkularisierung an das Land Baden. Zwischenzeitlich diente die Burg nun als Amtsgericht, ehe es 1838 in Privatbesitz gelangte. Ab 1841 verbrachte die berühmte westfälische Dichterin Annette von Droste-Hülshoff viel Zeit auf der Burg bei ihrer Schwester Jenny und ihrem Schwager. 1848 verstarb sie auf der Burg.
Heute dient Burg Meersburg als Museum, aber immer noch auch als private Wohnstätte. Der Besucherrundgang führt durch 30 eingerichtete Räume, darunter der Palas, der Rittersaal, die Waffenhalle, das Burgverlies, die Folterkammer, zwei Kapellen und das Sterbezimmer der Annette von Droste-Hülshoff. Buchstäblicher Höhepunkt der Führung ist die Besteigung des Dagobertturms, der einen großartigen Blick über die Stadt und den Bodensee ermöglicht.
 Stolz thront in der Stadt Meersburg das Neue Schloss an einem Hang über dem Bodensee. Es wurde zwischen 1710 und 1712 als Ersatz für die Alte Burg erbaut, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Zur Seeseite besitzt das Prunkgebäude eine barocke Fassade mit einer vorgelagerten Gartenterrasse. Die Hauptfront zum Schlossplatz wurde im Stil des Rokoko gestaltet.
Stolz thront in der Stadt Meersburg das Neue Schloss an einem Hang über dem Bodensee. Es wurde zwischen 1710 und 1712 als Ersatz für die Alte Burg erbaut, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Zur Seeseite besitzt das Prunkgebäude eine barocke Fassade mit einer vorgelagerten Gartenterrasse. Die Hauptfront zum Schlossplatz wurde im Stil des Rokoko gestaltet.
Zunächst wurde das ausladende Bauwerk nur als Kanzleigebäude genutzt. Erst ab 1750 diente das Neue Schloss als Residenz der Fürstbischöfe von Konstanz. Kurz zuvor war es noch einmal repräsentativ ausgebaut worden und erhielt dabei auch eine Schlosskapelle. Doch bereits 50 Jahre später fiel das Neue Schloss im Zuge der Säkularisierung an das Land Baden. Lange diente es danach als Schule und seit 1962 als öffentliches Museum.
 Am Schlossplatz vor dem Neuen Schloss steht die Hauptwache. Der Name ist jedoch nicht wirklich korrekt, denn als fürstbischöfliche Schlosswache hatte nur der Vorgängerbau gedient. Dieser war 1763 von Franz Anton Bagnato erbaut worden. Nachdem die Stadt 1828 das Gebäude übernommen hatte, wurde es abgerissen und durch den heutigen vergrößerten klassizistischen Neubau ersetzt. Die vier Säulen erhielt die Hauptwache erst nach 1841. Seitdem wurde der Bau als Feuerwehrhaus, als Gefängnis sowie als Unterkunft für die Meersburger Sanitätskolonne und städtische Ämter genutzt – nicht mehr aber als Schlosswache!
Am Schlossplatz vor dem Neuen Schloss steht die Hauptwache. Der Name ist jedoch nicht wirklich korrekt, denn als fürstbischöfliche Schlosswache hatte nur der Vorgängerbau gedient. Dieser war 1763 von Franz Anton Bagnato erbaut worden. Nachdem die Stadt 1828 das Gebäude übernommen hatte, wurde es abgerissen und durch den heutigen vergrößerten klassizistischen Neubau ersetzt. Die vier Säulen erhielt die Hauptwache erst nach 1841. Seitdem wurde der Bau als Feuerwehrhaus, als Gefängnis sowie als Unterkunft für die Meersburger Sanitätskolonne und städtische Ämter genutzt – nicht mehr aber als Schlosswache!
 Im Jahre 1551 erhielt die Stadt Meersburg ein eigenes Rathaus, das 1582 um seinen Ratssaal erweitert wurde. Das Gebäude wurde in der Folgezeit noch mehrfach umgebaut. 1740 erhöhte man das Ratsgebäude um ein Stockwerk. Zeitgleich wurde der Ratssaal im barocken Stil umgebaut. 1784 richtete man im oberen Stockwerk einen Theatersaal ein, der noch bis in das 20. Jahrhundert hinein genutzt wurde. Im ehemaligen Weinkeller wurde 1936 der Ratskeller eingerichtet.
Im Jahre 1551 erhielt die Stadt Meersburg ein eigenes Rathaus, das 1582 um seinen Ratssaal erweitert wurde. Das Gebäude wurde in der Folgezeit noch mehrfach umgebaut. 1740 erhöhte man das Ratsgebäude um ein Stockwerk. Zeitgleich wurde der Ratssaal im barocken Stil umgebaut. 1784 richtete man im oberen Stockwerk einen Theatersaal ein, der noch bis in das 20. Jahrhundert hinein genutzt wurde. Im ehemaligen Weinkeller wurde 1936 der Ratskeller eingerichtet.
Die Parkanlage verbindet die Unterstadt Meersburg an der Unterstadtstraße mit der alten Burg in der Oberstadt. Hier hatte einst die Oedinmühle gestanden, ehe sie 1902 abgebrannt war. Ein Nachbau erinnert an die mittelalterliche Wassermühle. Am Aufgang wurden terrassenartig Beete angelegt, auf denen sich im Sommer eine wahre Blütenpracht entfaltet. Der ausgebaute Platz an der Basis unterhalb der Burg dient häufig als Veranstaltungsort für Freiluftkonzerte.
Als die Stadt Meersburg um 1300 nach Norden erweitert wurde, wurde auch die Stadtmauer mit ihren Wachtürmen in diesem Bereich neu aufgebaut. Zu dieser Zeit entstand auch das Obertor. Der fünfstöckige rot getünchte Torturm wurde 1902 letztmalig überarbeitet und erneuert. Schon 1477 war an dem Stadttor eine Uhr angebracht worden – ein selbstbewusstes sichtbares Zeichen des städtischen Bürgertums gegenüber der Kirche, wer die Tageseinteilung zu bestimmen hat…
 Von Westen kommend, markiert das Unterstadttor den Eingang in die wunderschöne Altstadt von Meersburg. Das Tor, das in alten Quellen auch ‚Niedertor‘ oder ‚Kugelwehrtor‘ genannt wurde, ist das älteste erhaltene Stadttor und stammt vermutlich aus der Zeit um 1250, als die erste Stadtmauer um Meersburg entstand. Im Jahre 1233 war Meersburg das Markrecht erteilt worden, 1299 erhielt der Ort auch das Stadtrecht. Das Unterstadttor verblieb seit seiner Erbauung bis heute weitgehend unverändert.
Von Westen kommend, markiert das Unterstadttor den Eingang in die wunderschöne Altstadt von Meersburg. Das Tor, das in alten Quellen auch ‚Niedertor‘ oder ‚Kugelwehrtor‘ genannt wurde, ist das älteste erhaltene Stadttor und stammt vermutlich aus der Zeit um 1250, als die erste Stadtmauer um Meersburg entstand. Im Jahre 1233 war Meersburg das Markrecht erteilt worden, 1299 erhielt der Ort auch das Stadtrecht. Das Unterstadttor verblieb seit seiner Erbauung bis heute weitgehend unverändert.
Das Kirchenschiff der Stadtpfarrkirche gehört noch zu den jüngeren Gebäuden in Meersburg. Zwischen 1829 und 1833 entstand das Gotteshaus als Nachfolgebau einer zuvor abgebrochenen Kirche. Der Kirchenturm dieser älteren Kirche war im Mittelalter als Wehrturm in die Stadtmauer integriert. Er stammt vermutlich aus dem 13. Jahrhundert und wurde für den Bau der neuen Pfarrkirche übernommen.
Der lichtdurchflutete Innenraum wirkt eher schlicht. Der Hochaltar besteht mittig aus einem spätgotischer Schrein aus dem 15. Jahrhundert, die neugotischen Seitenaltäre entstanden 1899. Erwähnenswert sind noch das Gemälde ‚Flucht nach Ägypten‘ aus dem 17. Jahrhundert an der Nordwand sowie die beiden barocken Büsten des hl. Petrus und des hl. Paulus von 1749.
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts entstand die gotische Unterstadtkapelle. Im Jahre 1535 wurde der Chor ergänzt. Im Inneren fallen zwei Seitenaltäre auf: der spätgotische Verkündigungsaltar (um 1500) auf der linken und der Renaissance-Altar auf der rechten Seite. Seit 1849 befindet sich die Kapelle im städtischen Besitz.
 Das spätmittelalterliche Gredhaus wurde zwischen 1505 und 1509 erbaut und diente Jahrhunderte lang als Kauf- und Lagerhaus für Waren aller Art. Durch die Nutzung eines zentralen Warenumschlagplatzes konnte die Obrigkeit eine bessere Kontrolle ausüben und die Steuern leichter eintreiben. Mitte des 19. Jahrhundert entstand direkt vor dem historischen Gebäude der neue Hafen, damit die Dampfschiffe besser anlegen und die Ladungen schneller ins Warenhaus transportiert werden konnten.
Das spätmittelalterliche Gredhaus wurde zwischen 1505 und 1509 erbaut und diente Jahrhunderte lang als Kauf- und Lagerhaus für Waren aller Art. Durch die Nutzung eines zentralen Warenumschlagplatzes konnte die Obrigkeit eine bessere Kontrolle ausüben und die Steuern leichter eintreiben. Mitte des 19. Jahrhundert entstand direkt vor dem historischen Gebäude der neue Hafen, damit die Dampfschiffe besser anlegen und die Ladungen schneller ins Warenhaus transportiert werden konnten.
Die Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff (1797 – 1848) entstammt aus dem altwestfälischen Adel und wurde auf Schloss Hülshoff bei Münster geboren. Sie zählt zu den bedeutendsten deutschen Dichterinnen. Zu ihren berühmtesten Werken zählt der Gedichtband ‚Das geistige Jahr‘, die Novelle ‚Die Judenbuche‘ sowie die Ballade ‚Der Knabe im Moor‘.
Obwohl sie ihr Zuhause im Rüschhaus bei Münster sah, lebte sie doch seit 1841 zum großen Teil bei ihrem Schwager in Meersburg. 1843 ersteigerte sie das Fürstenhäusle in den Weinbergen am Stadtrand von Meersburg. Das Gebäude war einst als Lustschloss vom späteren Fürstbischofs Jacob Fugger von Kirchberg und Weissenbronn (1567 – 1626) erbaut worden und war lange im Besitz der Fürstbischöfe von Konstanz.
Seit 1924 ist das Fürstenhäusle in Erinnerung an ‚die Droste‘ als Museum und Gedenkstätte eingerichtet. Neben zahlreichen persönlichen Gegenständen, Bildern, Bücher und Möbeln aus dem persönlichen Besitz der Annette von Droste-Hülshoff werden auch einige originale Handschriften gezeigt.
Die nördliche Bodenseeregion ist untrennbar mit den Luftschiffen des Grafen Zeppelin verbunden. Neben dem großen Zeppelin-Museum in Friedrichshafen besitzt auch Meersburg ein Museum, das sich mit der Geschichte der Luftschifffahrt beschäftigt. Die umfangreiche private Sammlung präsentiert eine Vielzahl von historischen Gegenständen aus den Anfängen des Luftschiffbaus bis zum verhängnisvollen Unfall der LZ-129 ‚Hindenburg‘ in Lakehurst, der die deutsche Verkehrsluftschifffahrt 1937 abrupt beendete.
Das Barockpalais am Meersburger Schlossplatz wurde 1625 durch den Bürgermeister Matthias Rassler (1589 – 1646) erbaut. Seit dem 18. Jahrhunderts diente das rote getünchte Gebäude als Dienstwohnung bischöflicher und später badischer Beamter. 1884 wurde in diesem Haus Karl Moll geboren, der später ebenfalls Bürgermeister von Meersburg wurde. Heute beherbergt das Rote Haus die Galerie Bodenseekreis, die sich der modernen und zeitgenössischen Kunst verschrieben hat und in den historischen Räumen regelmäßig wechselnde Ausstellungen präsentiert.
Das Dominikanerinnen-Kloster in Meersburg hat seinen Ursprung um das Jahr 1300. Bis zu 20 Schwester lebten in dem Schwesternkonvent, das in der Stadt zunächst nur ‚die Sammlung‘ genannt wurde. Im Jahre 1784 wurde im Kloster eine Schule eingerichtet, die auch nach der Säkularisierung im Jahre 1808 weiterbestand. Heute beherbergt der Gebäudekomplex die Touristen-Information, das Stadtmuseum, die Bibelgalerie sowie die Stadtbücherei.
In den ehemaligen Räumen der Priorin ist heute das Stadtmuseum untergebracht. Es setzt sich mit der Entwicklung Meersburg im 19. und 20. Jahrhundert auseinander und geht besonders auf das Wirken von Karl Moll (1884 – 1936) ein, der als Bürgermeister die Geschicke der Stadt maßgeblich beeinflusste.
Die Bibelgalerie versteht sich als Erlebnisausstellung, die insbesondere auch Kinder ansprechen soll. Hier wird beispielhaft die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte der Heiligen Schrift bis in die heutige Zeit beschrieben und der Einfluss auf Kirche und Kunst beleuchtet.
In einem vom Schlosspark zugänglichen Anbau des Neuen Schlosses befindet sich ein außergewöhnliches Museum. Edith Müller-Ortloff (1911 – 1994), die zu den bedeutendsten Vertreterinnen der europäischen Bildteppichkunst gehörte, hatte 1948 die Kunst-Ausstellung gegründet. In 10 Räumen werden verschiedene farbenfroh leuchtende Wandteppiche gezeigt, die nach eigenen Entwürfen gefertigt wurden. Zu der Ausstellung gehört auch ein Atelier mit einem 3 m breiten Webstuhl.
Als ältestes durchgängig betriebenes Gasthaus der Stadt Meersburg blickt das Gasthaus ‚Zum Bären‘ auf eine lange Tradition zurück, denn bereits 1456 wurde eine Trinkstube mit diesem Namen urkundlich erwähnt. Das Gebäude allerdings wurde 1605 neu erbaut und ist seit 1851 im Besitz der Familie Keller-Karrer-Gilowsky. Während des 17. und 18. Jahrhundert diente das Lokal auch als Station der Thurn und Taxis’schen Post.
 Wenn man in der Bodenseeregion unterwegs ist, stolpert man häufig über die Werke des bekannten Bildhauers Peter Lenk (*1947). Der in Bodman lebende Künstler deutet mit seinen satirisch-bissigen Arbeiten auf gesellschaftliche Missstände hin. Seine Arbeiten sind nicht immer unumstritten und ernten zuweilen auch heftige Kritik. Zu seinen berühmtesten Werken zählt die ‚Imperia‘ am Konstanzer Hafen. Seit 2007 hat auch Meersburg sein eigenes Lenk-Kunstwerk. Auf einem Rondell am Hafen erhebt sich eine 15 m hohe Skulptur, in der bekannte Figuren aus der Meersburger Stadtgeschichte abgebildet sind. Einen überregional größeren Bekanntheitsgrad besitzt freilich nur die westfälische Dichterin Anette Droste von Hülshoff, die in Meersburg häufig die Sommermonate verbrachte und auch hier auf der Burg verstarb. In Gestalt einer Möwe ziert sie die Spitze des Denkmals. Darunter gesellen sich Adlige, Kirchenmänner und Ärzte, ironisch-augenzwinkernd verpackt in die Kostüme ihrer Phantasien…
Wenn man in der Bodenseeregion unterwegs ist, stolpert man häufig über die Werke des bekannten Bildhauers Peter Lenk (*1947). Der in Bodman lebende Künstler deutet mit seinen satirisch-bissigen Arbeiten auf gesellschaftliche Missstände hin. Seine Arbeiten sind nicht immer unumstritten und ernten zuweilen auch heftige Kritik. Zu seinen berühmtesten Werken zählt die ‚Imperia‘ am Konstanzer Hafen. Seit 2007 hat auch Meersburg sein eigenes Lenk-Kunstwerk. Auf einem Rondell am Hafen erhebt sich eine 15 m hohe Skulptur, in der bekannte Figuren aus der Meersburger Stadtgeschichte abgebildet sind. Einen überregional größeren Bekanntheitsgrad besitzt freilich nur die westfälische Dichterin Anette Droste von Hülshoff, die in Meersburg häufig die Sommermonate verbrachte und auch hier auf der Burg verstarb. In Gestalt einer Möwe ziert sie die Spitze des Denkmals. Darunter gesellen sich Adlige, Kirchenmänner und Ärzte, ironisch-augenzwinkernd verpackt in die Kostüme ihrer Phantasien…
Außerhalb der Altstadt von Meersburg steht die Kapelle Mariä Himmelfahrt. Das einschiffige gotische Gotteshaus wurde vermutlich im frühen 16. Jahrhundert erbaut. Aus dieser Zeit haben sich noch einige Fresken im Inneren des Gebäudes erhalten. Sie zierten einst das gesamte Langhaus. 1621 war der Chor und der Dachreiter ergänzt worden. Der Friedhof an der Kapelle war erst 1682 angelegt worden. Der auffälligste Einrichtungsgegenstand ist der gotische Hochaltar, der wohl um 1630 von David Zürn erschaffen wurde.
Das direkt am Bodensee stehende historische Gebäude wurde vermutlich durch Bischof Heinrich von Klingenberg gegen Ende des 13. Jahrhunderts gebaut. Lange diente es als Hof des Konstanzer Domkapitels. 1418 trafen sich hier König Sigismund und Herzog Friedrich von Österreich, um ihren Konflikt während des Konstanzer Konzils beizulegen. Nach der Säkularisierung wurde der Hof privatisiert und diente fortan als Gasthaus und Hotel, eine Zeitlang auch mit eigener Brauerei.
Als ‚Höhepunkt der Weinkultur‘ bietet das Weinbaumuseum zahlreiche historische Ausstellungsstücke aus der Kultivierung des Weinanbaus. Neben Küferwerkzeugen, Verkorkgeräten, hölzernen Hobeln und alten Fässern wird auch der so genannte Heilig-Geist-Torkel aus dem Jahre 1607 präsentiert. Im hinteren Teil des Museums befindet sich ein Weinproberaum, der Platz für bis zu 60 Personen bietet.
 Östlich der Altstadt von Meersburg stehen am Hang über dem Bodensee noch zwei weitere riesige Gebäudekomplexe: das Staatsweingut und das Droste-Hülshoff-Gymnasium. Das historische Weingutgebäude mit seiner stolzen barocken Front und seinem gepflegten Innenhof stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Tatsächlich ist das Weingut selber sehr viel älter, doch seine genauen Ursprünge liegen im Dunkeln. Vermutlich wurde es schon im 13. Jahrhundert gegründet. Lange Zeit befand es sich im Besitz der Fürstbischöfe von Konstanz, bis das Gut im Zuge der Säkularisierung 1803 dem Großherzogtum Baden zufiel und zur ersten Weinbaudomäne Deutschlands wurde. Heute gehört der Weinbaubetrieb dem Land Baden-Württemberg.
Östlich der Altstadt von Meersburg stehen am Hang über dem Bodensee noch zwei weitere riesige Gebäudekomplexe: das Staatsweingut und das Droste-Hülshoff-Gymnasium. Das historische Weingutgebäude mit seiner stolzen barocken Front und seinem gepflegten Innenhof stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Tatsächlich ist das Weingut selber sehr viel älter, doch seine genauen Ursprünge liegen im Dunkeln. Vermutlich wurde es schon im 13. Jahrhundert gegründet. Lange Zeit befand es sich im Besitz der Fürstbischöfe von Konstanz, bis das Gut im Zuge der Säkularisierung 1803 dem Großherzogtum Baden zufiel und zur ersten Weinbaudomäne Deutschlands wurde. Heute gehört der Weinbaubetrieb dem Land Baden-Württemberg.
Auf einem Hang über dem Bodensee steht mächtig der massive rote Barockbau des Droste-Hülshoff-Gymnasiums. Er wurde zwischen 1725 und 1735 durch den Konstanzer Fürstbischof Johann Franz Schenk von Staufenberg als Priesterseminar erbaut. 1735 folgte nach Osten hin eine Erweiterung, dem die strenge 15-achsige Symmetrie der Südfassade zum Opfer fiel. In den Ausbau des Gebäudes wurde die reich mit Fresken und Bildern ausgeschmückte Kapelle eingebaut. Der gesamte Komplex besteht aus einer Vierflügelanlage, die einen Innenhof umschließt. Das Schulgebäude wurde nach dem 18. Jahrhundert baulich nicht mehr verändert. Nachdem es 1872 in staatlichen Besitz gekommen war, wurde das Schulgebäude zunächst als katholisches Lehrerseminar, später als Aufbaurealschule und als Gymnasium mit integriertem Internat genutzt.
Stetten
alerisch von Rebhängen und Obstbaumplantagen umgeben, liegt die kleine Gemeinde Stetten. Obwohl das Gemeindegebiet einen direkten Zugang zum Bodensee besitzt, liegt der Kernort etwas erhöht am Hang. Im Frühjahr bietet die Apfelblüte, wenn Tausende von Bäumen in voller Blütenpracht stehen, eine spektakuläre Farbenpracht. Während des Sommers breitet sich ein mediterranes Flair aus, das schon den Römern gefallen haben muss, denn sie brachten die Weinreben mit. Im ‚Stettener Herbst‘ schließlich wird die Obsternte und die Weinlese ausgiebig gefeiert! Der Ort lockt seine Besucher mit einem gut ausgebauten Rad- und Wanderwegenetz durch seine schöne waldreiche Umgebung und entlang dem hier noch naturbelassenen Bodensee.
Sehenswertes:
Die schlichte gelb getünchte Kapelle Peter und Paul wurde 1696 erbaut. Tatsächlich wurde eine Kirche in Stetten bereits Mitte des 12. Jahrhunderts erwähnt. Die Sakristei von 1484 wurde aus dem Vorgängerbau an gleicher Stelle übernommen. Das Gotteshaus enthält zwei Kreuzigungsgruppen aus dem 16. bzw. 17. Jahrhundert und zwei spätgotische Flügelaltäre aus dem 15. Jahrhundert. Der auf Leinen gemalte Kreuzweg im hinteren Kirchenraum entstand 1771. Die Insignien der Kirchenpatrone, Schlüssel und Schwert, finden sich auch auf dem Wappen der Gemeinde wieder.
Hagnau am Bodensee
nmitten eines ausgedehnten Weinbaugebietes liegt die Gemeinde Hagnau am Bodensee. Hier entstand die älteste Winzergenossenschaft Badens. Sie ist auch heute noch die größte Winzervereinigung am Bodensee. Der Ort besitzt eine intakte Dorfstruktur und die Spazierwege am Bodensee laden zu einem gemütlichen Bummel ein.
Bereits in der Bronzezeit war das Gemeindegebiet besiedelt. Grabungen förderten die älteste Holzflöte Europas und auch eine alte römische Öllampe zutage.
Mit der Schweizerischen Gemeinde Münsterlingen verbindet Hagnau einen traditionellen alten Brauch: die Eisprozession bei der Seegfrörne. Bei einem vollständigen Zufrieren des Bodensees laufen wechselseitig die Bürger der einen Gemeinde über den See zu der anderen und holen die spätgotische Büste des hl. Johannes ab, um sie in der eigenen Kirche wieder aufzustellen.
Sehenswertes:
 Das Rathaus von Hagnau beherbergt ein interessantes Heimatmuseum, das sich im Aufbau von anderen vergleichbaren Museen deutlich abhebt. Das Hagnenauer Museum widmet sich vorrangig dem Leben und Werk dreier Persönlichkeiten, die mit dem Ort in direkter Verbindung stehen. Reinhard Sebastian Zimmermann (1815 – 1893) war ein Maler, der in Hagnau geboren wurde und auch hier lange direkt am Bodensee lebte. Von ihm sind einige Ölbilder zu sehen. Auch der Künstler Julius Bissier (1893 – 1965) lebte sehr lange im Dorf. Das Museum zeigt mehrere ungegenständliche Tuschebilder sowie seinen Arbeiten nachempfundene Webarbeiten. Der katholische Pfarrer Heinrich Hansjakob (1837 – 1916) trat auch als Politiker und Historiker in Erscheinung. Bekannt wurde er jedoch als Heimatschriftsteller. Zwischen 1869 und 1883 war er Pfarrer in Hagnau. Hier gründete er mit dem Hagnauer Winzerverein die erste Winzergenossenschaft Badens.
Das Rathaus von Hagnau beherbergt ein interessantes Heimatmuseum, das sich im Aufbau von anderen vergleichbaren Museen deutlich abhebt. Das Hagnenauer Museum widmet sich vorrangig dem Leben und Werk dreier Persönlichkeiten, die mit dem Ort in direkter Verbindung stehen. Reinhard Sebastian Zimmermann (1815 – 1893) war ein Maler, der in Hagnau geboren wurde und auch hier lange direkt am Bodensee lebte. Von ihm sind einige Ölbilder zu sehen. Auch der Künstler Julius Bissier (1893 – 1965) lebte sehr lange im Dorf. Das Museum zeigt mehrere ungegenständliche Tuschebilder sowie seinen Arbeiten nachempfundene Webarbeiten. Der katholische Pfarrer Heinrich Hansjakob (1837 – 1916) trat auch als Politiker und Historiker in Erscheinung. Bekannt wurde er jedoch als Heimatschriftsteller. Zwischen 1869 und 1883 war er Pfarrer in Hagnau. Hier gründete er mit dem Hagnauer Winzerverein die erste Winzergenossenschaft Badens.
Weitere Schwerpunktthemen bilden archäologische Grabungsfundstücke sowie eine Dokumentation über die Seegfrörne. Die Gegend von Hagnau war bereits in der Bronzezeit besiedelt. Bei den Untersuchungen dieser Pfahlbausiedlungen am Bodenseeufer wurden viele aufschlussreiche Gegenstände gesichert, die durch den Sauerstoffabschluss im Schlick teilweise noch sehr gut erhalten sind. Die Seegfrörne bezeichnet einen Brauch, bei dem beim vollständigen Überfrieren des Bodensees im Winter eine Johannisbüste zwischen Hagnau und dem Schweizerischen Münsterlingen wechselseitig hin- und hergetragen wird. Die letzte Seegfrörne fand 1963 statt.
 Die katholische Kirche in Hagnau ist ein spätgotischer Bau. Er wurde 1729 im barocken Stil umgestaltet. Seitlich an den Chorraum angelehnt steht der mittelalterliche romanische Glockenturm, der noch von einem abgetragenen Vorgängerbau stammt.
Die katholische Kirche in Hagnau ist ein spätgotischer Bau. Er wurde 1729 im barocken Stil umgestaltet. Seitlich an den Chorraum angelehnt steht der mittelalterliche romanische Glockenturm, der noch von einem abgetragenen Vorgängerbau stammt.
Seit 1573 gibt es in Hagnau und der schweizerischen Gemeinde Münsterlingen bei jeder ‚Seegfrörne‘ den traditionellen Brauch der Eisprozession. Die Seegfrörne bezeichnet den Zustand des vollständig zugefrorenen und tragfähigen Bodensees. Bei einer Seegfrörne laufen wechselseitig die Bürger der einen Gemeinde über den See zu der anderen und holen die spätgotische Büste des hl. Johannes ab, um sie in der eigenen Kirche wieder aufzustellen. Häufig kommt das nicht vor. Die letzte Seegfrörne fand im Jahre 1963 statt. Seitdem befindet sich die Büste in der Kirche von Münsterlingen und der Sockel in der Hagnauer Kirche ist verwaist. Bis zur nächsten Seegfrörne…
Das Kleine Museum präsentiert eine schnucklige und außergewöhnliche private Sammlung von historischen Puppen und Puppenstuben, Kaufmannslädchen und anderen Spielsachen aus der Zeit zwischen 1830 und 1920. Die Ausstellung wurde von Gerda Rößler in jahrelanger Sammelleidenschaft liebevoll zusammengetragen. Die Puppenmutti betreibt das ‚Kleine Museum‘ im Untergeschoss ihres Privathauses.
Der katholische Pfarrer Heinrich Hansjakob (1837 – 1916) trat auch als Heimatschriftsteller, Politiker und Historiker in Erscheinung. Zwischen 1869 und 1883 war er Pfarrer in Hagnau am Bodensee. Hier gründete er mit dem Hagnauer Winzerverein die erste Winzergenossenschaft Badens. Er predigte die Mäßigung in der Lebensführung, dennoch sind vier uneheliche Kinder bezeugt. Bekannt wurde er vor allem als Schriftsteller. Zu seinen Werken gehören Romane und Erzählungen, Reiseberichte, aber auch wissenschaftliche und politische Schriften.
Der badische Bildhauer Gerold Jäggle schuf eine Metallskulptur, die sich auf Hansjacobs Buch ‚Schneeballen vom Bodensee‘ bezieht. Die Handlung dieser Geschichte spielte in Hagnau. Jäggle verarbeitete in seinem Werk aber auch die Eisprozession bei der Seefrörne sowie Hagnauer Bauten und die hier lebenden Menschen mit ihren Trachten. Die Skulptur wurde in der Dorfmitte aufgestellt.
Immenstaad am Bodensee
ie Gemeinde am nördlichen Ufer des Bodensees wird geprägt durch Industrie, Tourismus und den Obst- und Traubenanbau. Der Ort wurde vermutlich im 7. Jahrhundert durch Alemannen gegründet. Eine erste schriftliche Erwähnung findet sich im Jahr 1094, so dass die Gemeinde 1994 ihr 900-jähriges Bestehen feiern konnte. Auf dem Gemeindegebiet stehen drei Schlösser, allesamt ehemalige Rittersitze. Sie zeugen von der einstigen Zersplitterung der Herrschaftsgebiete. Noch im 18. Jahrhundert war der Ortskern unter drei verschiedenen Herren aufgeteilt. Lange diente der Weinanbau als Lebensgrundlage der Menschen. Die jüngere Vergangenheit wird jedoch stark von der Ansiedelung der Dornier-Werke und durch den Tourismus geprägt.
Täglich gibt es mehrere Personenschifffahrtsverbindungen nach Friedrichshafen, Lindau, Bregenz, Meersburg, Konstanz und zur Insel Mainau.
Sehenswertes:
Die katholische Kirche von Immenstaad bildet eine interessante und harmonische Symbiose zwischen alter Bausubstanz und einem modernen Gotteshaus. Eine erste Kirche war 1474 bis 1487 an diesem Ort erbaut worden. Der heute noch erhaltene alte Turm und der asymmetrisch angelegte gotische Chor gehörte zu diesem Kirchenbau. Nachdem 1980 das alte Kirchenschiff abgebrochen wurde, errichtete man die Jodokuskirche neu und integrierte den alten Chor als Seitenkapelle. Zahlreiche Einrichtungsgegenstände wurden aus dem alten Kirchengebäude übernommen. Auf dem neugotischen Hochaltar steht eine gekrönte Marienfigur aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Sie gilt als eine der bedeutendsten gotischen Kunstwerke der Bodenseeregion. Die verschiedenen geschnitzten Holzfiguren entstammen überwiegend dem 17. und 18. Jahrhundert, das Chorgestühl wurde vermutlich im 16. Jahrhundert gefertigt.
Im Dorf Kippenhausen steht das denkmalgeschützte Haus Montfort. Das alte Fachwerkgebäude mit dem Walmdach war 1796 errichtet worden und beherbergt heute eine Gastwirtschaft und im Dachgeschoß ein Heimatmuseum. Die Ausstellung zeigt einen Eisenwarenladen, historische Wohnungseinrichtungen sowie Handwerks- und Alltagsgegenstände, die alle aus der näheren Umgebung stammen. Daneben werden auch einige ur- und frühgeschichtliche Exponate präsentiert.
 Zwischen Hagnau und Immenstaad liegt über dem Bodensee inmitten von Weinbergen das Schloss Kirchberg. Die Front des Südflügels ist zum See ausgerichtet. Die Front des Ostflügels besitzt einen dreiachsigen Mittelrisalit. Ein quadratisch angelegter französischer Garten ist dem Schloss vorgelagert.
Zwischen Hagnau und Immenstaad liegt über dem Bodensee inmitten von Weinbergen das Schloss Kirchberg. Die Front des Südflügels ist zum See ausgerichtet. Die Front des Ostflügels besitzt einen dreiachsigen Mittelrisalit. Ein quadratisch angelegter französischer Garten ist dem Schloss vorgelagert.
Eine erste urkundliche Erwähnung des Gutes Kirchbergs findet sich im Jahr 1288. Um 1600 diente Kirchberg sogar als Abt-Residenz. Im 18. Jahrhundert wurde das Prunkhaus neu aufgebaut. Teile des alten Renaissance-Gebäudes aus dem 16. Jahrhundert wurden dabei in den neuen Schlossbau integriert. 1741 entstand der Südflügel, 1775 der Ostflügel. Doch im Zuge der Säkularisierung fiel das Anwesen 1802 an das Haus Baden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Schloss noch einmal stark um- und ausgebaut, wobei es sein heutiges klassizistisches Erscheinungsbild erhielt. Das Schloss wird noch immer als Weingut genutzt. Daneben gehören auch ein Campingplatz und ein Yachthafen zum Anwesen.
 Inmitten von Weinbergen steht hoch über dem Bodensee das Schloss Hersberg. Es wurde 1555 als massiger Frontalbau mit zwei gotischen Treppengiebeln errichtet. Schon 1276 war das Rittergut erstmals in einer alten Urkunde erwähnt worden. Im späten 17. Jahrhundert wurde das Schloss einem größeren Umbau unterzogen. Der Ostflügel wurde erweitert, die Hauptfront erhielt das markante Belvederetürmchen und die Schlosskirche wurde im barocken Stil umgestaltet. Mehrfach wechselte das Anwesen danach den Besitzer, ehe es der Orden der Pallottiner 1930 übernahm und im Schloss ein Bildungszentrum und Pflegeheim einrichtete.
Inmitten von Weinbergen steht hoch über dem Bodensee das Schloss Hersberg. Es wurde 1555 als massiger Frontalbau mit zwei gotischen Treppengiebeln errichtet. Schon 1276 war das Rittergut erstmals in einer alten Urkunde erwähnt worden. Im späten 17. Jahrhundert wurde das Schloss einem größeren Umbau unterzogen. Der Ostflügel wurde erweitert, die Hauptfront erhielt das markante Belvederetürmchen und die Schlosskirche wurde im barocken Stil umgestaltet. Mehrfach wechselte das Anwesen danach den Besitzer, ehe es der Orden der Pallottiner 1930 übernahm und im Schloss ein Bildungszentrum und Pflegeheim einrichtete.
Der ehemalige Rittersitz liegt am östlichen Ortsrand von Immenstaad direkt am Bodensee. Schon 1213 wurde er als Residenz der Herren von Helmsdorf genannt. Das heutige Gebäude entstand im 18. Jahrhundert, als sich das Gut im Besitz des Klosters Habsthal befand. Später diente es als Ziegelei und Bierbrauerei. Heute gehören zum Anwesen ein Campingplatz, ein Yachthafen, ein Restaurant und einige Ferienwohnungen.
Die alte romanische Feldsteinkirche in Frenkenbach stammt aus dem 12. Jahrhundert. An den Seitenwänden des historischen Gemäuers sind noch die Spuren der einstigen Fenster zu erkennen. Ansonsten blieb das alte Gotteshaus weitgehend unverändert. Die Fresken, die einst das Innere der Kirche zierten, sind nicht mehr erhalten. Dennoch sind zwei Figuren bemerkenswert: der um 1400 erschaffene Schmerzensmann und eine Skulptur der Anna selbdritt aus dem 18. Jahrhundert.
Mitten im Dorf Kippenhausen auf einer kleinen Anhöhe steht die Kirche Mariä Himmelfahrt. Der Turm und die Umfassungsmauern des Chores stammen noch aus dem 15. Jahrhundert, aber der heutige barocke Kirchenbau wurde erst 1710 errichtet. Das Innere des Gotteshauses ist prächtig ausgeschmückt. Sehenswert sind der Hochaltar mit einem um 1500 entstandenen Altarbild und die großen Stuckarbeiten unter der Decke, die die vier Evangelisten abbilden.
Gegenüber der Kirche steht das historische Pfarrheim. Das hübsche Fachwerkhaus war um 1800 errichtet worden.
Das heimatgeschichtlich bedeutende Gebäude auf der Hauptstraße prägt das Ortsbild der Gemeinde Immenstaad. Es wurde 1461 als Torkelscheuer für den Weinanbau errichtet und ist damit das älteste Profangebäude des Ortes. In den 1970er Jahren entging es nur knapp dem Abriss. Nachdem es um 2000 aufwendig saniert wurde, erhielt das historische Gebäude mit dem Krüppelwalmdach den Denkmalschutzpreis der Württembergischen Hypo.
Friedrichshafen
ie Messe- und Zeppelinstadt am Nordufer des Bodensees feierte im Jahr 2011 ihren 200sten Geburtstag – eigentlich den Namenstag, denn die Stadt ging damals aus dem Zusammenschluss der ehemaligen freien Reichsstadt Buchhorn und dem Dorf Hofen hervor. Der neue Name leitet sich vom ersten württembergischen König Friedrich I. ab. Das Wappen hatte man von der Vorgängerstadt übernommen. Aus dem ehemaligen Kloster Hofen war nach der Säkularisierung das Schloss Friedrichshafen geworden. Es diente fortan als königliche Residenz für das Haus Württemberg. Sehenswert ist die prachtvoll ausgeschmückte Schlosskirche, die heute als evangelische Pfarrkirche dient. Friedrichshafen nahm im 19. Jahrhundert einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung, insbesondere als Freihafen und Umschlagsplatz für Handelsgüter. Auch heute noch spielt der Hafen in der Personenschifffahrt eine große Rolle. Eine Fährverbindung führt hinüber ins Schweizerische Romanshorn. Mit der Weiße Flotte und Katamaranen werden im Sommerhalbjahr Verbindungen u.a. nach Konstanz, Bregenz, Meersburg, Überlingen und Lindau angeboten. Auf der Promenade laden eine Vielzahl von Restaurants und Cafés zum Verweilen ein. Um die Stadt auf eigene Faust zu entdecken, wurden mehrere Fußpfade von unterschiedlicher Länge geschaffen. Informationstafeln an spezifischen Orten geben umfangreiche Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte, zu den Naturlandschaften des Bodensees und zu Wirkungsstätten bedeutender Friedrichshafener Persönlichkeiten. Die Stadt ist untrennbar mit dem Namen Graf Zeppelins verbunden. Der Graf begründete den Luftschiffbau in Deutschland und prägte damit entscheidend die Industrialisierung Friedrichshafens. Im Juli 1900 hob sein erstes Starrluftschiff, die LZ 1 erstmals im Stadtteil Manzell ab. Das Zeppelinmuseum am Hafen präsentiert neben einem Überblick über die deutsche Luftschifffahrt auch einen begehbaren Nachbau eines Teilstücks des Luftschiffs LZ 129. Im 2. Stockwerk befindet sich die Kunstsammlung der Stadt Friedrichshafen, deren Schwerpunkt auf der Kunst des 20. Jahrhundert liegt. Dem Werk des Ingenieurs und Flugzeugpioniers Claude Dornier, der besonders durch seine legendären Flugboote bekannt wurde, ist am Flughafen ein großes Museum mit zahlreichen Luftfahrzeugen gewidmet. Die zweitgrößte Stadt am Bodensee ist aber auch ein wichtiger Messestandort. Hier finden regelmäßig die Luftfahrtmesse ‚AERO‘, die Wassersportmesse ‚Interboot‘, die ‚Internationale Bodenseemesse IBO‘ und – allen voran – natürlich die Fahrradmesse ‚Eurobike‘ statt.
Sehenswertes:
Kloster oder Schloss? Hofen oder Friedrichshafen? Beides ist jeweils richtig – nur beziehen sich die Namen und Orte auf verschiedene Epochen.
Berta, die Gemahlin von Graf Otto I. von Buchhorn, gründete um 1085 das Benediktinerinnenkloster am Bodensee, das im 13. Jahrhundert den Namen ‚Kloster Hofen‘ erhielt und dem Kloster Weingarten unterstellt war. Nachdem die Anlage im Dreißigjährigen Krieg niedergebrannt wurde, errichtete man zwischen 1695 und 1701 die heutigen stattlichen Konventgebäude und die Klosterkirche. Auch der zwischenzeitlich eingestellte Klosterbetrieb wurde wiederbelebt. Doch als im Jahre 1803 das Kloster Weingarten säkularisiert wurde, wurde auch das Kloster Hofen aufgelöst. Die Gebäude wurden durch den französischen Kaiser Napoleon dem Haus Württemberg übertragen. Das Dorf Hofen und die damalige Stadt Buchhorn vereinigten sich derweil zur Stadt Friedrichshafen. Der Klosterbau wurde ab 1824 zur Sommerresidenz für den König von Württemberg umgebaut und die ehemalige Klosterkirche wurde der Evangelischen Kirche übergeben. Seitdem hieß das Kloster Hofen nun Schloss Friedrichshafen und aus der Klosterkirche wurde die Schlosskirche. Bis heute befindet sich die Anlage im privaten Besitz des Hauses Württemberg.
Schon von weitem ist das Wahrzeichen der Stadt Friedrichshafen, die Schlosskirche mit ihrer markanten Silhouette zu sehen. Das Gotteshaus zählt zu den herausragenden schwäbischen Bauwerken des Frühbarocks und entstand zwischen 1695 und 1701 als Klosterkirche des Klosters Hofen. Seine beiden 55 m hohen mächtigen Kirchtürme bestehen aus Rorschacher Sandstein und werden jeweils von einer welschen Haube bekrönt. Nach der Säkularisierung fiel der Sakralbau 1812 an die Evangelische Kirche. Obwohl die Kirche während des Zweiten Weltkrieges erheblichen Schaden nahm, ist die barocke Inneneinrichtung noch weitgehend erhalten. Sie fällt, da sie noch aus der Zeit des Klosters stammt, für eine protestantische Kirche ungewöhnlich üppig aus. Beeindruckend sind die kunstvollen und reichhaltigen Stuckaturen, die der Wessobrunner Stuckateurschule entstammen.
 Die Stadt Friedrichshafen ist untrennbar mit dem Namen von Graf Ferdinand von Zeppelin verbunden (1838 – 1917). Der Graf begründete den Luftschiffbau in Deutschland und prägte damit entscheidend die Industrialisierung der Stadt. Im Juli 1900 hob sein erstes Starrluftschiff, die LZ1 erstmals vom Bodensee ab. Die deutsche Verkehrsluftschifffahrt endete jedoch abrupt 1937 durch den verhängnisvollen Unfall der LZ-129 ‚Hindenburg‘ im amerikanischen Lakehurst. Der Zeppelinkonzern besteht dagegen noch immer und hat sich inzwischen auf die Produktion von Baumaschinen und Leichtbau-Container konzentriert. Noch heute werden Luftschiffe aller Art im deutschen Volksmund als ‚Zeppelin‘ bezeichnet.
Die Stadt Friedrichshafen ist untrennbar mit dem Namen von Graf Ferdinand von Zeppelin verbunden (1838 – 1917). Der Graf begründete den Luftschiffbau in Deutschland und prägte damit entscheidend die Industrialisierung der Stadt. Im Juli 1900 hob sein erstes Starrluftschiff, die LZ1 erstmals vom Bodensee ab. Die deutsche Verkehrsluftschifffahrt endete jedoch abrupt 1937 durch den verhängnisvollen Unfall der LZ-129 ‚Hindenburg‘ im amerikanischen Lakehurst. Der Zeppelinkonzern besteht dagegen noch immer und hat sich inzwischen auf die Produktion von Baumaschinen und Leichtbau-Container konzentriert. Noch heute werden Luftschiffe aller Art im deutschen Volksmund als ‚Zeppelin‘ bezeichnet.
1996 eröffnete das Zeppelin-Museum im ehemaligen Hafenbahnhof von Friedrichshafen. Auf einer Fläche von 4000m² wird die Geschichte der Luftschiffe bis zur Gegenwart veranschaulicht. Mittelpunkt der Ausstellung ist dabei die Geschichte der LZ 129 ‚Hindenburg‘, Höhe- und Endpunkt des deutschen Verkehrsluftschiffbaus. Der begehbare Nachbau eines 33 Meter langen Teilstücks des Luftschiffs mit Passagierkabinen, Aufenthaltsraum und Schreibsalon ist das größte und eindrucksvollste Exponat der Ausstellung. Daneben werden die Motoren und das Aluminiumgerippe des Zeppelins gezeigt.
Neben der technischen Abteilung präsentiert das Museum im 2. Stockwerk die Kunstsammlung der Stadt Friedrichshafen, deren Schwerpunkt auf der Kunst des 20. Jahrhundert und auf Ansichten vom Bodensee liegt. Unter anderem werden Werke von Otto Dix, Max Ackermann und Karl Hubbuch ausgestellt.
Der deutsch-französische Ingenieur Claude Dornier (1884 – 1969) gehörte zu den bedeutendsten Flugzeugkonstrukteure des 20. Jahrhunderts. Er war Abteilungsleiter im Zeppelin-Konzern und übernahm 1932 die Geschäftsleitung der Flugzeugsparte, aus dem später die Dornier-Werke hervorgingen. Die von ihm konstruierten Ganzmetallflugzeuge stellten Meilensteine in der Flugzeugentwicklung dar. Insbesondere seine Flugboote ‚Wal‘, ‚Do 18‘ und ‚Do-X‘, das damals weltgrößte Flugboot mit insgesamt 16 Triebwerken, sind legendär. Nach dem Weltkrieg baute er sein Werk in München und Oberpfaffenhofen wieder auf. Hier wurde in den 1970er Jahren der deutsch-französische ‚Alpha-Jet‘ entwickelt und gebaut. Erst 1962 zog sich Dornier im Alter von 78 Jahren aus der Geschäftsleitung zurück, wirkte aber dennoch weiterhin bis zu seinem Tode an den Entscheidungen des Konzerns maßgeblich mit.
Das im Jahre 2009 eröffnete Dornier-Museum, am Flughafen von Friedrichshafen zeichnet die Firmengeschichte der Dorier-Werke nach. Der moderne Bau wurde einem Flugzeughangar nachempfunden. Das Flugzeug- und Technikmuseum präsentiert auf einer Ausstellungsfläche von über 30.000 m² mehr als 400 Exponate aus der Luft- und Raumfahrt, darunter die Do 27, Do 28, Do 29, der Senkrechtstarter Do 31, sowie Nachbauten vom berühmten ‚Wal‘ und vom ‚Merkur‘. Daneben werden der Alpha-Jet, mehrere Helikopter, Triebwerke, Dronen, Satelliten sowie Originalteile eines Spacelabs gezeigt. Das Museum mit seinem ausgedehnten Freiluftgelände ist ein Eldorado für alle Flugzeugbegeisterten.
 Im Zentrum von Friedrichshafen fällt dem Besucher ein gotischer Kirchturm ins Auge. Die glasierten farbigen Dachschindeln zeichnen ein rot-gelbes Rautenmuster auf grünem Grund. Der Turm gehört zu der eigentlich barocken Pfarrkirche St. Nikolaus, doch die Geschichte des Gotteshauses ist sehr viel älter. Ursprünglich wurde sie als Kapelle im 13. Jahrhundert erbaut. Im 15. Jahrhundert wurde sie um einen gotischen Turm und den markanten Turm erweitert. Zwischen 1745 und 1750 erhielt die Nikolauskirche dann weitgehend ihre heutige barocke Erscheinungsform. Zuvor war die ehemalige Filialkirche des Klosters Hofen im 17. Jahrhundert zur Pfarrkirche erhoben worden. Leider brannte das Gotteshaus nach einem Bombenangriff im Jahr 1944 vollständig aus. 1949 wurde die wiederaufgebaute Kirche neu geweiht.
Im Zentrum von Friedrichshafen fällt dem Besucher ein gotischer Kirchturm ins Auge. Die glasierten farbigen Dachschindeln zeichnen ein rot-gelbes Rautenmuster auf grünem Grund. Der Turm gehört zu der eigentlich barocken Pfarrkirche St. Nikolaus, doch die Geschichte des Gotteshauses ist sehr viel älter. Ursprünglich wurde sie als Kapelle im 13. Jahrhundert erbaut. Im 15. Jahrhundert wurde sie um einen gotischen Turm und den markanten Turm erweitert. Zwischen 1745 und 1750 erhielt die Nikolauskirche dann weitgehend ihre heutige barocke Erscheinungsform. Zuvor war die ehemalige Filialkirche des Klosters Hofen im 17. Jahrhundert zur Pfarrkirche erhoben worden. Leider brannte das Gotteshaus nach einem Bombenangriff im Jahr 1944 vollständig aus. 1949 wurde die wiederaufgebaute Kirche neu geweiht.
Zu der Innenausstattung gehört eine spätgotische Madonna mit Kind aus dem 15. Jahrhundert, eine barocke Statue des Kirchenpatrons Nikolaus (um 1720) sowie zwei Nikolaus-Reliefs, die vermutlich dem 15. Jahrhundert entstammen.
 An der Hafeneinfahrt von Friedrichshafen steht ein 22m hoher stählerner Aussichtsturm. Der frei zugängliche Moleturm wiegt mehr als 47 Tonnen und wurde im September 2000 fertig gestellt. Er soll direkten Bezug auf die gegenüber liegenden Bauelemente des Hafenbahnhofs nehmen und einen vertikalen Gegenpol zu der horizontal ausgerichteten Überdachung des gegenüberliegenden Molenkopfes darstellen. Von der oberen Plattform bietet sich ein herrlicher Blick über die Stadt, den Hafen, den Bodensee und das Umland.
An der Hafeneinfahrt von Friedrichshafen steht ein 22m hoher stählerner Aussichtsturm. Der frei zugängliche Moleturm wiegt mehr als 47 Tonnen und wurde im September 2000 fertig gestellt. Er soll direkten Bezug auf die gegenüber liegenden Bauelemente des Hafenbahnhofs nehmen und einen vertikalen Gegenpol zu der horizontal ausgerichteten Überdachung des gegenüberliegenden Molenkopfes darstellen. Von der oberen Plattform bietet sich ein herrlicher Blick über die Stadt, den Hafen, den Bodensee und das Umland.
Einen interessanten Überblick über geschichtlich bedeutsame Orte in Friedrichshafen bietet der Geschichtspfad. Der drei Kilometer lange Fußweg wurde von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt erarbeitet und führt über 50 verschiedene Stationen vom Hafenbahnhof bis zum Stadtbahnhof. Dabei werden interessante Hintergrundinformationen vermittelt, die wahrscheinlich auch so manchen Einheimischen neu sein dürften.
Neben Graf Zeppelin und Claude Dornier ist Karl Maybach der dritte große Erfinder und Ingenieur, der mit der Stadt Friedrichshafen in Verbindung gebracht wird. Er arbeitete zunächst wie sein Vater Wilhelm bei Mercedes-Benz und wurde 1909 technischer Leiter bei der Luftfahrzeug-Motoren GmbH. Drei Jahre später zog er mit seiner Firma nach Friedrichshafen, wo er Motorenlieferant für die Zeppelin-Werke wurde. Maybach zeichnete sich verantwortlich für wegweisende Dieselmotoren im Automobil-, Schienen- und Schiffsverkehr.
Der Maybach-Weg führt zu zwölf Orten seines Lebens und Wirkens. Informationstafeln klären über Hintergründe auf. Die erste Station befindet sich am Karl-Maybach-Gymnasium, wo man während der Öffnungszeiten der Schule eine Dauerausstellung zu seinem Leben besuchen kann. Der Pfad führt unter anderem an der einstigen Villa des Konstrukteurs vorbei und endet an seinem Grab auf dem Stadtfriedhof.
 Als Ergänzung zum Geschichtspfad wurde im Jahre 2008 der Zeppelinpfad eingerichtet. Auf einer Länge von 12 Kilometern werden auf neun Stationen Informationen zur Geschichte des Konzerns und der Stiftung Zeppelins gegeben. Der Pfad beginnt im äußersten Westen Friedrichshafens bei der Ziegelei Grenzhof. Am dortigen Grenzbach im Stadtteil Fischbach befand sich einst die Landesgrenze zwischen Baden und Württemberg. Weitere Stationen sind u.a. das Industriegelände in Manzell, wo im Jahr 1900 der allererste Aufstieg des Luftschiffes LZ 1 stattfand sowie das Zeppelinmuseum am Hafenbahnhof, das einen umfassenden Überblick über die deutsche Luftschifffahrt gibt.
Als Ergänzung zum Geschichtspfad wurde im Jahre 2008 der Zeppelinpfad eingerichtet. Auf einer Länge von 12 Kilometern werden auf neun Stationen Informationen zur Geschichte des Konzerns und der Stiftung Zeppelins gegeben. Der Pfad beginnt im äußersten Westen Friedrichshafens bei der Ziegelei Grenzhof. Am dortigen Grenzbach im Stadtteil Fischbach befand sich einst die Landesgrenze zwischen Baden und Württemberg. Weitere Stationen sind u.a. das Industriegelände in Manzell, wo im Jahr 1900 der allererste Aufstieg des Luftschiffes LZ 1 stattfand sowie das Zeppelinmuseum am Hafenbahnhof, das einen umfassenden Überblick über die deutsche Luftschifffahrt gibt.
Wie vielfältig die Tier- und Pflanzenwelt der Bodenseeregion ist, kann man auf dem Bodenseepfad entdecken. Auf zahlreichen Informationstafeln werden die Besonderheiten von Flora und Fauna behandelt. In Friedrichshafen gibt es drei Ausgangspunkte: das Strandbad, der Hafenbahnhof und die Jugendherberge an der Rotach. Im benachbarten Eriskirch, den Endpunkt bzw. dem östlichen Startpunkt des Pfades, beherbergt das ehemalige Bahnhofsgebäude das Naturschutzzentrum mit einer Ausstellung über die ökologische Vielfalt der Bodenseelandschaft.
In der ‚Villa von Riss‘ ist eine ansehnliche schulgeschichtliche Ausstellung zu sehen. Die Sammlung ist die älteste ihrer Art in Baden-Württemberg und ist in verschiedene Klassenräume aufgeteilt: eine Klosterschulklasse sowie typische Schulräume aus den Jahren 1800, 1850, 1900, 1930 und der Zeit des Nationalsozialismus. Ergänzend werden die verschiedenen Schultypen beschrieben und die ungeliebten Schulstrafen vorgestellt.
In dem 1930 erbauten einstigen Spritzenhaus der Freiwilligen Feuerwehr Ettenkirch befindet sich seit 2005 eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Feuerwehr. Neben historischen Löschfahrzeugen werden hier Ausrüstungsgegenstände, Brandmelder und Schutzanzüge präsentiert. Das Museum besitzt derzeit keine festen Öffnungszeiten. Eine Besichtigung kann über die Feuerwache Friedrichshafen vereinbart werden.
Der älteste Bauteil der katholischen Pfarrkirche in Schnetzenhausen ist der frühmittelalterliche Turm mit seinem markanten Krüppelwalmdach. Das Kirchenschiff wurde erst 1754 auf den Resten des Vorgängerbaus errichtet. Bei Umbauarbeiten in den 1950er Jahren wurde das Gotteshaus barock stilbereinigt. Es hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt einige architektonische Bausünden eingeschlichen, die die Harmonie des Sakralgebäudes empfindlich störten. Dabei erhielt die Kirche auch eine neue Sakristei als Anbau.
Auf einem kleinen Hügel im Stadtteil Berg steht die kleine Pfarrkirche St. Nikolaus. Das weiß verputzte Gotteshaus mit der nach innen gewölbten Kirchturmspitze wurde 1662 fertig gestellt, nachdem der Vorgängerbau im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Eine erste Kirche hatte hier nachweislich bereits Mitte des 13. Jahrhunderts gegeben. Das heutige Kirchengebäude wurde im 18. und 19. Jahrhundert nochmals erheblich umgebaut. Während des Zweiten Weltkrieges erlitt das Gotteshaus erheblichen Schaden, wurde aber schon bald darauf wiederhergestellt. Die historische Inneneinrichtung ging vollständig verloren.
Die erste Kirche in Ettenkirch entstand vermutlich bereits Mitte des 8. Jahrhunderts, aber als selbstständige Pfarrei besteht die Gemeinde erst seit 1715. Der heutige Kirchenbau besitzt im Chor und an der Ostwand noch deutliche Spuren der Spätgotik, doch im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Gotteshaus mehrfach umgebaut und vergrößert, so dass vom Ursprungsbau nur relativ wenig erhalten blieb. 1884 wurde der Turm auf stolze 37 Meter erhöht und erhielt dabei sein charakteristisches achtseitiges Zeltdach. Von der historischen Inneneinrichtung ist bis auf zwei Statuen der Kirchenpatrone Petrus und Paulus nichts mehr erhalten. Sehenswert ist die Deckenbemalung, die die Krönung Marias darstellt und um das Jahr 1900 entstand.
Eriskirch
m Mündungsbereich der kleinen Schussen in den Bodensee, geprägt durch Wiesen, große Waldgebiete und das Eriskircher Ried, liegt die ländlich beschauliche Gemeinde Eriskirch. Das 450 ha. große Ried ist das größte Naturschutzgebiet am nördlichen Bodenseeufer und Refugium einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt.
Archäologische Grabungen und Funde belegen eine frühe Besiedelung bereits in der Steinzeit. Auch die Römer hinterließen hier ihre Spuren. Sie hatten im 1. Jhd n. Chr. eine Brücke über die Schussen gebaut. Der Fluss, der noch von zwei uralten Holzbrücken aus dem 19. Jahrhundert überquert wird, stellte lange eine natürliche Grenze zwischen den Gemeinden Eriskirch und Oberdorf dar. Die frühgotische Kirche Mariä Himmelfahrt und die Quelle in Mariabrunn waren einst Ziele einer blühenden Wallfahrt.
Sehenswertes:
Als Ende des 14. Jahrhundert die Kirche Mariä Himmelfahrt erbaut wurde, hatte sich bereits eine blühende Wallfahrt zu dem Ort entwickelt. Schon Mitte des 12. Jahrhundert wird in Eriskirch eine Kapelle bezeugt. Mit ihrem 60 m hohen spritzen Turm ist die Kirche weithin sichtbar. Während des Dreißigjährigen Krieges war die Kirche schwer beschädigt worden. Danach wurde sie im barocken Stil wieder aufgebaut.
Der Chorraum des frühgotischen Gotteshauses ist mit Seccomalereien ausgemalt, die in der Zeit zwischen 1420 und 1430 entstanden. Aus der gleichen Zeit stammen die beiden bunten Glasfenster im Chor, die durch den Grafen von Montfort gestiftet wurden.
Sehenswert ist die Gnadenmadonna auf dem linken Seitenaltar von 1350. Das Kreuz, die Apostelfiguren, die Kanzel und die Pieta entstammen alle dem Barock.
Das 450ha große Ersikircher Ried ist das größte Naturschutzgebiet am nördlichen Bodenseeufer. Es ist Refugium von hunderten von Wasservögeln sowie 500 verschiedenen nachgewiesenen Pflanzenarten. Bereits 1937 wurde das Ried zum Naturschutzgebiet erklärt. Im Frühsommer färben sich die Wiesen blau durch das Blühen der Iris und der Sibirische Schwertlilie – ein unvergessliches Naturspektakel.
Im Naturschutzzentrum im alten Bahnhof gibt es eine sehenswerte Ausstellung über das Ried und die Artenvielfalt am Bodensee. Hier werden auch Führungen durch die naturbelassene Landschaft angeboten.
Am westlichen Ufer der Schussen bei Oberbaumgarten stand einst eine Burg. Sie wurde um 1180 erbaut und zunächst als Dienstmannensitz genutzt. Zwischen 1271 und 1472 war sie im Besitz der Bischöfe von Konstanz, ehe sie ungenutzt verfiel. Heute sind nur noch wenige Reste des Burgstalls in einem kleinen Hain zu sehen.
Auf dem Gemeindegebiet gibt es noch zwei historische Holzbrücken aus den 1820er Jahren, die über die Schussen führen. Der Fluss stellte zuvor eine natürliche Grenze zwischen den Gemeinden Eriskirch und Oberdorf dar. Die Brücke von Eriskirch wurde 1828 erbaut und fußt beidseitig auf jeweils 96 Holzpfählen, die als Fundament in den sumpfigen Boden geschlagen wurden. Die Holzbrücke von Oberbaumgarten ist sogar noch vier Jahre älter als die Eriskircher Brücke. Beide Übergänge sind überdacht und beide wurden in den 1980er Jahren einer grundlegenden Renovierung unterzogen.
Die barocke Kirche in Mariabrunn wurde zwischen 1746 und 1752 erbaut. Gestiftet wurde sie durch den Grafen Ernst von Monfort zu Tettnang und seiner Gemahlin Gräfin Antonie von Waldburg und Scheer-Dürmetingen. Ein Wallfahrt hatte hier bereits seit dem 15. Jahrhundert bestanden, seit der Fuß eines Hirten geheilt wurde, als dieser ihn in den Gnadenbrunnen getaucht hatte. Insbesondere nach dem Dreißigjährigen Krieg waren Menschenmassen nach Mariabrunn zu der Quelle geströmt. 1823 wurde das Gotteshaus mit dem Zwiebeltürmchen zur Pfarrkirche erhoben. Zwischenzeitlich war die barocke Inneneinrichtung von einer neogotischen ersetzt worden doch mittlerweile wurden die Altäre, die Kanzel und die Bänke wieder im barocken Stil hergerichtet. Sehenswert ist das Deckengemälde von Andreas Brugger aus dem Jahre 1770.
In den 1950er Jahren entstand in einem Wald der 32 m hohe Wasserturm von Eriskirch. Da er von Bäumen verdeckt kaum sichtbar war, störte sich niemand am Anblick des eher hässlichen grauen Betonzylinders. Bedingt durch Straßenbaumaßnahmen stand der Wasserturm plötzlich am Waldrand – für jedermann gut sichtbar! Also wurde die Frage gestellt, ob man das nicht denkmalgeschützte Unikum abreißen oder verschönern solle. Schließlich beauftragte man den einheimischen Künstler Diether F. Domes, der bereits mit zahlreichen Arbeiten im öffentlichen Raum auffiel, den Betonklotz künstlerisch umzugestalten.
Die leuchtend blauen und türkisfarbenen Wellen sollen das Wasser symbolisieren, das eigentlich auf der anderen Seite der Zylinderwand fließt. So wurde aus einem Abrissobjekt ein riesiges, markantes und sehenswertes farbiges Kunstwerk.
Langenargen
m tiefen Südosten Baden-Württembergs liegt Langenargen. Die Gemeinde besitzt mit einer 4 km langen Uferlinie eine der längsten Promenaden am Bodensee, auf der man am Abend wunderschöne Sonnenuntergänge erleben kann. In den Sommermonaten wird der Grünstreifen am Bodensee mit interessanten Freilichtausstellungen zum öffentlichen Kunstpark. Schon die berühmte westfälische Dichterin Annette von Droste-Hülshoff war von Langenargen begeistert und lobte den Ort in ihren Briefen überschwänglich. Das Wahrzeichen der Gemeinde ist das Schloss Montfort, eine auf einer Halbinsel im Bodensee stehende Villa, die Ende des 19. Jahrhunderts vom württembergischen König Wilhelm I. im maurischen Stil errichtet worden ist. Zentrum des ‚Städtles am See‘ ist der Marktplatz, um den sich die barocke Kirche St. Martin mit seiner prachtvollen Ausstattung, das ehemalige Spital ‚Zum heiligen Geist‘, das Museum Langenargen mit seiner umfangreichen Kunstsammlung einheimischer Künstler und der Münzhof gruppieren. Sehenswert ist der historische Hafen mit seinen zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts errichteten Kränen. Zwischenzeitlich konnte sich Langenargen zu einem relativ bedeutenden Handelshafen entwickeln, aber diese Zeit ist mittlerweile vorbei. Heute kann man sich hier führerscheinfreie Motorboote für einen Trip auf dem Bodensee ausleihen.
Ein besonderes Bauwerk ist die über die Argen führende historische Brücke. Die drittälteste Hängebrücke Deutschlands soll – angeblich – auch als Vorbild für die Golden-Gate-Bridge bei San Francisco gedient haben…
Sehenswertes:
 Auf einer Halbinsel im Bodensee steht mit dem märchenhaften Schloss Montfort das Wahrzeichen von Langenargen. Es wurde 1866 im maurischen Stil erbaut und hat damit nichts mehr mit dem namensgebenden Grafengeschlecht derer von Montfort mehr zu tun. Und eigentlich sollte das Gebäude, das vom württembergischen König Wilhelm I. errichtet wurde, ‚Villa Argena‘ heißen, doch sein Sohn, König Karl I. ließ es nach der Fertigstellung wieder umbenennen. Viele bauliche Details, wie die Farbenkombinationen der Ziegel oder die Reliefs zeugen von der orientalisierenden Baukunst. Die Zinnen hingegen zitieren das mitteleuropäische Mittelalter. Das mittig aufgesetzte Türmchen lädt zu einem kleinen Aufstieg ein.
Auf einer Halbinsel im Bodensee steht mit dem märchenhaften Schloss Montfort das Wahrzeichen von Langenargen. Es wurde 1866 im maurischen Stil erbaut und hat damit nichts mehr mit dem namensgebenden Grafengeschlecht derer von Montfort mehr zu tun. Und eigentlich sollte das Gebäude, das vom württembergischen König Wilhelm I. errichtet wurde, ‚Villa Argena‘ heißen, doch sein Sohn, König Karl I. ließ es nach der Fertigstellung wieder umbenennen. Viele bauliche Details, wie die Farbenkombinationen der Ziegel oder die Reliefs zeugen von der orientalisierenden Baukunst. Die Zinnen hingegen zitieren das mitteleuropäische Mittelalter. Das mittig aufgesetzte Türmchen lädt zu einem kleinen Aufstieg ein.
Heute befindet sich das Schloss im Gemeindebesitz. Das Erdgeschoss beherbergt ein Restaurant, im Obergeschoss ist ein Konzertsaal eingerichtet. Die Wände werden mit Bildern aus der Sammlung des Kunstmäzens Günther Grzimek (1887 – 1980) geschmückt.
Der Platz war bereits im 14. Jahrhundert durch die Grafen von Montfort mit einer Burg bebaut worden. Obwohl das Schloss noch im 18. Jahrhundert im barocken Stil um- und ausgebaut wurde, verfiel es nach 1780 zusehends, als die Grafschaft an Österreich verkauft worden war. 1861 wurde die Ruine schließlich abgetragen und durch das heutige Schlösschen ersetzt.
 Am Marktplatz von Langenargen steht die schmucke St. Martinskirche. 1720 ließ Graf Anton III. die Barockkirche als Nachfolgebau für die Fridolinskapelle aus dem 15. Jahrhundert errichten. Der Bau wirkt äußerlich relativ schlicht und wird beherrscht durch den im Norden seitlich hervorstehenden Kirchturm, der 1735 fertig gestellt wurde. Ein ursprünglich geplanter zweiter Kirchturm wurde nie gebaut. An der südwestlichen Außenwand tritt die Marienkapelle mit der gräflichen Loge hervor. Sie war 1728 ergänzt worden. Im Südosten wurde der Kirche das Spital ‚Zum heiligen Geist‘, das heute als Altersheim genutzt wird, angebaut.
Am Marktplatz von Langenargen steht die schmucke St. Martinskirche. 1720 ließ Graf Anton III. die Barockkirche als Nachfolgebau für die Fridolinskapelle aus dem 15. Jahrhundert errichten. Der Bau wirkt äußerlich relativ schlicht und wird beherrscht durch den im Norden seitlich hervorstehenden Kirchturm, der 1735 fertig gestellt wurde. Ein ursprünglich geplanter zweiter Kirchturm wurde nie gebaut. An der südwestlichen Außenwand tritt die Marienkapelle mit der gräflichen Loge hervor. Sie war 1728 ergänzt worden. Im Südosten wurde der Kirche das Spital ‚Zum heiligen Geist‘, das heute als Altersheim genutzt wird, angebaut.
Zahlreiche wertvolle Kunstschätze zieren das Innere der Kirche. Der Chor wird durch den prächtigen Hochaltar ausgefüllt. Die Bilder stammen alle aus dem 18. Jahrhundert. Sehenswert sind die aufwendigen Deckenfresken und die Rosenkranzmedaillons in der Marienkapelle.
In den Sommermonaten findet jeweils donnerstags um 9.45 Uhr eine Führung durch die Pfarrkirche mit anschließendem Orgelkonzert statt.
Die Münzstätte, die Graf Hugo von Montfort 1621 in Langenargen errichten ließ, hatte nicht lange Bestand, denn schon im Dreißigjährigen Krieg wurde das Gebäude wieder zerstört. So entstand 1675 der neue Münzhof mit angegliederter Zehntscheuer, in die die Bauern ihren zehnten Teil der Ernte abführen mussten. Auch dieses Gebäude wurde zerstört, als 1733 ein Feuer die gesamte Anlage vernichtete. So entstand 1735 das heutige Gebäude, das zunächst wiederum als Zehntscheuer, später dann als Stall, als Vereinsheim, als Wohnhaus und als Bauhof diente. Nach einer umfangreichen Sanierung ist der Münzhof heute ein beliebtes kulturelles Zentrum, in dem diverse Veranstaltungen stattfinden. Im Obergeschoss befindet sich eine Bücherei.
Am Marktplatz gegenüber der Pfarrkirche St. Martin befindet sich der ehemalige Pfarrhof, der heute das Museum Langenargen beherbergt. Das zwischen 1735 und 1740 entstandene Gebäude war so baufällig geworden, das es in den 1970er Jahren fast dem Abriss zum Opfer gefallen wäre. Nach einer umfangreichen Sanierung wurde es zum Museum umgestaltet. Die Sammlung präsentiert Zeugnisse aus der Geschichte der Stadt und der Grafschaft Montfort. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Künstler und ihr Werk gelegt, die mit der Stadt eng verbunden sind oder waren. So besitzt das Museum die zweitgrößte Sammlung von Bildern des Malers und Graphikers Hans Purrmann (1880 – 1966). Purrmann, ein Schüler von Henri Matisse und Vertreter des Expressionismus sowie der Klassischen Moderne, lebte eine Zeit lang in Langenargen und entwickelte in seinem Oeuvre einen eigenen unverwechselbaren Malstil. Er beschäftigte sich insbesondere mit Stillleben, Akten, Porträts und Landschaftsgemälden.
Zusätzlich zur ständigen Ausstellung werden in den Sommermonaten verschiedene Wechselausstellungen präsentiert.
Am Rande des Schlossparkes steht das streng symmetrisch konzipierte Kavaliershaus. Das neobarocke Gebäude entstand 1866, als deutlich wurde, dass das Schloss Montfort zu wenig Platz für die Bediensteten sowie für den ‚Cavalier Ihrer Majestät der Königin Mutter und den Cavalier Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich‘ bieten würde. Heute befinden sich im Kavaliershaus ein Café, Ateliers und Wohnungen für Kunststipendiaten sowie einen Veranstaltungsraum im Dachgeschoss.
 Zwischen den Ortschaften von Langenargen und Kressbronn führt der Radweg über ein bedeutendes denkmalsgeschütztes Brückenbauwerk. Die 72 m lange Argenbrücke wurde 1896/97 über das damals noch weitverzweigte Flüsschen Argen gebaut und ist damit die drittälteste Hängebrücke Deutschlands. Einst überquerten hier Pferdefuhrwerke und Automobile den Fluss, heute ist sie den Fußgängern und Fahrradfahrern vorbehalten. In ihrer Konstruktion erinnert sie ein wenig an die Golden Gate Bridge bei San Francisco und angeblich soll sie sogar als Vorbild dafür gedient haben. Nachweise gibt es hierfür jedoch nicht. Und angeblich soll an der Argenbrücke auch der bekannte Ingenieur Othmar Ammann (1879 – 1965) als Lehrling mitgearbeitet haben. Ammann zeigte sich später für den Bau der George-Washington-Brücke in New York verantwortlich. Aber auch dafür fehlen die konkreten Beweise. Fakt dagegen ist, dass ein Modell der Argenbrücke bei der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Zwischen den Ortschaften von Langenargen und Kressbronn führt der Radweg über ein bedeutendes denkmalsgeschütztes Brückenbauwerk. Die 72 m lange Argenbrücke wurde 1896/97 über das damals noch weitverzweigte Flüsschen Argen gebaut und ist damit die drittälteste Hängebrücke Deutschlands. Einst überquerten hier Pferdefuhrwerke und Automobile den Fluss, heute ist sie den Fußgängern und Fahrradfahrern vorbehalten. In ihrer Konstruktion erinnert sie ein wenig an die Golden Gate Bridge bei San Francisco und angeblich soll sie sogar als Vorbild dafür gedient haben. Nachweise gibt es hierfür jedoch nicht. Und angeblich soll an der Argenbrücke auch der bekannte Ingenieur Othmar Ammann (1879 – 1965) als Lehrling mitgearbeitet haben. Ammann zeigte sich später für den Bau der George-Washington-Brücke in New York verantwortlich. Aber auch dafür fehlen die konkreten Beweise. Fakt dagegen ist, dass ein Modell der Argenbrücke bei der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Kressbronn am Bodensee
m äußersten südöstlichen Ende von Baden Württemberg liegt an der Grenze zu Bayern die Gemeinde Kressbronn. Die westliche Gemeindegrenze bildet der Fluss Argen. Die drittälteste Hängebrücke Deutschlands verbindet Kressbronn mit der Nachbargemeinde Langenargen. Das Gebiet wurde bereits von den Römern besiedelt, ehe diese von den Alemannen vertrieben wurden. Die wurden dann wiederum von den Franken besiegt. Im Mittelalter beherrschten dann die Grafen von Montfort das Argengau.
Kressbronn liegt malerisch zwischen Obstgärten und Weinhängen am Nordufer des Bodensees. Die Gemeinde besitzt einen ausgesprochen ländlichen Charakter. Einige Ortsteile sind nur kleine Ansiedelungen. In der sanften Hügellandschaft haben sich noch mehrere alte Kapellen aus dem 16. bzw. 17. Jahrhundert erhalten. Die größte Kirche am Rathausplatz des Kernortes ist allerdings erst in der 1930er Jahren entstanden. Aber die Pfarrkirche ‚Maria Hilfe der Christen‘ zählt zu den wichtigsten Kirchenbauten Württembergs zwischen den Weltkriegen und als Vorläufer der Moderne.
Sehenswert sind das Museum im Schlössle mit seiner Schiffsmodellausstellung und das gotische Schloss Gießen im Norden der Gemeinde. Zahlreiche Wander- und Radwanderwege führen von wunderschönen Aussichtspunkten zu malerischen Ecken am türkisenen Wasser des Bodensees und machen Kressbronn damit zu einem idyllischen und lohnenden Ausflugsziel.
Sehenswertes:
Die Ursprünge dieser mittelalterlichen Burganlage sind nicht genau zu datieren. Vermutlich entstand die Wasserburg im frühen 13. Jahrhundert. Eine erste urkundliche Erwähnung findet sich allerdings erst 1357. Zunächst bestand die Anlage vermutlich aus einer Turmhügelburg, die für die Sicherung des Argenüberganges zuständig war. 1482 – 86 wurde die Burg zu einem wehrhaften Schloss ausgebaut, dass bis heute nur noch wenig verändert wurde. Auch die markanten gotischen Treppengiebel entstammen dieser Ausbauphase. Zwischen 1405 und 1810 befand sich die Anlage im Besitz des Lindauer Heilig-Geist Spitals. In der Folgezeit diente das Schloss als Bauerngut und auch heute befindet es sich im privaten Besitz. Der derzeitige Schlossherr öffnet das Anwesen für kleinere kulturelle Veranstaltungen sowie für Besichtigungen vorher angemeldeter Gruppen.
Ein altes Dokument von 1412 belegt bereits die Existenz eine Pfarrkirche im Dorf Gattnau. Diese war jedoch im 18. Jahrhundert derartig baufällig geworden, dass man sie durch einen 1793 fertig gestellten Neubau ersetzte. Der Turm der alten Kirche blieb dabei allerdings erhalten. Im Jahre 1903 wurde das Kirchenschiff durch den westlichen Vorbau erweitert und gleichzeitig erhöht. Im Zuge der Umbauarbeiten entstanden auch die Deckengemälde im Inneren der Kirche. Die schlichte Inneneinrichtung entstammt den 1960er Jahren.
Die erst 1936/37 erbaute katholische Pfarrkirche ist zwar noch relativ jung, gehört aber zu den wichtigsten Kirchenbauten Württembergs zwischen den Weltkriegen. Das Gotteshaus in der Ortsmitte Kressbronns wird geprägt durch seinen markanten und eigenwilligen Kirchturm. Dieser steht seitlich versetzt im Süden des Saalbaus und wird von einer Weltkugel bekrönt. So erinnert der Glockenturm entfernt an einen barocken Zwiebelturmaufsatz. Ansonsten verweist der Kirchenbau bereits auf die Architektur der Moderne.
In der Ortsmitte Kressbronns befindet sich der Rathausplatz. Hier stehen mit der Pfarrkirche Maria hilft den Christen und der Eligiuskapelle gleich zwei sehenswerte Kirchengebäude.
Die spätbarocke Kirche St. Eligius wurde 1748 in ihrer heutigen Form mit dem sechseckigen Zwiebeltürmchen fertig gestellt. Zuvor war die Kapelle 1663 geweiht und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch den Grafen von Montfort erneuert worden. Seit den 1950er Jahren dient das kleine Gotteshaus als Gedenkstätte für gefallene Soldaten.
Das Kressbronner Schlössle ist eine zweigeschossige Villa mit viergeschossigem Turm aus dem Jahre 1829 und liegt in einem hübschen Park mit uraltem Baumbestand. Es beherbergt eine Ausstellung des Kunsthandwerkers Ivan Trtanj (*1945). Der aus Serbien stammende Trtanj schuf in jahrzehntelanger Bastelleidenschaft die Abbilder verschiedener historischer Schiffe. Die detailgetreuen großen Modelle führte er zum größten Teil nach Originalplänen aus. Zu den Schiffsnachbildungen gehören Schaluppen, Fregatten, Segler, Frachtschiffe und staatliche Jachten verschiedener europäischer Königshäuser. Dabei entstanden einzigartige Schiffsportraits mit einem hohen historischen Dokumentationswert. Die außergewöhnliche Sammlung wird durch Gemälde sowie maritime Ausrüstungsgegenstände und Navigationsinstrumente, wie Sextanten und Kompasse ergänzt.
In Retterschen hat sich eine vollständige alte Hofanlage erhalten. Der Schultheißenhof wurde inzwischen als Museumsanlage umgestaltet und bietet einen interessanten Einblick in die Geschichte und die Entwicklung der Landwirtschaft in dieser Region. Die Hofanlage bestand bereits im ausgehenden 8. Jahrhundert. Letzte Bewohnerin war bis 1992 die Kriegswitwe Theresia Milz, bevor die Gemeinde den Hof übernahm. Nach ihr wurde die heutige Museumsanlage, die aus vier historischen Gebäuden besteht, benannt. Sie gibt einen umfassenden Überblick über das Leben auf einem Bauernhof in den letzten Jahrhunderten. Das Haupthaus entstand 1855. Hier befanden sich neben den Wohnräumen auch die Stallungen und die Amtsstube der Gemeindeverwaltung. Die originale Ausstattung dokumentiert den Zustand des Hauses in den 1940er Jahren. Die Remise wurde 1803 als Wagenschuppen erbaut, die Scheuer entstand 1717 als Getreidelage mit einem Weinkeller. Im 1705 errichteten Backhaus wurden nicht nur Brote hergestellt. Das Gebäude diente auch als Ort zum Waschen, Schlachten und Schnaps brennen.
Die Hofstelle wird ergänzt durch einen neu angelegten Bauerngarten sowie einen Obstgarten mit 30 verschiedenen Apfel- und Birnbäumen. Sie kann allerdings nur im Rahmen von Führungen oder Veranstaltungen besichtigt werden.
Die Sebastianskapelle im Kressbronner Ortsteil Betznau wurde 1600 durch Graf Johann III. von Montfort gestiftet. 1696 erhielt sie bei einer Erweiterung den seitlich angebauten Kirchturm. Im Laufe der Zeit wurde das Gotteshaus mehrfach durch Kunsträuber geplündert, so blieben nur das Glasfensterbild und eine 1617 gegossene Glocke von der historischen Ausstattung erhalten. Bemerkenswert ist das Deckengemälde mit der Darstellung der Heiligen Familie, das von 1906 stammt.
Die katholische Mariä-Himmelfahrts-Kapelle im Kressbronner Ortsteil Schleinsee wurde 1737 im Stil des Barock erbaut. Zu der Inneneinrichtung gehört neben dem Hauptaltar zwei Nebenaltäre sowie Holzskulpturen der Heiligen Johannes von Nepomuk und Franz Xaver.
Die 1659 erbaute Kapelle in Turnau ist ein schlichter Saalbau mit einem aufgesetzten Glockentürmchen, der von Graf Hugo von Montfort gestiftet wurde. Im Inneren des Gotteshauses fällt das Deckengemälde auf, das den Tod des Hl. Josef darstellt.
In unmittelbarer Nachbarschaft zu der Kapelle steht das ehemalige Kaplaneihaus. Der von der Gräfin Maria Anna Leopoldine von Montfort gestiftete zweigeschossige Steinbau wurde 1728 erbaut.
Radrouten die durch Kressbronn führen:
Nonnenhorn
er bayrische Luftkurort Nonnenhorn liegt malerisch am Nordufer des Bodensees. Die kleine Gemeinde wird geprägt vom Wein- und Obstanbau – schließlich ist Nonnenhorn ein bekannter Weinort. Die beliebtesten Rebsorten sind Müller-Thurgau, Bacchus, Spätburgunder und Spätburgunder-Weißherbst. Erholsame Ruhe und Gastlichkeit werden in dem Dorf in Schwaben großgeschrieben. Das milde Seeklima und der Sonnenreichtum locken viele Erholungssuchende an. Dem Besucher wird ein weites Netz an Wander- Radwanderwegen geboten, das Strandbad ist sogar beheizt.
Das im 9. Jahrhundert gegründete Nonnenkloster wurde zur Keimzelle der heutigen Gemeinde, die später unter Fuggerschen Herrschaft geriet, dann zu Österreich und 1805 schließlich zum Königreich Bayern kam.
Der hübsche rechteckige Kapellenplatz markiert das historische Ortszentrum Nonnenhorns. Die spätgotische St. Jakobus-Kapelle steht heute gemeinsam mit dem hofartigen Platz unter Denkmalsschutz. Bemerkenswert ist der Weintorkel von 1591. Er befindet sich in einem offenen Holzhaus und ist die älteste und größte Weinpresse in der gesamten Bodenseeregion.
Sehenswertes:
Unter einem gewaltigen Mammutbaum am historischen Zentrum des Dorfes steht die kleine St. Jakobus-Kapelle. Der spätgotische Kirchenbau entstand im 13. Jahrhundert. Zu der Ausstattung gehören eine Kreuzigungsgruppe von 1646 und die hübschen aus Holz geschnitzten Figuren aus dem 15. und 17. Jahrhundert. Bei mehreren Umbauten wurde die Kapelle jedoch erheblich verändert. So stammen der neugotischen Hochaltar und die Fenster erst aus dem 19. Jahrhundert.
Gemeinsam mit dem malerischen, rechteckigen Kapellenplatz steht das Gotteshaus unter Denkmalsschutz. Die zweistöckigen Gebäude am Platz stammen aus dem späten 18. bzw. frühen 19. Jahrhundert. Am Eingang der Jakobuskapelle steht ein ‚Seegfrörne-Stein‘. Der große Findling wurde bei der Seegfrörne im Winter 1880 aus dem See geborgen und erinnert an das damalige außergewöhnliche Ereignis.
Hinter der Szenerie: Die Seegfrörne Der Begriff ‚Seegfrörne‘ stammt aus dem alemannischen und benennt den Zustand, wenn der Bodensee vollständig von einer geschlossenen und tragenden Eisschicht bedeckt ist. So häufig kommt das nicht vor. Erstmals wurde im Jahre 875 von einem solchen spektakulären Ereignis berichtet. Nur 33 Mal soll sich diese Besonderheit seitdem wiederholt haben. Die Seegfrörne schafft immer wieder freundschaftliche Verbindungen zwischen den Menschen am nördlichen und südlichen Seeufer. Bei der letzten Seegfrörne im Winter 1962/63 tummelten sich Zehntausende auf dem zugefrorenen See, einige sogar mit ihrem PKW. Der Gemeinderat von Nonnenhorn ließ es sich nicht nehmen, auf dem Eis zu tagen. Auch 1573 gab es eine Seegfrörne, im hochalemannischen als ‚Seegfrörni‘ bezeichnet. Damals wurde bei einer feierlichen Eisprozession eine Büste des hl. Johannes über den Bodensee getragen. Seitdem wird jedes Mal, wenn der See zugefroren ist, die Büste zwischen dem schweizerischen Kloster Münsterlingen und dem deutschen Hagnau hin und her getragen. Bei der einen Seegfrörne kommt sie nach Deutschland, bei der nächsten wird sie zurück in die Schweiz geholt. Seit 1963 steht die Büste in der Schweiz.
In einem offenen Holzhaus in der Conrad-Forster-Straße befindet sich eine historische, unter Denkmalschutz stehende Traubenpresse. Der Weintorkel wurde 1591 erbaut und ist damit die älteste und größte Weinpresse in der gesamten Bodenseeregion. Zum letzten Male wurde hier 1955 die Traubenernte gepresst. Während des Pressvorganges lastete ein gewaltiges dreiteiliges Eichenbalkenlager mit unvorstellbaren 20.000 kg Gewicht auf den Trauben. Ein Torkelmeister und vier Männer waren für den Betrieb notwendig. In den Sommermonaten erklären Winzer jeweils mittwochs den Arbeitsablauf an der Kelter.
Das vom Museumsverein Nonnenhorn betriebene Dorfmuseum präsentiert eine heimatgeschichtliche Ausstellung, die Exponate aus dem Obst- und Weinanbau sowie des örtlichen Handwerks präsentiert. Das Museum öffnet in den Sommermonaten jeweils am Mittwoch.
Wasserburg (Bodensee)
uf der malerischen Halbinsel am Nordufer des Bodensees befindet sich ein wunderschönes historisches Ensemble, bestehend aus Schloss, St. Georgskirche und dem Malhaus, einem ehemaligen Gerichtsgebäude, das heute ein Heimatmuseum beherbergt. Hier führt auch ein langer Steg zum Anleger, wo die Passagierschiffe nach Konstanz, Bregenz und Rorschach abfahren. Einst war Wasserburg im 10. Jahrhundert eine Inselfestung und diente den Klosterherren von St. Gallen als Zufluchtsort. Das heutige Renaissanceschloss entstand im 16. Jahrhundert. Als die Fugger 1720 einen Damm zu dem Schloss aufschütten ließen, wurde Wasserburg zu einer Halbinsel, die mittlerweile über eine breite Fläche mit dem Festland verbunden ist. Heute lebt die bayrische Gemeinde vorwiegend vom Tourismus sowie vom Obst- und Weinanbau. Seit 2014 betreibt der Kunstverein Wasserburg am Bodensee e.V. im ehemaligen Bahnhof den ‚Kunstbahnhof KUBA‘, wo neben Ausstellungen auch andere kulturelle Veranstaltungen stattfinden.
Sehenswertes:
Noch bis 1720 war Wasserburg eine Insel, in deren Zentrum die befestigte Wehrburg stand. Eine erste Burganlage war 925 entstanden, eine ab 1280. Im Nordostflügel sind Teile aus dieser Zeit noch erhalten. Das heutige Schloss entstand zwischen 1537 und 1555 im Stil der Renaissance durch die Grafen von Montfort. Die nachfolgenden Besitzer, die Grafen Fugger, ließen das Anwesen zu einer Dreiflügelanlage ausbauen. Als 1750 jedoch ein Feuer den gesamten Westflügel vernichtete, wurde dieser nicht wieder aufgebaut. Heute befindet sich in dem historischen Gemäuer ein Hotelrestaurant.
Auf der heutigen Halbinsel sind neben dem Schloss, der St. Georgskirche mit dem Pfarrhof und dem Malhaus noch das ehemalige Torggel von 1820 und die Villa am See mit ihrem Treppengiebel aus der Neorenaissance erhalten. Gemeinsam bilden die Gebäude ein prächtiges Ensemble.
Bereits 784 wurde auf der damaligen Insel eine Kirche erwähnt, die wahrscheinlich aus Holz bestanden hat. Um 1400 entstand ein steinernes gotisches Kirchengebäude, von dem der Chor sich erhalten hat. Der übrige barocke Bau und der markanten Turm mit der welschen Haube entstanden im 17. Jahrhundert. Sehenswert sind der barocke Hochaltar sowie die Deckenmalereien, die aber erst 1919 entstanden und Begebenheiten aus der Geschichte Wasserburgs abbilden.
Neben der St. Georgskirche steht das alte katholische Pfarrhaus, das im Kern noch von 1550 stammt und 1880 zu einem zweiflügligen Gebäude erweitert wurde. Ein Bogengang verbindet das Pfarrhaus mit der Kirche.
Das Malhaus wurde 1597 als Gerichtsgebäude der Grafen Fugger erbaut. Im 18. Jahrhundert diente es als Schulgebäude, seit 1979 beherbergt das Malhaus ein Museum, das sich mit der Fischerei auf dem Bodensee, der hiesigen Hexenverfolgung und mit zwei berühmten Schriftstellern auseinandersetzt, die mit Wasserburg in enger Verbindung stehen.
Martin Walser wurde 1927 in Wasserburg geboren und wuchs auch hier auf. Der bedeutende Schriftsteller wurde bekannt durch seine Romanen und Erzählungen, die geprägt waren von den inneren Konflikten seiner Antihelden.
Horst-Wolfram Geißler (1893 – 1983) ist Ehrenbürger der Gemeinde Wasserburg und wurde auch hier beigesetzt. Seine berühmte Romanfigur, den ‚lieben Augustin‘, ließ Geißler im benachbarten Pfarrhaus aufwachsen.
Die sogenannte ‚Gfrörnenkapelle‘ war 1643 ursprünglich wohl als Pestkapelle errichtet worden. Sie besteht aus Sandsteinblöcken, Feldsteinen und Bodenseewacken, auch Bollersteine genannt. Zu der Inneneinrichtung gehören eine Madonnenstatue und die Figur des hl. Leonhard. Die kleine unscheinbare Kapelle war 2004 grundlegend saniert worden.
Auf einem eiszeitlichen Moränenhügel hoch über dem Bodensee steht die barocke Antoniuskapelle. Sie entstand 1696 nach Nachfolgebau für eine Einsiedelei, die es bereits im 15. Jahrhundert gegeben hatte. Zu der Ausstattung gehören eine gotische Madonna und mehrere barocke Skulpturen.
Lindau (Bodensee)
ie ehemalige freie Reichsstadt Lindau liegt am nordöstlichen Ufer des Bodensees im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz. Die auf einer Insel im Bodensee liegende Altstadt Lindaus blieb von Kriegsschäden weitgehend verschont und konnte so ihren spätmittelalterlichen Charme bewahren. Sie bietet eine Vielzahl von historischen Sehenswürdigkeiten und ist vom Straßenverkehr weitgehend befreit. Auch das Fahrradfahren ist hier nicht erlaubt – aber auch nicht notwendig, denn man kann die Insel auch gut zu Fuß erkunden. Die Altstadt wird im Sommer von so vielen Touristen bevölkert, sodass das Radfahren ohnehin schwierig wäre. Die Hauptstraße der Insel ist die Maximilianstraße mit vielen gut erhaltenen historischen Bürgerhäusern. Am Marktplatz stehen das katholische Münster und die evangelische St. Stephanskirche einträchtig nebeneinander. Auf der anderen Seite steht mit dem Haus zum Cavazzen eines der hübschesten Bürgerhäuser der gesamten Bodenseeregion. Ein beliebtes Fotomotiv ist auch das Rathaus aus dem 15. Jahrhundert mit seinen auffälligen Wandmalereien. Am direkt daneben stehenden Neuen Rathaus erklingt täglich um 11:45 Uhr ein hübsches Glockenspiel. Mit dem Mangturm, dem Diebsturm und dem Pulverturm sind noch drei Wehr- und Wachtürme der alten Stadtbefestigung erhalten. Das Wahrzeichen Lindaus ist der Hafen mit seiner vielbelebten Hafenpromenade. Hier legen auch die Kursschiffe an, mit denen man nach Bregenz, Rorschach und Friedrichshafen kommen kann. Die Hafenausfahrt mit dem großen Leuchtturm und der Statue des Bayrischen Löwen vor dem smaragdgrünen Bodenseewasser ist ebenfalls ein viel fotografiertes Motiv. Die Insel ist mit dem Festland über einen Eisenbahndamm, den man auch als Radler nutzen kann und eine Straßenbrücke verbunden.
Auf dem Festland besitzt die bayrische Stadt Lindau einen sieben Kilometer langen Bodenseeuferstreifen. Hier in den Ortsteilen Bad Schachten und Aeschach befinden sich direkt am See noch einige alte herrschaftliche Schlösschen und Villen, die überwiegend aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert stammen, teilweise aber noch sehr viel älter sind.
Sehenswertes:
 Die auf einer Insel im Bodensee liegende Altstadt Lindaus blieb von Kriegsschäden weitgehend verschont und konnte so ihren spätmittelalterlichen Charme bewahren. Sie bietet eine Vielzahl von historischen Sehenswürdigkeiten, die man am besten zu Fuß abklappern und entdecken kann. Die Hauptstraße der Insel ist die Maximilianstraße mit ihren vielen gut erhaltenen historischen Bürgerhäusern. Am Marktplatz stehen das katholische Münster und die evangelische St. Stephanskirche einträchtig nebeneinander. Auf der anderen Seite steht mit dem Haus zum Cavazzen eines der hübschesten Bürgerhäuser der gesamten Bodenseeregion. Ein beliebtes Fotomotiv ist auch das Rathaus aus dem 15. Jahrhundert mit seinen auffälligen Wandmalereien. Mit dem Mangturm, dem Diebsturm und dem Pulverturm sind noch mehrere Wehr- und Wachtürme der alten Stadtbefestigung erhalten. Im Süden endet die Altstadt an der vielbelebten Hafenpromenade.
Die auf einer Insel im Bodensee liegende Altstadt Lindaus blieb von Kriegsschäden weitgehend verschont und konnte so ihren spätmittelalterlichen Charme bewahren. Sie bietet eine Vielzahl von historischen Sehenswürdigkeiten, die man am besten zu Fuß abklappern und entdecken kann. Die Hauptstraße der Insel ist die Maximilianstraße mit ihren vielen gut erhaltenen historischen Bürgerhäusern. Am Marktplatz stehen das katholische Münster und die evangelische St. Stephanskirche einträchtig nebeneinander. Auf der anderen Seite steht mit dem Haus zum Cavazzen eines der hübschesten Bürgerhäuser der gesamten Bodenseeregion. Ein beliebtes Fotomotiv ist auch das Rathaus aus dem 15. Jahrhundert mit seinen auffälligen Wandmalereien. Mit dem Mangturm, dem Diebsturm und dem Pulverturm sind noch mehrere Wehr- und Wachtürme der alten Stadtbefestigung erhalten. Im Süden endet die Altstadt an der vielbelebten Hafenpromenade.
 Nicht weit entfernt vom Hafen befinden sich die beiden Rathäuser von Lindau. Das alte Rathaus wurde bereits 1422 im gotischen Stil erbaut, 1576 aber im Renaissancestil umgestaltet. Der auffällige Treppengiebel stammt noch aus dieser Zeit. Im 19. Jahrhundert entstand die Wandmalerei an der Außenfassade mit Szenen aus der Geschichte Lindaus. Der gotische Ratssaal war ein Ort, in dem Geschichte geschrieben wurde: hier tagte in den Jahren 1496 und 97 der Reichstag.
Nicht weit entfernt vom Hafen befinden sich die beiden Rathäuser von Lindau. Das alte Rathaus wurde bereits 1422 im gotischen Stil erbaut, 1576 aber im Renaissancestil umgestaltet. Der auffällige Treppengiebel stammt noch aus dieser Zeit. Im 19. Jahrhundert entstand die Wandmalerei an der Außenfassade mit Szenen aus der Geschichte Lindaus. Der gotische Ratssaal war ein Ort, in dem Geschichte geschrieben wurde: hier tagte in den Jahren 1496 und 97 der Reichstag.
Das Erdgeschoss diente einst als offene Markthalle. Heute befindet sich hier die Reichstädtische Bibliothek. Das Franziskanerkloster in Lindau besaß seiner Zeit eine herausragende und wertvolle Bibliothek mit 15.00 Handschriften, Drucken und Dokumenten. Im Zuge der Reformation wurde jedoch das Kloster 1528 aufgelöst. So gelangte der Bestand als Reichstädtische Bibliothek zum Stadtarchiv.
Das Neue Rathaus steht gleich neben seinem Vorgängerbau. Täglich um 11:45 Uhr ertönt hier ein hübsches Glockenspiel.
 Mit seinen buntglasierten Ziegeln ist der Mangturm am Hafen eines der Wahrzeichen von Lindau. Der Wehrturm, der bereits aus dem 12. Jahrhundert stammt und auf einem quadratischen Grundriss steht, erhielt seine markante spitze Dachbedeckung allerdings erst im 19. Jahrhundert. Bis dahin war der Turm auch nur über eine Zugbrücke zu erreichen. Einst befand sich neben dem Turm ein Tuchlager mit einer Mangel – so bekam das 20 m hohe Gebäude seinen Namen.
Mit seinen buntglasierten Ziegeln ist der Mangturm am Hafen eines der Wahrzeichen von Lindau. Der Wehrturm, der bereits aus dem 12. Jahrhundert stammt und auf einem quadratischen Grundriss steht, erhielt seine markante spitze Dachbedeckung allerdings erst im 19. Jahrhundert. Bis dahin war der Turm auch nur über eine Zugbrücke zu erreichen. Einst befand sich neben dem Turm ein Tuchlager mit einer Mangel – so bekam das 20 m hohe Gebäude seinen Namen.
 Der Rundturm mit seinen vier markanten sechseckigen Dachtürmchen erhielt seinen Namen, weil er einst als Gefängnisturm diente. Daneben wurde er auch als Wachturm genutzt. Er wurde 1380 am westlichsten Ende der Altstadt als Teil der Stadtbefestigung erbaut.
Der Rundturm mit seinen vier markanten sechseckigen Dachtürmchen erhielt seinen Namen, weil er einst als Gefängnisturm diente. Daneben wurde er auch als Wachturm genutzt. Er wurde 1380 am westlichsten Ende der Altstadt als Teil der Stadtbefestigung erbaut.
Der runde weiß getünchte Wehrturm mit dem Zeltdach wurde 1508 am äußersten westlichen Rand der Insel Lindau erbaut. Er diente als Teil der bereits existierenden Stadtbefestigung sowohl als Wach- und Wehrturm als auch als Lagerstätte für Schwarzpulver und als Magazin. Heute wird das Turmgebäude, das direkt an das Wasser des Bodensees grenzt, als Veranstaltungsort für Tagungen und Sitzungen genutzt.
So schlicht das Münster mit dem hohen weißen Turm von außen auch wirkt, so prachtvoll ist es im Inneren ausgestattet. Das zwischen 1748 und 1752 in der Zeit des Spätbarocks entstandene Gotteshaus diente zunächst als Klosterkirche eines Kanonissenstiftes, das sich hier im frühen Mittelalter um 810 angesiedelt hatte und das zur Urzelle der Stadt Lindau wurde. Bereits 1802 wurde der Orden im Zuge der Säkularisierung aufgelöst. Das Münster wird seitdem als katholische Stadtpfarrkirche genutzt.
Sehenswert ist die üppige Innengestaltung im Stil des Rokoko mit reich verzierten Säulen, kunstvollen farbigen Fresken und weißen Stuckaturen, dem Hochaltar sowie die große golden glänzende Orgel auf der Westempore, die allerdings erst aus dem frühen 20. Jahrhundert stammt. An der Decke prangt ein Gemälde, das die Aufnahme Marias in den Himmel darstellt.
 Die wuchtig wirkende evangelische St. Stephanskirche befindet sich am Marktplatz gegenüber der Stiftskirche und direkt neben dem Münster Unserer Lieben Frau. Das 1180 erbaute dreischiffige Gotteshaus wurde 1528 im Zuge der Reformation protestantisch. Lindau folgte zunächst dem Bekenntnis des Schweizer Reformators Huldrych Zwingli. So fällt der Innenraum der Kirche bis auf die Rokokoaltäre betont schlicht aus.
Die wuchtig wirkende evangelische St. Stephanskirche befindet sich am Marktplatz gegenüber der Stiftskirche und direkt neben dem Münster Unserer Lieben Frau. Das 1180 erbaute dreischiffige Gotteshaus wurde 1528 im Zuge der Reformation protestantisch. Lindau folgte zunächst dem Bekenntnis des Schweizer Reformators Huldrych Zwingli. So fällt der Innenraum der Kirche bis auf die Rokokoaltäre betont schlicht aus.
Die älteste Kirche Lindaus ist die Kirche St. Peter am Schrannenplatz. Sie stammt aus dem frühen Mittelalter (um 1000) und diente einst den einheimischen Fischern als Wehrkirche. Daher wird sie hier noch heute als Fischerkirche bezeichnet. Der wuchtige Turm zeugt noch von der einstigen schutzhaften Bestimmung. Heute finden hier keine Gottesdienste mehr statt. Die Peterskirche dient jetzt als Kriegsgedenkstätte. Besonders beachtenswert sind die alten wertvollen Rötelzeichnungen im Inneren der Kirchen sowie 18 Gemälde, die zwischen 1485 und 1490 entstanden sind.
Das Stadttheater in Lindau ist eine umgebaute Kirche mit einer sehr vielfältigen Vergangenheit. Im 13. Jahrhundert gründeten Barfüßermönche hier ein Franziskanerkloster. 1380 wurde die Klosterkirche fertig gestellt. Doch als die Reformation 1528 in Lindau Einzug hielt, wurde das Kloster geschlossen. Die alte Klosterkirche diente nun in der Folgezeit als Lagerstätte für Salz, als evangelische Kirche, als Kaserne, als Waffenmagazin und als Bibliothek. 1887 zog in das ehemalige Gotteshaus schließlich das Stadttheater ein.
 Das Wahrzeichen Lindaus ist der Hafen. An seiner bekannten und viel fotografierten Hafeneinfahrt bewacht der Bayrische Löwe das maritime Geschehen. Die Statue des Löwen misst stattliche 6 Meter. Gegenüber steht der 33 Meter hohe Leuchtturm. Von der Aussichtsplattform hat man einen wundervollen Ausblick über das smaragdgrüne Wasser des Bodensees bis hin zu den Schweizer und Vorarlberger Alpen. Im Hafen legen die Kursschiffe an, die die bayrische Bodenseeinsel mit Bregenz, Rorschach und Friedrichshafen verbinden.
Das Wahrzeichen Lindaus ist der Hafen. An seiner bekannten und viel fotografierten Hafeneinfahrt bewacht der Bayrische Löwe das maritime Geschehen. Die Statue des Löwen misst stattliche 6 Meter. Gegenüber steht der 33 Meter hohe Leuchtturm. Von der Aussichtsplattform hat man einen wundervollen Ausblick über das smaragdgrüne Wasser des Bodensees bis hin zu den Schweizer und Vorarlberger Alpen. Im Hafen legen die Kursschiffe an, die die bayrische Bodenseeinsel mit Bregenz, Rorschach und Friedrichshafen verbinden.
Am Marktplatz steht das ‚Palais zum Cavazzen‘, das seit 1929 das Stadtmuseum beherbergt. Das Haus gilt als eines der schönsten barocken Bürgerhäuser am Bodensee und wurde 1728 erbaut. Die Ausstellung besitzt einen stadtgeschichtlichen Teil mit Alltagsgegenständen, Möbeln, Musikinstrumente und einer historischen Waffensammlung sowie eine stattliche Kunstsammlung von Gemälden und Skulpturen aus dem 15. bis 19. Jahrhundert. Besonders sehenswert ist das spätgotische Tafelgemälde ‚Lindauer Beweinung‘ von 1420. In den Sommermonaten finden wechselnde Sonderausstellungen statt.
Im reizenden Innenhof mit seinem Melusinenbrunnen befindet sich das Museumscafé ‚Il Cavazzo‘.
Direkt am Bodenseeufer von Schachen stehen einige stolze herrschaftliche Villen. Die größte und bedeutendste ist die Villa Lindenhof. Sie wurde 1842 – 1845 zusammen mit dem weitläufigen Lindenhofpark für den Großkaufmann Friedrich Gruber erbaut und angelegt. Das Gelände befindet sich heute im Besitz der Stadt. In den Salonräumen finden häufig kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen und Konzerte statt.
Im Ostflügel der Villa befinden sich die Friedensräume. Diese Ausstellung verfolgt ein besonderes museales Konzept, denn die gezeigten Gemälde, Skulpturen und Objekte sollen zum Nach- und Überdenken auffordern und die eigene Phantasie anregen. Der Besucher wird zum sinnlichen Erleben und zum interaktiven Mitmachen eingeladen.
Der Lindauer Stadtteil Schachten liegt direkt am Bodenseeufer. Hier befinden sich direkt am See einige herrschaftliche Villen. Das Schachen Schlössle liegt allerdings etwas landeinwärts. Der historische Bau mit seinem markanten runden Türmchen stammt noch aus dem 15. Jahrhundert und diente zunächst der Verteidigung der freien Reichsstadt Lindau. Heute beherbergt das Schlössle ein Hotel mit Restaurant.
Das Anwesen ‚Alwind‘ wurde bereits im 14. Jahrhundert erstmals erwähnt. Die Herren von Höcht errichteten Mitte des 15. Jahrhunderts ein kleines Schlösschen, das aber heute nicht mehr existiert. Die heutige Villa Alwind wurde 1852/53 als Sommerresidenz für die Herren von Gruber im klassizistischen Stil erbaut. Lange Jahrzehnte blieb es jedoch unbewohnt, ehe es 1905 vom Textilindustriellen König erworben wurde. Heute wird das Gebäude als Erholungsheim für Mitarbeiter der Post, der Postbank und der Telekom genutzt.
Zwischen 1900 und 1902 entstand am Bodenseeufer die Villa Wacker. Der Geschäftsmann Alexander Wacker ließ sie aus Rotsandstein im Stil des Historismus errichten. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Anwesen als Erholungsheim, ehe es 1986 in den Besitz von Uwe Holy, dem ehemaligen Inhaber von Hugo Boss und Enkel des Firmengründers, überging.
Auf dem Gipfel des Hoyerberges steht majestätisch das Gruber-Schlösschen. Von hier aus hat man einen herrlichen Ausblick über den Bodensee. Es wurde 1854 als Villa mit einem freistehenden Türmchen erbaut. Die Familie Gruber, die auch schon die Villa Lindenhof besaß, verkaufte das Anwesen mit dem Weinberg im Jahre 1917 an die Gemeinde Hoyren. Heute beherbergt das Schlösschen ein Restaurant.
Die Villa ‚Schloss Holdereggen‘ in Aeschach wurde 1887 – 90 durch den Unternehmer Hermann Nährer erbaut. Auch zuvor hatte an dieser Stelle bereits eine Villa gestanden. Der neue zweistöckige Herrensitz wurde aus Rotsandstein im Stil der Neorenaissance errichtet. Anfang des 20. Jahrhunderts ging Nährer aber bankrott und das schlossartige Villengebäude ging in den Besitz der Familie Bougier/Seisser über. In der Folgezeit diente die Villa als Lazarett im Ersten Weltkrieg, später als höhere Mädchenschule – was dem Gebäude im Volksmund den Beinamen Jungfernburg einbrachte – und schließlich als Musikschule.
Der Ursprung des heutigen Schlosses im Stadtteil Aeschach ist eine erstmals im 14. Jahrhundert erwähnte Wasserburg. Sie gehörte zunächst den Grafen von Montfort, wechselte im Laufe der Geschichte aber häufig den Besitzer. Das Anwesen, zu dem auch eine Mühle und eine Kapelle gehörte, wurde zwischen 1551 und 1569 zum Schloss ausgebaut. Das Hauptgebäude ist aus dieser Zeit noch erhalten, die Nebengebäude stammen aus der Zeit des Barock. Ein kleiner Weiher erinnert noch an den einst von Wassergräben umgebenen Adelssitz, der auch heute noch privat bewohnt wird und daher nicht öffentlich zugänglich ist.
Radrouten die durch Lindau führen:
Bregenz
ie Hauptstadt des östlichsten österreichischen Bundeslandes Vorarlberg liegt direkt am Bodensee und besitzt einen der wichtigsten Bodenseehäfen.
Die ersten Siedlungsspuren sind bereits 4.500 Jahre alt. Unter den Kelten entstand hier bereits eine größere Ortschaft. Im Mittelalter erhielt Bregenz als erste Stadt am Bodensee das Stadtrecht. Reste der alten Stadtmauer haben sich noch bis heute erhalten. Die historische Altstadt teilt sich in eine geschäftige und moderne Unterstadt sowie in eine historische Oberstadt mit mittelalterlicher bzw. barocker Bausubstanz. Der Martinsturm mit der größten Turmzwiebel Mitteleuropas gilt als Wahrzeichen von Bregenz. Das bekannteste Bauwerk der Landeshauptstadt ist aber die Seebühne im Bodensee. Sie ist die größte Seebühne der Welt, die alljährlich stattfindenden Bregenzer Festspiele genießen Weltruhm. Weitere kulturelle Highlights sind das Kunsthaus Bregenz mit seiner außergewöhnlichen Sammlung zeitgenössischer Kunst und das vorarlberg museum, das sich um das kunst- und kulturgeschichtliche Erbe Vorarlbergs kümmert. Die unverbaute Uferpromenade bietet einen traumhaften Blick auf den See, der neu gestaltete Hafen mit seinen Treppenterrassen lädt zu einer kleinen Pause ein. In und um Bregenz gibt es eine Vielzahl von alten Klöstern, Schlössern und herrschaftlichen Villen. Die bekannteste Burganlage ist die Ruine Hohenbregenz mit der Wallfahrtskirche des hl. Gebhard.
Einen besonderen Spaß für Radler bietet aber eine Gondelfahrt auf den Pfänder, den Bregenzer Hausberg. Man kann sein Fahrrad in der Kabine mit auf den Berg nehmen, dort den einmaligen Blick über den Bodensee genießen und dann mit einer rasanten Schussfahrt wieder zum Bodensee hinab rollen!
Sehenswertes:
 Bregenz besitzt die größte Seebühne der Welt. Sie bietet 7.000 Zuschauern Platz. Bei den alljährlich im Juli und August stattfindenden Bregenzer Festspielen werden Operetten, Opern und Musicals aufgeführt. Aufgrund der einzigartigen Kulisse im Bodensee, den technischen Effekten, einer unvergleichlichen Akustik und qualitativ hochstehenden Darbietungen sind die Aufführungen sehr beliebt und erfolgreich.
Bregenz besitzt die größte Seebühne der Welt. Sie bietet 7.000 Zuschauern Platz. Bei den alljährlich im Juli und August stattfindenden Bregenzer Festspielen werden Operetten, Opern und Musicals aufgeführt. Aufgrund der einzigartigen Kulisse im Bodensee, den technischen Effekten, einer unvergleichlichen Akustik und qualitativ hochstehenden Darbietungen sind die Aufführungen sehr beliebt und erfolgreich.
Die Seebühne wurde im James-Bond-Film ‚Ein Quantum Trost‘ als Kulisse genutzt.
Das ‚vorarlberg museum‘ präsentiert und bewahrt kunst- und kulturgeschichtliche Zeugnisse aus dem Bundesland Vorarlberg. Schwerpunkte der umfangreichen Sammlung sind Archäologie, Geschichte, Kunstgeschichte und Volkskunde.
Das Museum existiert bereits seit 1857. Bis vor kurzem trug es den Namen ‚Vorarlberger Landesmuseum‘ (VLM). In der jüngeren Vergangenheit richtete man die Konzeption des Museum vollkommen neu aus und änderte dabei auch den Namen. Die alten Museumgebäude wurden abgerissen und durch einen vom berühmten Architekten Stefan Sagmeister geschaffenen Neubau ersetzt. Die Wiedereröffnung fand 2013 statt.
Bereits seit 1090 war der Benediktinerorden in Bregenz angesiedelt. 1125 wurde die erste Kirche geweiht. Im frühen 17. Jahrhundert entstand im Konventgebäude der prächtige Bibliothekssaal. Noch heute ist die alte Bibliothek das Glanzstück der Abtei. 1743 wurde die neue barocke Klosterkirche fertig gestellt, doch im Zuge des Reichsdeputationsabschlusses wurde das Kloster 1805 geschlossen und in der Folgezeit geplündert. Doch im Jahre 1850 zogen Zisterziensermönche in die alten Gebäude ein und belebten sie dadurch wieder neu.
In den Jahren 1990 – 97 entstand das neue, architektonisch hervorstechende Kunsthaus Bregenz (KUB). Der Kubus besitzt eine Glasfassade und wurde im Baustil des Minimalismus durch den Schweizer Architekten Peter Zumthor geschaffen, der mit dem Entwurf des Gebäudes den ‚Mies van der Rohe Award for European Architecture‘ gewann. Das KUB gehört zu den bedeutendsten europäischen Ausstellungshäusern für zeitgenössische Kunst. Auf vier Stockwerken werden sowohl die eigene Sammlung als auch Wechselausstellungen gezeigt. Einige Räume wurden durch die Künstler eigens gestaltet.
Das klassizistische Palais wurde 1848 als Villa Gülich erbaut. Nach einer umfangreichen Renovierung im Jahre 1984 dient das umgebaute stolze Palais als internationales Zentrum für zeitgenössische Kunst der Berufsvereinigung der bildnerischen Künstler Vorarlbergs.
Ende des 14. Jahrhundert wurde das Anwesen als gräfliches Gut errichtet. Nach 1509 wurde es zum Amtssitz und zwischen 1907 und 1981 diente das Schloss als Kloster. Zu diesem Zweck wurde das Anwesen umgebaut und erheblich erweitert. Seit der Auflösung des Konvents ist das Schlösschen im Besitz des Landes Vorarlberg. Der große dreigeschossige neugotische Bau, der links neben dem alten, unscheinbar wirkenden Schloss steht, beherbergt die Vorarlberger Landesbibliothek.
Bregenz ist die Hauptstadt des östlichsten österreichischen Bundeslandes Vorarlberg. Hier befindet sich der Sitz des Landeshauptmanns, der Landesregierung und des Vorarlberger Landtages. Die Sitzungen des Landesparlamentes finden im Plenarsaal des Landhauses statt. Der Stahl-Beton-Bau an der Römerstraße wurde 1977 – 81 erbaut und beherbergt auch einen Teil der Vorarlberger Landesverwaltung.
Der Martinsturm in der Bregenzer Oberstadt gehört zu den Wahrzeichen der Landeshauptstadt. Er gilt als das älteste barocke Bauwerk der gesamten Bodenseeregion. Darüber hinaus besitzt der Prunkbau die größte Turmzwiebel Mitteleuropas.
Die Ursprünge des Martinsturmes liegen aber bereits im 13. Jahrhundert. Als die Stadtmauer errichtet wurde, entstand an dieser Stelle ein niedriger Turm, der zunächst als Getreidespeicher, später als Wohnturm genutzt wurde. Seit dem 14. Jahrhundert besaß er eine eigene Kapelle. Um 1600 wurde der Turm um drei Stockwerke erhöht und das Bauwerk erhielt seinen großen und markanten Zwiebelhelm. Anfang des 18. Jahrhundert wurde schließlich das Langhaus als Kapelle für die Bevölkerung angebaut. In der Martinskapelle im Obergeschoss des Turmes sind noch Fresken aus dem 14. und 15. Jahrhundert erhalten. Sie diente den Grafen von Bregenz oder ihren Ministerialen als Burgkapelle. Vom Martinsturm kann man einen wunderschönen Blick über Bregenz und den Bodensee genießen.
 Der 1064 m hohe Pfänder ist der Hausberg von Bregenz, obwohl er genau genommen auf dem Gemeindegebiet von Lochau steht. Eine Seilbahn führt auf die 1022 m hohe Bergstation nahe der Pfänderspitze. Die Pfänderbahn wurde 1927 eröffnet und damals noch mit Dampfkraft betrieben. Die heutigen vollverglasten Gondeln bieten 80 Personen Platz – und was interessant ist: auch Fahrräder werden transportiert. Damit bietet es sich an, mit dem Fahrrad auf den Pfänder zu fahren und dann per Sausefahrt wieder hinunter nach Bregenz zu rollen – eine unvergessliche Gaudi! Zuvor sollte man aber den atemberaubenden Blick genießen, den man von hier oben über den Bodensee besitzt. Oben an der Bergstation gibt es einen Alpenwildpark und eine Adlerwarte, die zwischen Mai und Anfang Oktober regelmäßig Flugvorführungen mit ihren Greifvögeln anbieten.
Der 1064 m hohe Pfänder ist der Hausberg von Bregenz, obwohl er genau genommen auf dem Gemeindegebiet von Lochau steht. Eine Seilbahn führt auf die 1022 m hohe Bergstation nahe der Pfänderspitze. Die Pfänderbahn wurde 1927 eröffnet und damals noch mit Dampfkraft betrieben. Die heutigen vollverglasten Gondeln bieten 80 Personen Platz – und was interessant ist: auch Fahrräder werden transportiert. Damit bietet es sich an, mit dem Fahrrad auf den Pfänder zu fahren und dann per Sausefahrt wieder hinunter nach Bregenz zu rollen – eine unvergessliche Gaudi! Zuvor sollte man aber den atemberaubenden Blick genießen, den man von hier oben über den Bodensee besitzt. Oben an der Bergstation gibt es einen Alpenwildpark und eine Adlerwarte, die zwischen Mai und Anfang Oktober regelmäßig Flugvorführungen mit ihren Greifvögeln anbieten.
Auf dem fast 600 m hohen Gebhardsberg steht die Ruine der Burg Hohenbregenz. Sie wurde im 11. Jahrhundert durch die Grafen von Bregenz errichtet und Anfang des 17. Jahrhunderts zur Festung ausgebaut. Dennoch wurde die Wehrburg im Dreißigjährigen Krieg durch schwedische Truppen kampflos eingenommen. Diese sprengten 1647 die Bastion, so dass von der alten Burganlage nur noch Reste des Palas und Teile der Ringmauer erhalten blieben.
Doch die Ruine blieb nicht lange unbewohnt. Einsiedler erbauten hier eine Eremitenklause und 1723 wurde eine erste Kirche zu Ehren des hl. Gebhards geweiht. Die Kapelle wurde zum Ziel einer bis heute andauernden Wallfahrt. Das heutige Gotteshaus wurde 1791 erbaut, nachdem der Vorgängerbau abgebrochen worden war.
 Die Pfarrkirche zum Heiligsten Herzen Jesu wurde als dreischiffige Backsteinbasilika zwischen 1905 und 08 im Stil der Neogotik erbaut und erinnert in ihrem Aussehen an alte Kirchenbauten in Norddeutschland. Mit ihren zwei 62 m hohen spitzen Türmen gehört das Gotteshaus zu den größten Kirchenbauten am Bodensee und prägt das Stadtbild von Bregenz. Der Bau der Kirche und die Inneneinrichtung wurden fast ausschließlich aus den Spenden der Bürger finanziert.
Die Pfarrkirche zum Heiligsten Herzen Jesu wurde als dreischiffige Backsteinbasilika zwischen 1905 und 08 im Stil der Neogotik erbaut und erinnert in ihrem Aussehen an alte Kirchenbauten in Norddeutschland. Mit ihren zwei 62 m hohen spitzen Türmen gehört das Gotteshaus zu den größten Kirchenbauten am Bodensee und prägt das Stadtbild von Bregenz. Der Bau der Kirche und die Inneneinrichtung wurden fast ausschließlich aus den Spenden der Bürger finanziert.
 Die Grabkapelle besteht aus einer überkuppelten Rotunde und wurde 1757 erbaut. Der Volksmund nennt das Gebäude nach ihrem Stifter, dem Pfarrer Franz Wilhelm Haas (1685 – 1764) noch heute ‚Haasenkapelle‘. Die Rundkirche am Kornmarktplatz ist ein barockes Juwel. Besonders sehenswert sind die Barockstatuen an den Seitenwänden und die Rokokowandmalereien. Auch heute noch finden zu besonderen Anlässen Gottesdienste in der Kapelle statt.
Die Grabkapelle besteht aus einer überkuppelten Rotunde und wurde 1757 erbaut. Der Volksmund nennt das Gebäude nach ihrem Stifter, dem Pfarrer Franz Wilhelm Haas (1685 – 1764) noch heute ‚Haasenkapelle‘. Die Rundkirche am Kornmarktplatz ist ein barockes Juwel. Besonders sehenswert sind die Barockstatuen an den Seitenwänden und die Rokokowandmalereien. Auch heute noch finden zu besonderen Anlässen Gottesdienste in der Kapelle statt.
Das Kloster Thalbach wurde im 15. Jahrhundert als Franziskanerinnenorden gegründet. Die erste Kapelle wurde 1610 durch eine neue Klosterkirche ersetzt. 1782 wurde aber durch Kaiser Joseph II. die Auflösung des Klosters Thalbach verfügt. Als Dominikanerinnen die leer stehende Anlage vierzehn Jahre später übernahmen, wurde der Klosterbetrieb wieder aufgenommen. 1983 übergaben die Nonnen das Kloster an die Geistliche Familie ‚Das Werk‘, einer katholischen Gemeinschaft, die sich einem gottgeweihten Leben verschrieben hat.
Am Hang des Gebhardsberges ließ der polnische Graf Raczyński 1877 eine schlossartige Villa im neubarocken Stil erbauen. 1904 übernahmen Franziskanerinnen das Anwesen und richtete hier das Kloster Marienberg und eine Schule ein.
Vom ehemaligen großen Rathauskomplex der Stadt Bregenz existiert heute nur noch ein dreistöckiger freistehender Fachwerkbau aus dem Jahre 1662. Die restlichen Gebäude wurden abgetragen. Bis in das 19. Jahrhundert hinein wurden von hier aus die Ratsgeschäfte geleitet. Doch weiß man heute nicht mehr genau, ob es sich bei dem erhaltenen Gebäude in der oberen Altstadt um das eigentliche Rathaus oder nur um ein Nebengebäude gehandelt hat. Es ist lediglich bekannt, dass sich in diesem Haus die Wohnung des Ratsdieners befunden hat.
Im 17. Jahrhundert ließ der Patrizier Albert von Deuring an einem Berghang ein Schloss erbauen. Tatsächlich ist das Gebäude im Kern sehr viel älter. Der ehemalige mittelalterliche Carolenhof stammt noch aus dem 14. Jahrhundert. Der turmartige Anbau mit dem Zwiebelhelm wurde erst im 19. Jahrhundert ergänzt. Heute beherbergt das Schlößle ein Gourmet-Hotel.
Auf dem Steinhügel befinden sich Gebäudereste, die noch aus römischer Zeit stammen. Dabei handelt es sich jedoch nicht, wie lange fälschlich angenommen, um ein ehemaliges Wohnhaus, sondern wahrscheinlich vielmehr um das Warenlager eines Hafenkastells aus dem 1. bis 3. Jhd. n. Chr. In einem Brunnenschacht fanden Archäologen Gläser und Keramik, aber auch Eisen- und Bronzegegenstände. Die umfangreiche römische Hinterlassenschaft war Anfang der 1990er Jahre beim Bau eines Tunnels entdeckt worden.
 Zwischen der Seebühne und dem Hafen erstreckt sich die Seepromenade von Bregenz. Sie ist bei Spaziergängern, Flaneuren und Radwanderern gleichermaßen beliebt. In Österreich ist es glücklicherweise nicht erlaubt, ein Landstück direkt am Bodensee zu kaufen. So blieb die Promenade allen Bürgern unverbaut erhalten und bietet einen direkten Zugang zur Bregenzer Bucht.
Zwischen der Seebühne und dem Hafen erstreckt sich die Seepromenade von Bregenz. Sie ist bei Spaziergängern, Flaneuren und Radwanderern gleichermaßen beliebt. In Österreich ist es glücklicherweise nicht erlaubt, ein Landstück direkt am Bodensee zu kaufen. So blieb die Promenade allen Bürgern unverbaut erhalten und bietet einen direkten Zugang zur Bregenzer Bucht.
Eine erste Schiffsanlegestelle ist in Bregenz schon im ausgehenden 13. Jahrhundert nachweisbar. Inzwischen hat sich der mittelalterliche Ankerplatz zu einem modernen und wichtigen Hafen im Bodensee gewandelt. Nach einer völligen Neugestaltung des Areals laden die Sunset-Sitzstufen zum Verweilen ein. Das neue Hafengebäude bildet das Zentrum des Hafens.
Weiter nördlich befindet sich die älteste Badeanstalt im Bodensee. Das im Volksmund liebevoll ‚Mili‘ genannte Traditionsbad entstand 1825 als Militärbad, in dem die jungen Soldaten das Schwimmen erlernen sollten. Inzwischen ist der Holzpfahlbau in öffentlichen Besitz und besitzt bei den Einheimischen eine Art von Kultstatus.
Die dem hl. Antonius von Padua geweihte Klosterkirche wurde 1639 erbaut. 360 Jahre lang wirkte hier ein Kapuzinerorden, bis sie im Jahre 1999 das Kloster aufgaben. Nach einer grundlegenden Renovierung werden die Klostergebäude heute von der franziskanischen Gemeinschaft der ‚Schwestern der hl. Klara‘ bewohnt. Das älteste und wohl auch bedeutendste Werk im Inneren der Kapuzinerkirche ist die Pietà in der Seitenkapelle (um 1480). Weitere sehenswerte Objekte sind eine Statue der Schmerzensmutter (15. Jhd.) und das barocke Hochaltarbild, das den hl. Antonius zeigt. Zu der Klosterkirche gehört auch die 1887 erbaute Lourdesgrotte.
 Nachdem die Bregenzer das Heer der Appenzeller 1408 geschlagen hatte, errichteten sie zum Gedenken an diesen Sieg aus Dankbarkeit die Seekapelle. Das Gotteshaus wurde 1445 fertig gestellt. Ende des 17. Jahrhunderts wurde sie barockisiert und mit dem Rathaus verbunden. Dabei erhielt sie auch ihren charakteristischen Zwiebelturm. Sehenswert ist der Renaissance-Hochaltar aus dem Jahre 1615.
Nachdem die Bregenzer das Heer der Appenzeller 1408 geschlagen hatte, errichteten sie zum Gedenken an diesen Sieg aus Dankbarkeit die Seekapelle. Das Gotteshaus wurde 1445 fertig gestellt. Ende des 17. Jahrhunderts wurde sie barockisiert und mit dem Rathaus verbunden. Dabei erhielt sie auch ihren charakteristischen Zwiebelturm. Sehenswert ist der Renaissance-Hochaltar aus dem Jahre 1615.
Die schlichte Kapelle wurde 1400 vom Grafen Hugo XII. von Montfort als Siechenhaus gestiftet. Lange gehörte die Kapelle zu einem Seuchenhospital für Leprakranke. Um1745 wurde der ursprünglich gotische Bau im barocken Stil umgestaltet.
Im Bregenzer Stadtteil ‚Dorf‘ steht die dem hl. Gallus geweihte katholische Stadtpfarrkirche. Schon im 5. Jahrhundert hatte es an dieser Stelle eine erste Kirche gegeben. Danach errichtete man ein Gotteshaus im frühromanischen Stil, das aber leider abbrannte. Die heutige Kirche entstand schließlich 1477. Sie wurde 1732 barockisiert und auch innen im barocken Stil eingerichtet. Nur der wuchtige Turm blieb im gotischen Stil erhalten. Unter dem Chor befindet sich die dem hl. Michael geweihte Krypta mit Fresken aus dem späten 15. Jahrhundert.
Im Stadtteil Rieden-Vorkloster steht die katholische Pfarrkirche Maria Hilf. Mit ihrem mehrgeschossigen, gegliederten, achteckigen Turm wirkt das 1925 bis 1931 erbaute Gotteshaus schon von außen recht ungewöhnlich. Der Zentralbau mit seinem ovalen Innenraum besitzt beidseitig Flügelanbauten, so dass sich von außen ein symmetrisch vorgelagerter Innenhof ergibt. Die Kirche war als Kriegerdenkmal und Heldendankkirche geplant. Der überwiegende Teil der Innenausstattung stammt aus den 1930er Jahren. Ausnahmen sind eine Pietà aus dem 17. Jahrhundert und die Figur des hl. Antonius aus dem 18. Jahrhundert.
Hard
ie Marktgemeinde Hard liegt direkt am Bodensee und besitzt ein fast vollständig unverbautes und naturnahes Seeufer. Hier, nahe der Stelle, wo der Neue Rhein und die Bregenzer Ach in den Bodensee münden, befinden sich großräumige geschützte Naturlandschaften, die zu ausgedehnten Ausflügen einladen. Aber so friedlich ist es hier nicht immer gewesen: in der ‚Schlacht bei Hard‘ schlugen die Eidgenossen das Ritterheer des Schwäbischen Bundes vernichtend. Zur eigenständigen Gemeinde wurde der Ort erstmals im Jahre 1806. Im Zeitalter der beginnenden Industrialisierung wurde in der Mittelweiherburg eine Textilfabrik errichtet. Heute ist in dem alten Schloss ein Museum untergebracht, das dieses Kapitel näher beleuchtet.
Sehenswertes:
Dort, wo der Harder Dorfbach entspringt, entstand um 1570 das Wasserschloss Mittelweiherburg. Der Weiher, der das Bauwerk einst umgab und ihm seinen Namen gab, ist inzwischen vollständig verlandet. Das Schloss wechselte häufig den Besitzer und 1794 übernahm es schließlich Samuel Vogel, der darin eine Textildruckerei einrichtete. Diese wurde 1838 durch Melchior Jenny übernommen und weitergeführt und entwickelte sich zu einer der wichtigsten österreichischen Textildruckbetriebe.
Heute befindet sich im Schloss ein Museum, das die verschiedenen Techniken des Stoffdruckes beschreibt und auf die Sozialgeschichte der Industrialisierung bis in das frühe 20. Jahrhundert eingeht.
Das älteste noch verkehrende Passagierschiff und zugleich das einzige Dampfschiff auf dem Bodensee ist die ‚Hohentwiel‘. Früher wurde der betagte Schaufelraddampfer, der im österreichischen Hard stationiert ist, noch mit Kohle befeuert, inzwischen nimmt man Heizöl als Treibstoff. Aber noch immer schnauft die alte Dame, betrieben vom ‚Verein Internationales Bodensee-Schifffahrtsmuseum e.V.‘, im Charterbetrieb über den Bodensee.
Die Hohentwiel lief im Jahre 1913 in Friedrichshafen vom Stapel und diente zunächst dem Württembergischen König Wilhelm II. als Staatsschiff. Bald schon wurde sie als Linienschiff und Vergnügungsdampfer betrieben. 1962 wurde sie ausgemustert und diente fortan als festliegendes Clubheim und Restaurant. Nach einer umfangreichen Sanierung ist es seit 1990 aber wieder auf dem Bodensee unterwegs und spielte sogar eine Rolle in dem James Bond Streifen ‚Ein Quantum Trost‘.
Mitten im Rheindelta, zwischen Neuem Rhein und Dornbriner Ach, liegt ein zauberhaftes Naturschutzgebiet mit vielen Seen und Feuchtgebieten. Hier lebt vermehrt die Schleie, weshalb das Areal nach dem Fisch benannt wurde. Die Schleierlöcher sind sowohl Naherholungsgebiet für die Anwohner als auch wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl von Tiere und Pflanzen.
Die eindrucksvolle klassizistische Villa verdankt ihren Namen nicht etwa einer hübschen Frau. Das Gebäude wurde im 19. Jahrhundert durch den Schweizer Textilfabrikanten Melchior Jenny erbaut. Die prachtvolle Villa dient heute verschiedenen kulturellen Veranstaltungen und als Kunstmuseum.
Der Feuerwehr-Oldtimer-Verein Hard sammelt und restauriert in liebevoller Arbeit die ehemaligen Feuerwehrfahrzeuge der hiesigen Ortsfeuerwehr. Dabei werden alle Fahrzeuge in betriebsbereiten Zustand erhalten. In der Ausstellungshalle sind Raritäten wie der legendäre Steyr 480 aus dem Jahre 1957 oder ein 1941er Mercedes 1500 zu bewundern. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es eine Ausfahrt mit den historischen Wagen.
Fußach
m südlichen Ufer des Bodensees liegt die zum österreichischen Bundesland Vorarlberg gehörende Gemeinde Fußach. Hier mündet der Neue Rhein in den Bodensee und vergrößert dabei immer mehr sein Delta, welches das größte Süßwasserdelta Europas ist. Die Dammbauten ragen mittlerweile rund 4 km in den Bodensee hinein. Fußach erlebte bereits im Mittelalter eine erste Blüte. Zwischen dem 11. und dem 16. Jahrhundert war Fußach einer der Hauptwarenumschlagplätze am Bodensee. Das ehemalige Zoll- und Speditionsgebäude am alten Fußacher Hafen zeugt noch von dieser florierenden Zeit. Heute ist es hier ruhiger und beschaulicher geworden. Ein umfangreiches Radwandernetz lädt zum Ausflug in das Rheindelta ein.
Sehenswertes:
Die moderne katholische Pfarrkirche wurde zwischen 1977 und 1979 an der gleichen Stelle erbaut, wo vorher bereits eine Kirche gestanden hatte. Der alte Turm aus dem 17. Jahrhundert blieb als einziges Bauelement der Vorgängerkirche erhalten und wurde in den Neubau integriert. So entstand ein interessanter architektonischer Kontrast zwischen moderner Gegenwart und historischer Vergangenheit.
Höchst (Vorarlberg)
m äußersten Westen Österreichs liegt im Bundesland Vorarlberg die Gemeinde Hoechst. Hier im Mündungsdelta des Rheins in den Bodensee gibt es eine einzigartige Seeufer- und Riedlandschaft. Durch die besondere geographische Lage ist das Klima besonders mild, da der Bodensee hier als Wärmespeicher fungiert. Das Rheindeltagebiet ist ein bedeutendes Vogelschutzgebiet. 330 verschiedene Vogelarten, die das Gebiet als Brut- oder Rastgebiet nutzten, wurden hier gezählt. Ein ausgedehntes Wander- und Radwandernetz führt durch die Region des Rheindeltas. Sehenswert ist die hübsche, aber noch relativ junge neubarocke Pfarrkirche St. Johann, die den höchsten Kirchturm in Vorarlberg besitzt.
Sehenswertes:
Die stolze Pfarrkirche gilt als eine der schönsten im gesamten Vorarlberg. Auf jeden Fall besitzt sie mit 81 Metern den höchsten Kirchturm des Bundeslandes. Die Kirche entstand erst in den Jahren 1908 – 1910. Der Schweizer Architekt Albert Rimli ließ sie unter tatkräftiger Hilfe der einheimischen Bevölkerung im neubarocken Stil erbauen, wobei er auch Elemente aus dem Jugendstil verwendete.
Radrouten die durch Höchst (Vorarlberg) führen:
Gaißau
m äußersten Westen Österreichs liegt am südlichen Ufer des Bodensees die kleine Gemeinde Gaißau. Sie grenzt an die Schweiz wird vom Alten Rheines umflossen, der hier auch die Staatsgrenze bildet. Erstmals wurde das Dorf in Vorarlberg um das Jahr 900 erwähnt, seit 1500 ist Gaißau eigenständig. Ortsprägend ist die neoromanische Kirche mit ihrem Spitzhelm. Das älteste Gebäude des Ortes ist jedoch das Pfarrgemeindehaus, das im Kern noch aus dem 15. Jahrhundert stammt.
Sehenswertes:
Das älteste Haus der Gemeinde Gaißau stammt im Kern noch aus dem 15. Jahrhundert. 1735 baute man es zu einem typischen Thurgauer Fachwerkhaus um. Zunächst diente es als Gasthaus, später aber auch als Pfarrhaus, Schule, Kirche, Spritzenhaus und zuletzt sogar als Diskothek. Inzwischen wurde das geschichtsträchtige Gebäude grundlegend saniert und der ursprüngliche Zustand aus dem 18. Jahrhundert wiederhergestellt.
Radrouten die durch Gaißau führen:
Rheineck SG
ereits 1219 erhielt Rheineck, das heute direkt an der Grenze zu Österreich liegt, die Stadtrechte. Von der alten Stadtbefestigung sind nur noch einige Reste erhalten, dennoch ist die Altstadt in ihrem ursprünglichen Gefüge klar erkennbar. Zahlreiche historische Bauten aus verschiedenen Epochen zeugen von einer geschichtsträchtigen Vergangenheit, obwohl ein Stadtbrand 1876 große Teile der Stadt vernichtete. Bereits 1445 waren Stadt und Burg Rinegge im Laufe des Appelzeller Krieges zerstört worden. Doch zügig baute man die Stadt in der Ostschweiz wieder auf. Die Fachwerk- und Jugendstilhäuser prägen die hübsche Kleinstadt am Alten Rhein, die einmal ein bedeutender Handelsplatz war, bevor die Gotthardstrecke eingerichtet wurde. Vom Burgplateau über der Altstadt hat man einen prächtigen Blick über Rheineck bis zum Bodensee und in die Allgäuer Alpen hinein. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Burgstock. Die Ruine mit dem zum großen Teil abgetragenen Wachturm thront hoch über dem Ort und stammt wohl noch aus dem 12. Jahrhundert.
Sehenswertes:
Rheinecks Altstadt wird geprägt von historischen Fachwerk- und hübschen Jugendstilhäusern. Von der alten Stadtbefestigung sind nur noch einige Reste erhalten. Der älteste Teil der Stadt heißt ‚Hinter dem Markt‘ und befindet sich nördlich der St. Jakobkirche. Er wurde beim Stadtbrand im 19. Jahrhundert vom Feuer verschont.
Auf der anderen Seite der Hauptstraße steht das 1555 fertig gestellte Rathaus. Das rot getünchte dreistöckige Gebäude besitzt einen markanten Treppengiebel und ein kleines hölzernes Türmchen.
Das alte Schloss Rinegge wurde um das Jahr 1445 durch die Appenzeller zerstört. In der Ruine wurde zeitweilig der provisorische Sitz des Landvogts eingerichtet. Im 17. Jahrhundert wurden die alten Gebäude zu Wohnhäusern umgebaut. Die fünfteilige Gebäudegruppe nennt man heute ‚Schlössli‘.
Auch die alte Landschreiberei steht auf dem Areal des alten Schlosses und so ist man sich nicht sicher, ob die Jahreszahl 1639, die über dem Eingangsportal prangt, sich auf einen Neubau oder einen Umbau bezieht. Möglicherweise war das vierstöckige Gebäude, das im oberen Teil aus einer Fachwerkkonstruktion besteht, bereits im Kern Bestandteil des alten Schlosses.
Das um 1580 erbaute repräsentative Amtshaus vereint Stilelemente der Gotik mit dem frühen Barock. Bis 1772 war das hübsche und reich verzierte dreigeschossige Gebäude Sitz der Landvögte.
Als Landvögte wurden im Mittelalter Amtsleute bezeichnet, die für die Landesfürsten die Verwaltungsaufgaben übernahmen. Sie kümmerten sich um die Festlegung und Eintreibung von Steuern und hielten auch Gericht. Das Amt des Landvogtes war in der Schweiz, in Schwaben, dem Elsass und auch in der Lausitz sehr verbreitet.
Südwestlich von Rheineck steht noch eine alte Burgruine aus dem 12. Jahrhundert. Der alte steinerne Turm, der höchstwahrscheinlich als Wachturm diente, ist heute das Wahrzeichen der Stadt. Während der Appenzeller Kriege wurde Rheineck weitestgehend zerstört. Auch der Burgstock wurde im Verlaufe der kriegerischen Handlungen schwer beschädigt und schließlich abgetragen.
Der herrschaftliche Barockbau entstand zwischen 1750 und 1753. Die Innenräume sind aufwendig mit Stuckarbeiten im Rokokostil ausgestattet. Das mächtig wirkende Gebäude wurde als Amtssitz des Landvogtes, als Textilfabrik, Lagerstätte und zuletzt als Bäuerinnenschule genutzt.
Der Kirchenbau der evangelisch-reformierten Pfarrkirche entstand 1519 am südlichen Ende der Altstadt im spätgotischen Stil. 1722 wurde sie baulich barock überarbeitet und erhielt dabei ihre markante Zwiebelkuppel. Der Chor stammt noch aus dem 16. Jahrhundert. Der Pfarrer, Autor und Dichter William Wolfensberger (1889 – 1918) wirkte bis zu seinem frühen Tod in der Jakobskirche. Das benachbarte Pfarrhaus beherbergt das William-Wolfensberger-Archiv.
Die katholische Kirche entstand 1932/33 als eine der ersten modernen Schweizer Kirchenbauten und gilt als eines der wichtigsten Bauwerke der Zwischenkriegszeit. Sie setzt sich aus mehreren gerundeten Bauteilen zusammen. Der kreisrunde Hauptraum wird von einer dunklen Kuppel überwölbt. Alleine der Kirchturm ist eckig.
Das prunkvolle dreigeschossige Palais wurde 1742 – 1746 erbaut. Die barocke Dreiflügelanlage besitzt insgesamt 60 Innenräume und wurde ursprünglich als Sommersitz eines Handelshauses erbaut. Mit seinem französischen Garten, dem Springbrunnen und der Orangerie gilt es als das schönste Palais des 18. Jahrhunderts im Kanton St. Gallen.
Von den alten Stadttoren Rheinecks ist nur noch eines erhalten geblieben. Das Rhytor (hochdt: Rheintor) entstand im 15. Jahrhundert und führte einst zum Hafen hinaus. Über dem tonnengewölbten Durchgang befindet sich ein zweistöckiger Fachwerkaufbau und an der Ostseite prangt ein Wandgemälde des Kunstmalers Heinrich Herzig (1887 – 1964). Herzig war in Rheineck geboren worden und starb auch dort. Er lebte und arbeitete den überwiegenden Teil seines Lebens in der Stadt und erhielt im gesetzten Alter auch die Ehrenbürgerwürde.
Das spätklassizistische Anwesen wurde 1881 als Schulhaus erbaut und befindet sich heute im privaten Besitz. Das Gebäude mit der symmetrischen Hauptfassade wurde durch Gustav Alfred Müller geschaffen, der seinerzeit als einer der wichtigsten Architekten der Ostschweiz galt.
Der Schweizer Architekt Adolf Gaudy (1872 – 1956) wurde vor allem durch seine Kirchenbauten berühmt. Aber er schuf auch einige sehenswerte Profanbauten, wie das Oberstufenschulhaus in Rheineck, dass Gaudy im neubarocken Stil mit klassizistischen Elementen dem direkt dahinterliegenden Löwenhof nachempfand. Das Gebäude entstand in den Jahren1905/06.
Radrouten die durch Rheineck SG führen:
Thal SG
ie Gemeinde Thal SG besteht aus den drei Ortsteilen Thal, Staad und Altenrhein. Die Gemeinde besitzt kein wirkliches Ortszentrum und wirkt recht zersiedelt. Das wiederum macht aber auch den Reiz des Ortes aus.
Altenrhein ist das letzte Fischerdorf am oberen Bodensee. Noch heute beliefern die Fischer die umliegenden Restaurants mit fangfrischem Seefisch. Die Mündung des Alten Rheines ist sowohl ein Vogelparadies als auch ein beliebtes Ziel für Ausflügler. Am hiesigen Flugplatz gibt es im kleinen Rahmen sogar Linienverbindungen und ein kleines Luftfahrtmuseum. Die bunt-verspielte Hundertwasser-Markthalle unweit des Landeplatzes ist ein visuelles Highlight. Das Wahrzeichen der Gemeinde ist der Buechberg. Vom beliebten Aussichtsrestaurant ‚Steinig Tisch‘ hat man einen einzigartigen Ausblick über den Bodensee bis nach Deutschland und Österreich. Der Weinberg brachte Thal den Beinamen ‚Dorf der Rebe‘ ein.
Sehenswertes:
Bereits in den 1920er Jahren, als die Fliegerei sich noch in den Kinderschuhen befand, wurde in Altenrhein eine Graspiste angelegt, aus der sich der heutige Regionalflughafen entwickelte. In kleinem Umfang wird von hier aus auch Linienflugverkehr betrieben. In den 1930er Jahren war Altenrhein der Werksflugplatz von Dornier. Hier wurde das legendäre Flugschiff ‚Do-X‘ gebaut, dass zu seiner Zeit das mit Abstand größte Flugschiff der Welt war.
Das kleine Fliegermuseum am Flugplatz bewahrt noch einige flugfähige Oldtimer, wie die Doppeldecker Bücker Bü 131 und die Boeing Stearman, die De Havilland Vampire und die Schweizer Modelle Pilatus P-2, P-3 und PC7. Eine Dokumentation zeigt die Geschichte der Dornier-Werke auf dem Flugplatz Altenrhein.
Nahe des Flugplatzes St. Gallen-Altenrhein steht ein buntes und formenreiches Gebäude mit vier goldenen Turmkuppeln am Kreisverkehr. Die Markthalle entstand zwischen 1998 und 2002 nach dem Konzept von Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000). Der Österreicher zählt zu den herausragenden Künstlern des 20. Jahrhunderts. Er war Vordenker von visionären Kunstformen und schuf neue, leuchtende Farbwelten, die es in dieser Form vorher noch nicht gab. Das zentrale künstlerische Element ist die wachsende, organische und ungerade Linie. Sie drückt seinen naturverbundenen Ansatz aus. In diesem Sinne entstanden auch einige Hundertwasser-Architekturprojekte, zu denen auch die Markthalle gehört. In der kegelgestützten Halle des Erdgeschosses finden die verschiedensten Veranstaltungen statt. Das begrünte Dach des Gebäudes ist begehbar.
In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts wurde durch die ‚Internationale Rheinregulierung‘ die Hauptmündung des Alpenrheines in den Bodensee etwas nach Osten verlegt. Damit konnte man wirksam den wilden Fluss bändigen und die ständige Hochwassergefahr eindämmen. Der alte Arm wurde nun der ‚Alte Rhein‘ genannt, der Mündungsbereich heißt ‚Rheinspitz‘. Der Grenzverlauf zwischen der Schweiz und Österreich befindet sich hier in der Mitte des Altarmes. Das Delta hat sich zu einem wichtigen Naturschutz- und Naherholungsgebiet entwickelt. Es bietet für eine Vielzahl von Vogelarten ein Brut- und Rastgebiet. Die Riedlandschaft lädt zum Wandern und Spazierengehen ein. Neben einem Yachthafen und Restaurantbetrieben gibt es auf der österreichischen Seite auch ein Seebad. Den Alten Rhein in seiner naturbelassenen Schönheit kann man am besten auf einer Schiffsrundfahrt entdecken.
Am Dorfrand steht ein historischer Riegelbau mit Turm. Der unter Denkmalschutz (in der Schweiz sagt man Heimatschutz) stehende Gutshof, der sich an den hauseigenen Rebberg schmiegt, wird auch heute noch landwirtschaftlich genutzt. Darüber hinaus ist im Rosentürmli ein beliebtes Heuhotel untergebracht.
Der ehemals ‚Weinburg‘ genannte Adelssitz entstand im frühen 15. Jahrhundert. Nach 1686 diente das Anwesen als Landschreiberei. 1796 entstand das heutige Schloss als Neubau und 1817 übernahm Fürst Karl von Hohenzollern-Sigmaringen 1785 – 1853) die Weinburg, um sie vor allem als Aufenthaltsort im Herbst zu nutzen. Sein Sohn Karl Adolf von Hohenzollern-Sigmaringen (1811 – 1855), der vier Jahre Ministerpräsident von Preußen und damit Vorgänger Bismarcks war, ließ den Park neu gestalten. Hier steht seit 1858 ein über 40 m hoher Mammutbaum, der als der älteste Mammutbaum der Schweiz gilt.
1929 wurde die Weinburg an die Steyler Missionsgesellschaft verkauft. Die Missionare ließen mehrere neue Gebäude errichten, nannten das Anwesen in ‚Marienburg‘ um und richteten hier ein theologisches Seminar und ein Gymnasium ein. Die private Schule bestand bis 2012.
Unweit vom Schloss Risegg steht mit dem Schloss Blatten in Staad ein weiteres historisches Anwesen. Der dreistöckige Bau mit dem Mansardendach besitzt ein mittig aufgesetztes barockes Glockentürmchen mit zweiteiliger geschwungener Haube und wirkt recht massig.
Das dreistöckige Herrenhaus entstand in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Seinen charakteristischen achteckigen, barocken Zwiebelturm erhielt das Schloss wohl erst im späten 17. Jahrhundert, doch seine ursprünglich spätgotische Ausrichtung kann das Gebäude nicht verleugnen. Die dem Hauptgebäude vorgelagerten Wirtschaftsgebäude schließen einen beschaulichen Innenhof ein. Auch die Inneneinrichtung wurde im 17. Jahrhundert dem damals modernen barocken Geschmack angepasst.
Das hübsche Schloss wurde 1605 im Renaissancestil erbaut. Vier spitzbehelmte Rundtürmchen stehen an den Ecken des dreistöckigen Gebäudes. Sie überragen nur knapp das Mansardendach des weiß verputzten Herrensitzes. Bereits im ausgehenden 15. Jahrhundert hatte an dieser Stelle ein Adelssitz gestanden, der später durch den heutigen Schlossbau ersetzt wurde. Das im letzten Jahrhundert stark vernachlässigte Anwesen wurde 1999 grundlegend saniert. Auch der in den 1930 entstandene Schlossgarten wurde wieder in Ordnung gebracht.
Bereits im 7. Jahrhundert hatte in Thal eine erste Kirche gestanden. Schriftliche Aufzeichnungen über ein Gotteshaus finden sich allerdings erst ab 1163. Das heutige Gotteshaus mit dem versetzten Turm stammt aus dem 15. Jahrhundert. Nachdem die Gemeinde im Zuge der Reformation 1529 protestantisch wurde, nutzte man die Kirche in Thal paritätisch: sowohl die reformierten als auch die katholischen Gläubigen hielten hier ihre Gottesdienste ab.
Die barocke Landkirche entstand 1790 und besitzt einen schlichten und hellen Innenraum mit Empore. Das moderne Kirchengemeindehaus wurde Ende der 1980er Jahre erbaut und besitzt im oberen Kirchengang eine Verbindung zum Gotteshaus. So bilden beide Gebäude eine bauliche Einheit.
Im ‚alten Öchsli‘, mitten im Dorf Thal, befinden sich die Räumlichkeiten des OrtMUSEUMs. Jedes Jahr präsentiert das Museum eine Sonderausstellung zu interessanten Themen, die sich mit der Geschichte der Gemeinde Thal befassen. Das Museum ist jeweils an den Wochenenden am Nachmittag geöffnet.
Radrouten die durch Thal SG führen:
Rorschacherberg
er Reiz der Gemeinde Rorschacherberg ist die landschaftliche Abwechslung. Sie besitzt einen Zugang zum Bodensee, erstreckt sich aber ansonsten an einem Hang oberhalb von Rorschach. ‚Heimat zwischen Berg und See‘ ist dann auch der Slogan der Gemeinde. Herrliche Ausblicke über den Bodensee machen Rorschacherberg zu einem beliebten Ausflugsziel für Naherholungssuchende. Vier Schlösser sind hier noch erhalten geblieben. Das älteste, das St. Annaschloss, stammt noch aus dem 12. Jahrhundert.
Bei der Gründung des Kantons Sankt Gallen sollte Rorschacherberg zunächst eine Ortsteil von Rorschach werden, doch dagegen wehrten sich die Einwohner Rohschacherbergs vehement und erfolgreich. Weitere Vereinigungsbemühungen wurden im Jahr 2007 abgebrochen.
Sehenswertes:
Das 1573 erbaute Schloss Wiggen steht etwas erhöht über dem Bodensee inmitten einer herrlichen Parklandschaft. Die beiden Flügel des Herrensitzes werden an der Innenseite durch einen Rundturm verbunden, dessen Spitzhelm die gesamte Anlage überragt. Die seitliche Fassade des Hauptflügels wird von einem für den Renaissancestil typischen Treppengiebel abgeschlossen.
Ritter Heinrich von Wartensee ließ 1243 einen wehrhaften Wohnturm errichten. Die Burganlage wurde in den folgenden Jahren ausgebaut und schließlich zu einem Schloss umgestaltet. Sein heutiges neugotisches Erscheinungsbild erhielt der Herrensitz Mitte des 19. Jahrhundert bei einem weiteren Umbau. In dieser Zeit entstand auch die weitläufige Parkanlage. Zuletzt diente das Anwesen als Tagungs- und Begegnungszentrum der Evangelisch-reformierten Kirche.
Das 1573 erbaute Schloss Wiggen steht etwas erhöht über dem Bodensee inmitten einer herrlichen Parklandschaft. Die beiden Flügel des Herrensitzes werden an der Innenseite durch einen Rundturm verbunden, dessen Spitzhelm die gesamte Anlage überragt. Die seitliche Fassade des Hauptflügels wird von einem für den Renaissancestil typischen Treppengiebel abgeschlossen.
Die Ursprünge dieser Schlossanlage liegen heute im Dunkeln. Man weiß nur, dass im ausgehenden 12. Jahrhundert die Edelen Rorschach die Burganlage bewohnten. Mitte des 15. Jahrhundert kaufte das Kloster St. Gallen die Burg, die nun als Sitz des äbtischen Vogt genutzt wurde. Nachdem Abt Franz im Jahre 1509 eine Burgkapelle stiftete, die der hl. Anna geweiht wurde, setzte sich auch für das ganze Anwesen der Name St. Annaschloss durch. Heute befindet sich das Schloss im privaten Besitz.
Radrouten die durch Rorschacherberg führen:
Rorschach
m südlichen Punkt des Bodensees liegt im Kanton St. Gallen die kleine Stadt Rorschach. Von der Fläche her gehört sie zu den kleinsten Städten der Schweiz. Die Ursprünge Rorschachs liegen in der Zeit um 400. Als die Alemannen die Römer aus der Bodenseeregion vertrieben hatten, gründeten sie am See mehrere kleine Siedlungen, zu denen auch das damals ‘Rorscahun’ genannte Dorf gehörte. Im Jahre 947 hatte König Otto I. dem Ort das Markt-, Münz- und Zollrecht verliehen. Kurz nach dieser Zeit wurde Rorschach Durchgangsort großer Pilgerzüge auf dem Jakobsweg, so dass man auf dem heutigen Kronenplatz die Jakobskapelle als Raststätte errichtete. Heute noch erinnert der Jakobsbrunnen an die Kapelle und die Pilgerströme. Der Brunnen bildet einen Ausgangsort für den Jakobsweg über Genf nach Santiago de Compostella. Am Hafen steht mit dem mächtigen Kornhaus das Wahrzeichen der Stadt, das seit 1749 als Lagerstätte diente und heute ein Erlebnismuseum beherbergt. Als Kulturgut von nationaler Bedeutung gilt das ehemalige Benediktinerkloster Mariaberg. Der riesige gotische Komplex war Ende des 15. Jahrhunderts entstanden. Heute ist hier die Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen untergebracht.
Im Jahre 2007 hatten Rorschach, Rorschacherberg und Goldach eine Fusion der Gemeinden angedacht, doch diese Planungen scheiterten aus steuerrechtlichen Befürchtungen.
Sehenswertes:
Von weitem schon sieht man das bullige Gebäude am Rorschacher Hafen. Das Kornhaus ist das auffällige Wahrzeichen der kleinen Schweizer Stadt. Es wurde 1749 durch den Baumeister Caspare Bagnato erbaut. Heute beherbergt das einstige Lagergebäude ein interaktives Erlebnismuseum. Der Rundgang durch die Wissens- und Erlebniswelten soll die Lebensräume des Menschen und der Tiere unterhaltsam erfahren, erfühlen und erblicken lassen. Versuche laden zum Experimentieren, zum Lernen und zum Begreifen ein. Ausstellungsschwerpunkte sind die Urgeschichte, die Stadtentwicklung Rorschachs, Wirtschaft und Industrie, die Tierwelt am und im Bodensee, Optik, Schriften und Zeichen sowie die Mathe-Magie.
Der kolossartige Baukomplex des Benediktinerklosters Mariaberg gilt als die mächtigste Klosteranlage der Schweiz. Nur als Kloster diente das riesige Gebäude nie. Der erste Bau des Klosters wurde 1487 bis 1489 ausgeführt. Die Streitigkeiten zwischen der Stadt St. Gallen und dem Fürstabt Ulrich Rösch führten kurz vor der Fertigstellung zu der vollständigen Schleifung der Anlage. Doch bereits im nächsten Jahr waren wesentliche Teile wieder aufgebaut und das Kloster konnte geweiht werden. Fertig gestellt wurde es aber erst Anfang des 16. Jahrhunderts. Nach dem Tod von Abt Rösch wurde die Anlage jedoch als äbtische Statthalterei genutzt. Kurzzeitig bestand hier auch eine theologische Universität. Im 19. Jahrhundert wurde in der Vierflügelanlage ein Lehrerseminar eingerichtet, heute dient es als Pädagogische Hochschule. Sehenswert ist der alte gotische Kreuzgang und der heute als Musiksaal genutzte Kapitelsaal. Während der Schulzeit kann die Anlage besichtigt werden.Der kolossartige Baukomplex des Benediktinerklosters Mariaberg gilt als die mächtigste Klosteranlage der Schweiz. Nur als Kloster diente das riesige Gebäude nie. Der erste Bau des Klosters wurde 1487 bis 1489 ausgeführt. Dort Streitigkeiten zwischen der Stadt St. Gallen und dem Fürstabt Ulrich Rösch führten kurz vor der Fertigstellung zu der vollständigen Schleifung der Anlage. Doch bereits im nächsten Jahr waren wesentliche Teile wieder aufgebaut und das Kloster konnte geweiht werden. Fertig gestellt wurde es aber erst Anfang des 16. Jahrhunderts. Nach dem Tod von Abt Rösch wurde die Anlage jedoch als äbtische Statthalterei genutzt. Kurzzeitig bestand hier auch eine theologische Universität. Im 19. Jahrhundert wurde in der Vierflügelanlage ein Lehrerseminar eingerichtet, heute dient es als Pädagogische Hochschule. Sehenswert ist der alte gotische Kreuzgang und der heute als Musiksaal genutzte Kapitelsaal. Während der Schulzeit kann die Anlage besichtigt werden.
Schätzungen gehen davon aus, dass es bereits zwischen den Jahren 750 und 820 eine erste Kirche in Rorschach gegeben hat. Diese wurde 1438 durch einen Neubau ersetzt, der im 17. und 18. Jahrhundert mehrfach vergrößert wurde. Bei dem Umbau zwischen 1783 – 85 erhielt das weiß getünchte Gotteshaus mit den barocken und klassizistischen Elementen sein heutiges Erscheinungsbild.
Um das Jahr 1000 lag Rorschach an einer beliebten Pilgerroute nach Santiago de Compostella. Als Raststätte für die Pilger hatte man nahe dem Hafen auf dem heutigen Kronenplatz die Jakobskapelle erbaut. 1833 wurde die frühmittelalterliche Kapelle jedoch wieder abgetragen. Zur Erinnerung entstand kurz darauf der Jakobsbrunnen und auch heute noch läutet täglich um 11:00 und 18:00 Uhr die Glocke von Hand zum Angelus. Der Jakobsbrunnen ist das Wahrzeichen Rorschachs und bildet einen Ausgangspunkt des Jakobwegs nach Santiago de Compostella.
Die heute eigentümlich anmutende Badeanstalt wurde 1924 eröffnet. Das Holzbauwerk, dass auf Stelzen im See steht, ist durch eine Brücke mit der Promenade verbunden. Die historische Badhütte in Rorschach ist die einzige Anlage dieser Art im Schweizerischen Bodensee.
Im ausgehenden 19. Jahrhundert hatte sich der protestantische Anteil in der Bevölkerung von Rorschach drastisch erhöht, so dass die alte evangelische Kirche zu klein geworden war. So entstand zwischen 1900 und 1904 ein burgähnlicher Kirchenneubau mit einem als Kuppel aufgesetztem Glockenturm. Von den Katholiken wurde der trutzig wirkende Neubau freilich als Provokation empfunden. Man hatte sich auf Seiten der reformierten Gemeinde bewusst gegen den um die Jahrhundertwende für Kirchenneubauten vorherrschenden neogotischen Stil entschieden und einen sehr offenen und schlichten Versammlungsraum geschaffen. Als ausführender Architekt zeichnete sich Albert Müller (1846 – 1912) verantwortlich. Müller war Professor für Architektur in Zürich und wurde bekannt durch den Bau mehrerer herausragender Jugendstilvillen.
Radrouten die durch Rorschach führen:
Goldach SG
m hügligen Appenzellerland am Rande des Rohrschacherberges liegt am Südufer des Bodensees das kleine gemütliche Dorf Goldach. Der Slogan der Gemeinde lautet ‚Goldach aktiv‘, da sie ein breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten bietet: Segeln, Rudern, Surfen, Tauchen, Baden auf oder im Bodensee, Spaziergehen, Wandern und Radeln im reizvollen Umland. Daneben wird ein abwechslungsreiches kulturelles Programm durch die lebendigen Dorfvereine geboten. Das reizvollste Bauwerk des Ortes ist die barocke Kirche St. Mauritius, dessen Vorgängerbau bereits in der Karolingerzeit errichtet wurde.
Sehenswertes:
Die katholische St. Mauritiuskirche in Goldach wurde 1670 im barocken Stil aus- und umgebaut. Ihre Ursprünge sind aber bedeutend älter. So wurde bei Grabungen noch Reste einer Kirche gefunden, die noch aus der Karolingerzeit stammen. Der erste Kirchturm war 1418 erbaut worden. 1929/30 kam es nach Plänen des berühmten Schweizer Architekten Adolf Gaudy (1872 – 1956) zu einer Verlängerung des Kirchenschiffes. Der neu entstandene Raum wird heute Pauluskapelle genannt.
Radrouten die durch Goldach SG führen:
Horn TG
ie Schweizerische Gemeinde Horn am südlichen Ufer des Bodensees ist eine thurgauische Enklave im Kanton St. Gallen. Horn gehörte im Mittelalter zum Kloster St. Gallen. Doch dann kam es zu einem Tauschgeschäft zwischen dem Abt von St. Gallen und dem Fürstenbischof von Konstanz. Fortan war Horn vollständig vom äbtischen Besitz umgeben. Als 1798 die helvetische Verfassung mit der Einteilung in Kantone in Kraft trat, blieb das Dorf eine thurgauische Exklave. Die Abkürzung ‚TG‘ hinter dem Gemeindenamen steht dann auch für den Kanton Thurgau.
Die Gemeinde mit Seeanstoss, wie es die Schweizer formulieren, besitzt insgesamt drei Häfen für Sportboote. Daneben bieten die ausgedehnten Wiesen und Wälder der Umgebung die Möglichkeit der Naherholung. In der bereits vor 5000 Jahren besiedelten Gegend hinterließen auch die Römer, die Kelten und die germanischen Alemannen ihre Spuren. ‚Horna‘ wurde als Ort erstmals 1155 in einer Urkunde des Kaisers Friedrich I. Barbarossa erwähnt. Im Jahre 1815 wurde Horn eine eigenständige Munizipalgemeinde.
Sehenswertes:
Etwas versteckt am Ortsrand der Schweizerischen Gemeinde Horn steht inmitten eines Schlossparkes mit sehr altem Baumbestand das Schloss Horn. Im Park befinden sich noch eine Remise aus dem 18. Jahrhundert sowie ein Gewächshaus mit einem Fresko des bekannten Ostschweizer Illustrators und Malers Theo Glinz.
Das kleine Schlösschen wurde im 16. Jahrhundert im Stil der Spätrenaissance für das schwäbische Kloster Ochsenhausen erbaut und kam im ausgehenden 18. Jahrhundert in adligen Besitz. Zuletzt beherbergte das Anwesen bis 2007 eine Privatschule.
Radrouten die durch Horn TG führen:
Steinach
itte des 15. Jahrhundert erlebte die kleine Gemeinde Steinach eine Blüte, weil die Stadt St. Gallen hier ihren Hauptumschlagplatz am Bodenseeufer errichten wollte. Damals entstand auch das Gredhaus als Waren- und Getreidelager. Das über 500 Jahre alte Gebäude ist heute sicherlich das auffälligste Gebäude des Dorfes. Bald danach fiel Steinach an das Kloster St. Gallen, blieb aber noch bis in das 19. Jahrhundert ein florierender Handelsort. Dann lief die Eisenbahn als Transportmittel dem Schiffsverkehr den Rang ab und die wirtschaftliche Bedeutung Steinachs nahm abrupt ab.
Der größte Teil des Gemeindegebietes ist relativ flach. Hier mündet das Flüsschen Steinach in den Bodensee. Etwas weiter flussaufwärts wird es bei Obersteinach aber schon recht bergig. Hier durchfließt die Steinach eine tiefe Schlucht, an derer oberer Kante sich einst die Steinerburg befand. Von der Burg aus dem 13. Jahrhundert blieb nur noch eine Ruine erhalten, die heute aber ein beliebtes Ausflugsziel darstellt.
Sehenswertes:
Oberhalb der Schlucht, die von dem Flüsschen Steinach durchflossen wird, stand einst die stolze Steinerburg. Die Burganlage war um 1200 durch die Herren von Steinach erbaut worden. Die Wehrburg hatte überwiegend aus Findlingen bestanden. Um 1230 errichtete man den zweistöckigen Turm. 1577 kam die Steinerburg in den Besitz des mächtigen Klosters St. Gallen. Nach der Säkularisierung wurden Teile der Anlage abgebrochen und die Burg verfiel zur Ruine. Drei Umfassungsmauern der einstigen Hauptburg sind noch erhalten. Die Ruine südlich der Ortschaft Steinach ist ein viel besuchtes Ausflugsziel.
Das über 500 Jahre alte Gredhaus ist das auffälligste Gebäude der Gemeinde. Es steht direkt am Bodensee und zeugt von einer Zeit, in der Steinach überregionale Bedeutung im Schiffsverkehr zukam. Im 14. Jahrhundert hatte die Stadt St. Gallen damit begonnen, hier am Bodensee einen städtischen Hafen und großen Umschlagplatz zu errichten. Dabei entstand das Gredhaus als Warenlager und Kornhaus, dem auch ein Wirtshaus angegliedert war. Der Handel blühte in Steinach bis in das 19. Jahrhundert. Die Bahnverbindung zwischen Rorschach und St. Gallen sorgte für den Niedergang des Schifftransportwesens. Heute dient das Gredhaus als Wohngebäude.
Als Nachfolgebau für ein zu klein gewordenes Gotteshaus entstand im Zentrum des Ortes Steinach ab 1742 die Jakobuskirche. Im Jahre 1746 wurde sie geweiht. Sehenswert sind der Hochaltar und die beiden Seitenaltäre von 1748 sowie die prächtigen Gemälde und Stuckaturen an der Decke.
Bemerkenswert ist, dass das Fundament auf dem sumpfigen Untergrund aus rund 1.500 Erlenpfählen besteht, die nebeneinander in den feuchten Boden geschlagen wurden. Die Kirchenglieder hatten bei der Arbeit fleißig selber mit Hand angelegt.
Die kleine Wegkapelle bei Obersteinach wurde 1674 als Privatkapelle gestiftet. Der rechteckige weiße Bau besitzt ein Satteldach mit einem aufgesetzten Dachreiter, der von einer welschen Haube bekrönt wird.
Radrouten die durch Steinach führen:
Arbon
ie drittgrößte Stadt des Kantons Thurgau liegt am Südufer der Bodensees und geht auf eine römische Siedlung mit Namen ‚Arbor Felix‘ zurück. Hier befand sich einst ein Römerkastell, das in der Spätantike zur Verteidigungslinie des Donau-Iller-Rhein-Limes gehörte. Bereits im 3. Jhd. n.Chr. wurden hier christliche Gottesdienste gehalten und so gilt Arbon als die älteste christliche Gemeinde am Bodensee. Besiedelt war das Gebiet aber schon bedeutend früher. Ausgrabungen förderten die Überreste von Pfahlbausiedlungen zutage, die noch aus der Jungsteinzeit stammen.
Touristisch interessant ist Arbon vor allem wegen seiner bezaubernden Altstadt und der wunderschönen Bodenseepromenade. In der historischen Altstadt reihen sich in den kleinen Gässchen schmucke Fachwerkhäuser aus dem 12. bis 15. Jahrhundert aneinander. Wahrzeichen der Stadt ist das Schloss am Rande der Altstadt, dessen Bergfried noch aus dem 10. Jahrhundert stammt. Seit dem 19. Jahrhundert ist Arbon Sitz der Adolph Sauer AG, die an ihrem Firmensitz am Bodensee ein interessantes Oldtimer-Museum mit historischen Lastwagen, Omnibussen und Militärfahrzeugen aus der eigenen Produktion betreibt.
Sehenswertes:
Am Rande der Altstadt steht etwas überhöht über dem Bodensee das Arboner Schloss. Das Wahrzeichen der Stadt bestand ursprünglich aus einer Burg mit Bergfried. Der Turm gehört noch zu dieser Anlage, die auf das Jahr 993 zurückgeht. Das weiß verputzte Schlossgebäude entstand erst 1515 und beherbergt heute das größte private Museum im Thurgau. Die Ausstellung präsentiert eine interessante Zeitreise durch die Geschichte der Stadt. Sie beginnt in der Jungsteinzeit mit den ersten Pfahlbausiedlungen, führt dann über die Bronzezeit zur Römerzeit, und über das graue Mittelalter bis zur Industrialisierung im 19./20. Jahrhundert. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Bau des Schlosses, die bewegte Kirchengeschichte, die Seegfrörni, den Leinwandhandel im 18. Jahrhundert und die Wohnkultur im Biedermeier gelegt. Bemerkenswert ist auch die Thurgauer Waffensammlung. Keinesfalls sollte man sich den Aufstieg auf den Bergfried entgehen lassen, denn er bietet einen wundervollen Blick über die Dächer der Altstadt und den Bodensee.
Wer als Besucher nach Arbon kommt, ist fasziniert von der sehenswerten Altstadt. Innerhalb der alten Stadtbefestigung finden sich zahlreiche Häuser aus dem Mittelalter und dem Barock. Die rückwärtigen Wände der Häuser wurden am Stadtrand in die dicke Stadtmauer integriert. Die Untertorgasse mit ihrer Häuserzeile bietet ein typisches Beispiel für diese Bauweise. Die Häuser sind hier teilweisen mit hübschen Wandmalereien ausgestattet. Andere Riegelhäuser beeindrucken mit ihrem außergewöhnlichen Fachwerk. Besonders sehenswert sind das heute als Bezirksgericht genutzte ehemalige Rathaus sowie die einstige Johanneskapelle.
Arbon verdankt seinen Namen einem römischen Kastell. Die spätrömische Anlage ‚Arbor Felix‘ wurde um 280 n.Chr. erbaut und fand im 4. Jahrhundert sogar mehrfach in antiken Dokumenten Erwähnung. Sie gehörte zur Verteidigungslinie des Donau-Iller-Rhein-Limes. Doch lange Zeit konnte man den genauen Standort nicht bestimmen. Erst 1957 konnten archäologische Mauerfunde diesem Kastell zugeordnet werden. Die Anlage wurde im Mittelalter komplett überbaut und befindet sich im Bereich der heutigen Altstadt. Vom spätrömischen Kastell, das gegen 420 aufgegeben wurde, sind noch wenige Überreste, wie der eines alten Wachturmes, erhalten.
Vermutlich besitzt Arbon die älteste christliche Gemeinde am Bodensee, denn bereits in römischer Zeit (3. Jhd.) wurden hier Gottesdienste gefeiert. Die St. Martinskirche in ihrer heutigen Form war zwischen 1786 und 1789 innerhalb des ehemaligen römischen Kastells erbaut worden, wobei der prächtige neugotische Chor aus dem 15. Jahrhundert von der Vorgängerkirche übernommen wurde. Der Turm war im ausgehenden 19. Jahrhundert noch einmal erhöht worden. Bis 1924 war das Gotteshaus sowohl von der katholischen als auch von der evangelischen Gemeinde paritätisch genutzt worden.
Das Rot(h)e Haus gegenüber der Kirche war um 1750 als privates Handelshaus erbaut worden. Seit 1902 dient es als Pfarrhaus der katholischen Kirche.
Der hl. Gallus wirkte als Wandermönch und Missionar in der Region des Bodensees. Er wurde um das Jahr 550 in Irland (nach anderen Quellen in den Vogesen/Elsass) geboren und verstarb hochbetagt um 640 in Arbon. Seine Klause im Steinachtal gilt als Keimzelle des Klosters St. Gallen und damit auch der gleichnamigen Stadt, dessen Schutzpatron er heute ist. Gleich neben der Kirche St. Martin entstand ihm zu Ehren bereits im 12. oder 13. Jahrhundert die kleine Galluskapelle. In einer Mauernische sind die angeblichen Fußabdrücke des Heiligen in einem Stein eingemauert worden.
Hinter der Szenerie: Der Fußabdruck des hl. Gallus Als der gottesfürchtige irische Wanderprediger Gallus nach Arbon kam, traf er auf den Teufel und forderte diesen zum Zweikampf heraus. Als sich beide hasserfüllt und zum äußersten bereit gegenüberstanden, erhitzte sich der Boden unter ihnen so stark, dass er aufweichte und die Abdrücke zweier Füße aufnahm: die des Heiligen und die des Satans. Der Stein mit den beiden eingedrückten Kampfspuren wurde in der Kapelle, die dem berühmten Missionar zu Ehren erbaut wurde, in eine Mauernische integriert und erinnert so noch heute an diese Begebenheit.
Am Ufer des Bodensees erstreckt sich über vier Kilometer die Seepromenade von Arbon. Sie beginnt an der markanten Kastanienallee der Steinacherbucht und führt an einer wunderschönen Parkanlage entlang bis zum Hafen, an dem sich die vielen Bötchen und Segelyachten im leichten Wellengang klirrend hin und her wiegen. Auf der anderen Seite des Hafens führt der Spazierweg an freien Badestellen vorbei bis zum Schwimmbad. Der Park bietet Picknickplätze, wunderschön gestaltete Blumenbeete, einen Musikpavillon, Kinderspielplatz und natürlich einen herrlichen Blick auf das türkis glitzernde Wasser des Bodensees.
Das eigenwillige Gebäude mit dem überkragenden Obergeschoss, in dem sich heute das Bezirksgericht befindet, war zwischen 1750 bis 1941 das Rathaus der Stadt Arbon. Es wurde im 13. Jahrhundert erbaut und diente zunächst als Wachturm. Nachdem ein Brand 1994 das gesamte Dachgeschoss zerstört hatte, ist das historische Gebäude inzwischen originalgetreu und denkmalgerecht wiederhergestellt worden.
Die Adolph Sauer AG war im letzten Jahrhundert der bedeutendste Lastwagenhersteller in der Schweiz. In der Fabrik in Arbon entstanden auch Autobusse und schwere Militärfahrzeuge. Die Firma wurde 1853 als Eisengießerei in St. Gallen gegründet. Schon bald erfolgte der Umzug nach Arbon am Bodensee, wo man sich zunächst auf die Fabrikation von Stickmaschinen konzentrierte. Ab 1903 baute man in den firmeneigenen Hallen die ersten Nutzfahrzeuge, während des Ersten Weltkrieges sogar Flugzeugmotoren. Bis in die 1980er Jahre hinein produzierte Saurer erfolgreich seine eigenen LKWs. 1987 wurde dann jedoch der letzte Militärwagen ausgeliefert. Noch bis 2002 wurden Omnibusse unter dem Markennamen ‚NAW‘ hergestellt, doch dann endete die Lastwagenproduktion endgültig. Heute gehört die Saurer AG zu den weltgrößten Textilmaschinenherstellern, aber auch dem Fahrzeugbau blieb das Unternehmen mit der Entwicklung und der Konstruktion von Getrieben treu.
Am alten Produktionsstandort am Bodensee erzählt das Saurer-Oldtimer-Museum von der Geschichte des Unternehmens. Die Sammlung von Nutzfahrzeugen zeigt allerlei historische Raritäten, vom Omnibus bis zum Feuerwehrwagen, darunter auch der ‚M8‘, der als das erste schwere Geländefahrzeug gilt. Der älteste LKW stammt noch aus dem Jahre 1911. Daneben präsentiert die Ausstellung Motoren unterschiedlichster Baugrößen, Stickmaschinen und verschiedene Webstühle.
Die Johanneskapelle, heute im Volksmund liebevoll ‚Kappeli / Chappeli‘ genannt, entstand um 1390 als einzige Kirche innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer. Hundert Jahre später wurde sie noch einmal nach Osten hin vergrößert, doch 1777 wurde die Kapelle von der Kirche aufgegeben. Nun wurde das profanierte Gebäude als Lagerhaus, als Büro des städtischen Waagmeisters und als Feuerwehrdepot genutzt. Im letzten Jahrhundert diente es dann als Brockenhaus. So werden in der Schweiz Gebrauchtwarenläden bezeichnet, in denen günstig Alltagsgegenstände verkauft werden. Das ehemalige Kirchengebäude mit den Laubengängen besitzt noch einige wertvolle mittelalterliche Wandmalereien, die bei Renovierungen ab 2012 freigelegt und konserviert wurden.
Die traditionelle Thurgauer Mosterei Möhl präsentiert im firmeneigenen Brennerei- und Saftmuseum historische Maschinen und Apparate der im Oberthurgau typischen Süssmost- und Apfelweinherstellung. Die Mosterei besteht schon seit 1895. Nach einem Rundgang durch den Betrieb können hier auch die verschiedenen Säfte verköstigt werden.
Radrouten die durch Arbon führen:
Egnach
ie Gemeinde Egnach liegt im Oberthurgau im Grenzgebiet zu St. Gallen. Sie besitzt einen ausgesprochen dörflichen Charakter. Hier bestehen die Ortsteile noch aus Weilern und einzelnen Gehöften, von denen einige zum Urlaub auf dem Bauernhof einladen. Obwohl das Gemeindegebiet einen Zugang zum Bodensee besitzt, liegt der Kernort etwas landeinwärts. Vermutlich war das Gebiet schon durch die Kelten und Römer besiedelt. Später gehörte Egnach zum Bistum Konstanz, wobei die Bürger auch dem Landvogt in Frauenfeld gegenüber abgabepflichtig waren. Schloss Luxberg war eine Zeitlang der Wohnsitz des Obervogtes.
Sehenswertes:
Nahe der Mündung des Wiilerbaches in den Bodensee steht in einem großen Park das Schloss Luxberg. Das Gut wurde im ausgehenden 14. Jahrhundert als Justizsitz für das Bistum Konstanz im altgotischen Stil erbaut. Bald danach kam die ehemalige Wasserburg in den Besitz reicher Patrizier, die das Anwesen erheblich umbauen und modernisieren ließen. Zeitweilig diente das Hohe Schloss im 18. Jahrhundert als Wohnsitz des Obervogtes. Heute gehört Schloss Luxberg der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte. Auffällig ist der hohe Turm mit seiner geschwungenen welschen Haube.
Die weiße Kirche prägt das Ortsbild von Egnach. Das 1727 erbaute evangelische Gotteshaus überragt mit seinem auffälligen Kirchturm das gesamte Dorf. Die Kirchturmkuppel mit ihrer neubarocken welschen Haube und der darunter befindlichen sogenannten ‚Laterne‘ ersetzte allerdings erst im Jahre 1900 die ursprüngliche Turmspitze.
In unmittelbarer Nähe der Kirche steht das alte Pfarrhaus. Der Putz des Fachwerkbaus wurde 1939 wieder abgenommen, so dass das Gebäude heute wieder sein historisches Erscheinungsbild besitzt.
Radrouten die durch Egnach führen:
Salmsach
almsach präsentiert sich als intakte Dorfgemeinschaft im Osten des Kantons Thurgau. Die Gemeinde besitzt einen ausgesprochen ländlichen und gemütlichen Charakter und liegt malerisch an der Salmsacher Bucht des Bodensees. Die Aach bildet als Fluss im Norden die Grenze zu Romanshorn. Angeblich bildete sich der Ort als Siedlung um die Kirche herum, die vor 1000 Jahren durch den Bischof Salomon gestiftet worden sein soll. Aus dem Namen ‚Salomon-Aach‘ entwickelte sich mit der Zeit der Dorfname ‚Salmsach‘.
Sehenswertes:
Die alte Kirche von Salmsach soll vor rund 1000 Jahren durch den Bischof von Konstanz als Kapelle gestiftet worden sein. Zum ersten Mal wurde sie im Jahre 1201 in einem alten Dokumente erwähnt. Seitdem wurde das Kirchlein mehrfach aus- und umgebaut. Nach der Reformation wurde das Gotteshaus überwiegend evangelisch genutzt. 1701 entstand neben der Dorfkirche das Pfarrhaus.
Hinter der Szenerie: Dem Blitz entkommen! Um das Jahr 1000 reiste der brave Bischof Salomon zu Fuß von Konstanz nach St. Gallen. Da zog plötzlich ein gewaltiges Unwetter auf: Der Wind peitschte den Regen über das Land, die Blitze zuckten und das Grollen der Donner ließ den Gottesmann erschauern. Er sah sich verzweifelt nach einem geeigneten Schutz um, da erspähte er einen mächtigen Eichenbaum, unter dem sich bereits drei Bauern gesellt hatten. Er eilte auf den Baum zu und hatte ihn schon fast erreicht – da schoss ein greller Blitz, zugleich begleitet von einem ohrenbetäubenden Krachen, direkt vor ihm in das Gehölz und ließ die Eiche in der Mitte zersplittern! Die drei unglücklichen Bauern waren auf der Stelle tot, doch der Bischof überlebte. Aus Dankbarkeit für diese wunderbare Rettung stiftete Bischof Salomon an diesem Ort eine Gedenkkapelle. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich um das Kirchlein eine kleines Dorf, dass man ‚Salomons-Aach‘ nannte. Mit der Zeit wurde daraus der Name ‚Salmsach‘.
Radrouten die durch Salmsach führen:
Romanshorn
eitdem Romanshorn im Jahr 2012 die 10.000-Einwohner-Marke überschritten hat, darf man sich stolz ‚Stadt‘ nennen. Dennoch hat sich die ‚Stadt am Wasser‘ einen charmanten und gemütlichen Charakter bewahrt. Geprägt wurde der Ort durch seine Verkehrslage. Er besitzt von der Fläche her den größten Hafen am Bodensee. Autofähren fahren ins gegenüber liegende Friedrichshafen. Personenschiffe verbinden Rorschach u.a. mit Kreuzlingen, Lindau, Stein am Rhein, Schaffhausen, Rorschach und der Insel Mainau. Seit 1855 die Eisenbahn gebaut wurde, hat sich Romanshorn sprunghaft zu einem modernen Industriestandort gemausert. Zuvor war Romanshorn durch die Jahrhunderte ein kleines, verschlafenes Fischerdorf gewesen. Im Jahre 779 wurde das Dorf erstmals urkundlich erwähnt. Lange gehörte es zum Einflussbereich des Klosters St. Gallen und das heute als Hotel genutzte Schloss diente als äbtische Vogtei. Die Alte Kirche wurde bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts paritätisch durch die Reformierte und die Katholische Gemeinde genutzt. Dann wurde sie zu klein und beide Konfessionen erbauten sich ein eigenes größeres Gotteshaus.
Sehenswertes:
Aus einem schriftlichen Dokument aus dem Jahre 779 geht hervor, dass eine Kirche in Romanshorn bereits zu diesem Zeitpunkt bestanden hatte. Seitdem wurde das Gotteshaus mehrfach umgebaut, doch fanden sich bei Renovierungsarbeiten im 20. Jahrhundert noch uralte Fundamente und die Reste mittelalterlicher Waldmalereien.
Als die Reformation 1529 nach Romanshorn kam, trat auch der amtierende Pfarrer zum evangelischen Glauben über. Die katholische Ausstattung wurde entfernt und fortan wurden erst einmal nur noch protestantische Gottesdiente gehalten. Erst nach 50 Jahren erhielt der Ort wieder einen katholischen Geistlichen und seitdem wurde die Kirche von beiden Konfessionen paritätisch genutzt. Anfang des 20. Jahrhunderts bauten sowohl die reformierte als auch die katholische Gemeinde ihre eigenes neues Kirchengebäude und die Alte Kirche stand somit erst einmal brach. Inzwischen wird sie von beiden Konfessionen wieder vielfältig genutzt, beispielsweise für Hochzeiten und Konzerte.
Auf dem Schlossberg am Bodensee steht in unmittelbarer Nähe der mittelalterlichen Kirche das Schloss Romanshorn. Es wurde im Jahre 1404 erbaut und diente bis in das ausgehende 18. Jahrhundert hinein als äbtische Vogtei des Klosters St. Gallen, ehe es an den neugeschaffenen Kanton Thurgau fiel und später in privaten Besitz gelangte. Umgeben von einem hübschen Schlosspark, dient das historische Gebäude heute als Hotel und Restaurant.
Nachdem die Reformation in Romanshorn Einzug hielt, wurde die Alten Kirche über 300 Jahre lang paritätisch von beiden Konfessionen genutzt. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts ließen sowohl die Reformierte als auch die Katholische Gemeinde ein neues Gotteshaus errichten.
Die Pläne für die neue katholische Pfarrkirche schuf der berühmte Schweizer Architekt Adolf Gaudy (1872 – 1956). Gaudy lebte seit 1904 in Rorschach. Er war berühmt für seine retrospektiven Kirchenbauten im Stile des Historismus. Die Kirche in Rorschach erschuf er zwischen 1911 und 1913 im neuromanischen Stil auf dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes.
Radrouten die durch Romanshorn führen:
Uttwil
m Schweizer Südufer des Bodensees liegt die Schweizer Gemeinde Uttwil. Erstmals wurde der Ort schon im frühen 9. Jahrhundert erwähnt, aber zu einer Blüte kam es erst im 16. Jahrhundert, als Uttwil der wichtigste Umschlagplatz für Korn und Salz am südwestlichen Bodenseeufer wurde. Einige der vornehmen Fachwerkhäuser und das Schloss entstanden in dieser Zeit. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde Uttwil zu einer Künstlerkolonie, in der sich unter anderen der belgisch-flämischen Architekt und Designer Henry Clement van de Velde, der Maler Ernst Emil Schlatter und die Schriftsteller Paul Ilg und Carl Sternheim niederließen. Der Ort schrieb Geschichte, als es im 17. Jahrhundert durch den Abriss einer Kapelle fast zum Bürgerkrieg zwischen den Konfessionen gekommen wäre. Die Geschichte wurde unter dem Begriff ‚Uttwiler Handel‘ bekannt.
Sehenswertes:
Der Begriff ‚Schloss‘ ist eigentlich etwas übertrieben für das Gebäude, das auf einer kleinen Halbinsel etwas in den Bodensee hineinragt. 1822 hatte die Familie Dölli das Gebäude zu einem Landhaus im französischen Stil umgebaut. Vorher hatte das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert als Lagerhaus gedient. Anfang des 20. Jahrhundert wohnte in dem Haus der bekannte belgisch-flämischen Architekt und Designer Henry Clement van de Velde (1863 – 1957).
Mitte des 15. Jahrhunderts errichteten die Dorfbewohner Uttwils aus eigenen Mitteln eine kleine Kirche, die der hl. Anna geweiht wurde. Schon früh zog 1524 in Uttwil die Reformation nach Zwingli ein und die Kirche wurde dadurch evangelisch. Nachdem man das Gotteshaus Mitte des 17. Jahrhunderts und gegen Ende des 18. Jahrhunderts erheblich vergrößerte, gestaltete man es siebzig Jahre später im neogotischen Stil wieder um.
In der evangelisch-reformierten Kirche werden vereinzelnd auch katholische Gottesdienste abgehalten.
Hinter der Szenerie: Der Uttwiler Handel Im 13. Jahrhundert entstand im schönen Uttwil am Bodensee die St. Adelheidskapelle. Sie diente zunächst als Wallfahrtskapelle, verfiel dann aber bald ungenutzt, denn gleich nebenan hatten die Uttwiler eine eigene Kirche erbaut. Die als frech und renitent geltenden Uttwiler hatte sich schon früh zum reformierten Glauben nach Zwingli bekannt. Der Katholizismus konnte hier seitdem keinen Fuß mehr fassen. Soweit zur Vorgeschichte, wir springen in das Jahr 1644. Mittlerer weile war das Uttwiler Kirchengebäude zu klein geworden für das stetig wachsende Dorf. Aber um das Gotteshaus zu vergrößern, stand die alte, von Pflanzen überwucherte Ruine der Adelheitskapelle im Wege. ‚Kein Problem‘, meinte der Zürcher Landvogt, ‚ihr könnt die verfallene Kapelle niederreißen. Da kümmert sich ja eh‘ seit vielen Jahrzehnten keiner mehr drum!‘ Doch da irrte der Landvogt gewaltig. Die Äbtissin des Stiftes, zu der die marode Kapelle gehörte, setzte urplötzlich Himmel und Hölle in Bewegung, um das Bauvorhaben der ketzerischen Protestanten zu verhindern. Sie fand Unterstützung in fünf benachbarten Orten und der Weiterbau wurde verboten! Doch die Uttwiler waren sehr schnell. Unter Berufung auf den Bescheid vom Landvogt zogen sie ihren Kirchenbau unbeirrt in Rekordgeschwindigkeit hoch! Das war jetzt dumm für die fünf besagten Orte, die natürlich bei dieser Geschichte nicht ihr Gesicht verlieren wollten. Aber ein fertiges Gotteshaus abzureißen, kam nicht in Frage. So sorgte man dafür, dass Uttwil eine mächtige Strafe zu zahlen hatte, die der Ort beim besten Willen nicht hätten aufbringen können. Da kamen die protestantischen Zürcher den ‚unschuldigen Märtyrern‘ von Uttwil zu Hilfe und übernahmen einen Großteil der Strafe. Nun schlug sich aber das katholische Bern auf die Seite der fünf anklagenden Orte und es drohte ein Bürgerkrieg, der 1651 durch allerlei diplomatisches Geschick erst im letzten Augenblick verhindert werden konnte! Soweit der dramatische Teil. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die enttäuschte Äbtissin versuchte nun mit aller Macht, auf dem Kirchhof eine neue katholische Kapelle zu erbauen – das konnte den Uttwilern natürlich nicht gefallen. Und so zog sich der Streit, der heute als ‚Uttwiler Handel‘ bekannt ist, noch über weitere Jahrzehnte hin, bis er 1696 endgültig mit viel Hilfe der ‚Herren zu Zürich‘ beigelegt wurde. Die Kapelle wurde nicht gebaut – basta!
Das alte Fachwerkhaus wurde 1722 durch die wohlhabende Handelsfamilie Dölli als Kehlhof erbaut. Die Familie hatte entscheidenden Anteil daran, dass Uttwil der wichtigste Umschlagplatz für Korn und Salz am südwestlichen Bodenseeufer wurde. Das Gasthaus Frohsinn mit seinen rot bemalten Holzbalken beherbergt ein edel-rustikales Restaurant mit historischem Flair.
Radrouten die durch Uttwil führen:
Kesswil
eprägt von einer herrlichen Landschaft am Bodensee und von Fachwerkhäusern, die noch aus dem 17. Jahrhundert erhalten sind, wirkt die ländliche Wohngemeinde Kesswil vor allem ruhig und beschaulich. Der Ort wurde im Jahre 817 erstmals als ‚Chezzinwillare‘ erwähnt und unterstand lange dem Herrschaftsbereich des Klosters St. Gallen. Wein- und Obstanbau, Ackerbau und Fischerei spielen bis heute eine wichtige Rolle in dem Dorf, das zu ausgedehnten Spaziergängen am See oder durch die Wälder einlädt.
Sehenswertes:
Am Kreisel des Ortszentrums von Kesswil, dort wo auch das Gemeindehaus und die alte Mühle steht, befindet sich auch die Dorfkirche St. Adelheid. Sie wurde bereits 1429 als kleine Kapelle errichtet und 1644, als die Reformation bereits in Kesswil Einzug gehalten hatte, zu der heutigen Größe ausgebaut. Die schlichte Innenausstattung folgt dem Ansatz der reformierten Kirche, die zunächst sogar auf Musik verzichtete. Die Orgel erhielt das Gotteshaus erst 1921.
Radrouten die durch Kesswil führen:
Güttingen
as Dorf Güttingen im Kanton Thurgau wird auf der einen Seite vom hellblau leuchtenden Bodensee und auf der anderen Seite von einem riesigen dunklen Wald begrenzt, der zu den größten Eichenwäldern Europas gehört. Vom Seeweg erlebt man wunderschöne Ausblicke auf den plätschernden Bodensee. Güttingen besitzt eine alte Schiffertradition und auch heute noch werden im Hafen Frachtschiffe be- und entladen. Sehenswert sind die paritätische Kirche, deren Ursprünge noch im Mittelalter liegen und das Schloss Moosburg am Ufer des Bodensees.
Sehenswertes:
Mitte des 13. Jahrhunderts erbauten die Freiherren von Güttingen am Ufer des Bodensees die Moosburg. Die einst zweifach von Gräben umgebene Wasserburg wurde im 19. Jahrhundert abgetragen. Aus den Grundmauern der alten Burg ließ Baron von Barion um 1850 ein dreistöckiges klassizistisches Schloss erbauen, der heute als privater Gutshof dient.
Wann die Dorfkirche von Güttingen genau entstand, ist nicht bekannt. Eine Kapelle hat es wohl schon im 12. Jahrhundert gegeben. Gesichert ist, dass im 15. Jahrhundert eine Kirchweihe nach einem größeren Umbau stattfand. Der Kirchturm wurde bereits 1493 fertig gestellt, erhielt seinen markanten Aufsatz, der an einen Aussichtsturm erinnert, erst um 1840. Nach der Reformation wurde die Kirche paritätisch von beiden Konfessionen genutzt. Bemerkenswert ist die Figur des hl. Stephanus an der linken Seitenwand. Gekleidet im roten Märtyrergewand hält er einen Stein in seiner rechten Hand.
Einst standen in Güttingen drei stolze mittelalterliche Burgen, von denen aber keine mehr erhalten ist. Aber es gibt noch zwei Schlösser, die im 19. Jahrhundert als Nachfolgebauten entstanden. Eines davon ist Schloss Güttlingen. Das zweistöckige rote Gebäude besitzt ein auffällig hohes Walmdach und liegt malerisch direkt am Ufer des Bodensees.
Radrouten die durch Güttingen führen:
Altnau
uf der Moräne eines eiszeitlichen Gletschers liegt am südlichen Ufer des Bodensees das Dorf Altnau. Hier ist das Wasser am Ufer sehr flach, so dass der erst 2010 errichtete Schiffsanleger mit 270 Metern Länge weit in den Bodensees hinaus führt. Er ist der längste Anlegesteg im Bodensee. Der Ortskern liegt mit seinen beiden Kirchen etwas zwei Kilometer landeinwärts. Wo man auch hinsieht, stehen dicht an dicht die endlos erscheinenden Obstgärten. Mit 30.000 Apfel- und Birnbäumen nennt sich Altnau auch gerne das ‚Apfeldorf am Bodensee‘. Passend dazu errichtete man hier einen interessanten Rundwanderweg, den ersten Obstlehrpfad der Schweiz.
Sehenswertes:
Schon von weitem erkennt man den hohen Spitzhelm der auf einer kleinen Anhöhe stehenden Dorfkirche. Sie wurde erst 1810 – 1812 erbaut, besaß aber auch davor bereits einen Kirchenbau. Glocken hat das Gotteshaus aber erst 1894 erhalten. Obwohl der Innenraum sparsam geschmückt ist, gilt er aufgrund seiner Stuckaturen, der Säulen sowie der Orgel, die ursprünglich aus der Wallfahrtskirche Birnau stammt und älter als das Kirchengebäude selber ist, als einer der schönsten der Region.
Ein ausgeschilderter Rundwanderweg von 9 km Länge, der auch mit dem Rad abgefahren werden kann, führt einmal entlang der Obstgärten um das Dorf Altnau herum. Start und Zielort ist der Parkplatz am Bahnhof. Der Lehrpfad vermittelt viel Wissenswertes über die Pflege von Apfel- und Birnenbäumen, über das Reifen der Früchte und über die Ernte.
Radrouten die durch Altnau führen:
Münsterlingen
m südlichen Ufer des Bodensees befindet sich auf der fruchtbaren Endmoräne eines eiszeitlichen Rheingletschers die noch junge Gemeinde Münsterlingen. Sie war erst 1994 durch den Zusammenschluss der zuvor selbstständigen Gemeinden Scherzingen und Landschlacht geschaffen worden. Die leicht welligen Hänge des Seerückens sind geprägt vom Obst- und Weinanbau, die flachen Uferbereiche sind zum großen Teil naturbelassen. Den Namen und auch das Wappen entlehnte die Gemeinde dem ehemaligen Kloster Münsterlingen. Die hübsche einstige Klosterkirche dient heute als katholische Pfarrkirche. Die evangelische Kirche ist der älteste reformierte Kirchenbau im Kanton Thurgau. Sehenswert ist auch die Kapelle im Ortsteil Landschlacht, deren Bausubstanz zum großen Teil über 1000 Jahre alt ist und die somit zu den ältesten Gotteshäusern am Bodensee gehört.
Sehenswertes:
Ihren Ursprung hat das Kloster Münsterlingen schon im 10. Jahrhundert. Direkt am Ufer des Bodensees hatten Augustinerinnen ein Nonnenkloster gegründet, in dem sie sich schon damals der Krankenpflege widmeten. Im 16. Jahrhundert markierte die Reformation einen tiefen Einschnitt in die Geschichte des Klosters. Sowohl der Pfarrer als auch die Nonnen schlossen sich dem reformierten Glauben an. Die Klosterkirche wurde zunächst für beide Konfessionen zugelassen, bis die Protestanten 1617 ihr eigenes Gotteshaus erbauten. Im Zuge der Rekatholisierung zogen nun Benediktinerinnen in das Klostergebäude ein.
Anfang des 18. Jahrhunderts wurde das Kloster etwas landeinwärts verlegt. Die neue Klosterkirche entstand zwischen 1711 und 1716 im barocken Stil. Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch übernahm der Kanton Thurgau aus Kostengründen den Gebäudekomplex und der Konvent wurde aufgehoben. Dennoch dient das ehemalige Kloster auch heute noch als Spital und Psychiatrische Klinik. Die ehemalige Klosterkirche wird heute als katholische Pfarrkirche genutzt und ist dem hl. Remigius geweiht. In ihr steht auch die Büste des Johannes, die während der alljährlich stattfindenden Eisprozession quer über den Bodensee getragen wird.
Im Jahre 1524 kam die Reformation auch in den Thurgau. Der Pfarrer des Klosters Münsterlingen wandte sich dem reformierten Glauben zu und auch die Nonnen nahmen den evangelischen Glauben an. Mitte des 16. Jahrhundert wurde von Konstanz aus die Rekatholisierung vorangetrieben, was auch in Münsterlingen zum Streit über die Kirchennutzung führte. So wurde bereits 1617/18 in Scherzingen eine neue evangelische Kirche gebaut, die damit das älteste Gotteshaus der reformierten Konfession im gesamten Kanton Thurgau wurde. Ihr schlanker Kirchturm mit dem hohen Spitzhelm ist schon von weitem zu sehen.
Die St. Leonardskapelle im Ortsteil Landschlacht gehört zu den ältesten Kirchen des gesamten Bodenseeraumes. Der westliche Teil ist romanisch und wurde bereits vor dem Jahr 1000 aus groben Feldsteinen errichtet Die gotische Erweiterung stammt aus dem späten 14. Jahrhundert. Sehenswert sind die umfangreichen Fresken im Inneren der Kapelle. Die ältesten Malereien stammen noch aus dem 11. Jahrhundert. Besonders gut erhalten sind der Leonhardszyklus und der Passionszyklus. Beide stammen aus dem 15. Jahrhundert.
Radrouten die durch Münsterlingen führen:
Bottighofen
ie Gegend um das beschauliche Schweizer Dorf Bottighofen am Südufer des Bodensees wurde schon in prähistorischer Zeit besiedelt. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde es im Jahre 830 als ‚Pottinchovum‘. Während des Mittelalters gehörte das Dorf zum Kloster Münsterlingen. Vier Mühlen hatte es hier einmal gegeben, von denen drei zumindest als Gebäude noch erhalten sind. Sie alle sind nicht mehr in Betrieb und dienen heute als Wohnhäuser. 1991 war auch die ‚Untere Mühle‘ als letzte stillgelegt worden. Bottinghofen besitzt eine direkte Schiffsverbindung nach Konstanz.
Sehenswertes:
Im ersten Stockwerk des Werkhofes befindet sich das Dorfmuseum. Es beruht auf der Sammlung von Alois Gantenbein. Im Laufe vieler Jahre trug er ein Sammelsurium zusammen, dass die Ortsgeschichte von Bottighofen dokumentiert und das so manche Geschichte erzählen könnte. Zu den Exponaten gehören Alltagsgegenstände aus vergangenen Tagen und eine große Fotosammlung.
Radrouten die durch Bottighofen führen:
Kreuzlingen
reuzlingen ist mit über 20.000 Einwohnern die größte Schweizer Stadt am Bodensee. Ihre Geschichte ist eng mit der der deutschen Schwesterstadt Konstanz verknüpft. Als eigenständige Gemeinde entstand sie aber eigentlich erst in den 1920er Jahren, als man die Dörfer Egelshofen, Kurzrickenbach und Emmishofen zusammenfügte. Während Kurzrickenbach noch immer seinen dörflichen Charakter bewahrt hat, wurden in Egelshofen etliche Industriebetriebe angesiedelt. Emmishofen dagegen macht mit seinen Schlössern und Landsitzen einen eher gediegenen und mondänen Eindruck. Der Name der Stadt leitet sich von dem Kloster ‚Crucelin‘ ab, das 1125 entstand, aber nach zweimaliger Zerstörung erst 1650 am heutigen Ort errichtet wurde. Gemeinsam mit der ehemaligen barocken Klosterkirche St. Ulrich und Afra ist der ehemalige Stift die Hauptsehenswürdigkeit der Grenzstadt, deren nördliche Stadtgrenze auch gleichzeitig die Landesgrenze zu Deutschland bildet. Das Grenzgebiet ist dicht besiedelt, so dass nach dem Abbau der Grenzanlagen die Städte Kreuzlingen und Konstanz ineinander übergehen. Der Hafen und die Altstadt von Konstanz liegen in Fußwegentfernung von der Grenze entfernt.
Der Seeburgpark ist das beliebte Naherholungsgebiet der Kreuzlinger. Er erstreckt sich über 2,5 km am Ufer des Bodensees zwischen dem Hafen und der Gemeindegrenze zu Gottlieben. Neben Spielwiesen und einem sehr alten Baumbestand befindet sich hier das alte Schloss Seeburg, das Seemuseum und der Tierpark. Weitere sehenswerte historische Gebäude sind die Schlösser Bernegg, Brunegg und Girsberg sowie die Kirche in Bernrain.
Sehenswertes:
1125 ließ der Konstanzer Bischof Ulrich I. von Kyburg-Dillingen in Kreuzlingen ein Augustinerkloster-Chorherrenstift, das dem hl. Ulrich (923-973), einstiger Bischof von Augsburg und der hl. Afra gewidmet wurde. Der Stift wurde im Laufe der Zeit zum mächtigen Reichskloster. Doch zweimal wurden die Stiftsgebäude durch die Konstanzer zerstört. Danach baute man das Kloster etwas nach Süden versetzt an einer neuen Position wieder auf. 1653 wurde schließlich die heutige barocke Klosterkirche geweiht und 1760 folgte der Bau der Ölberg-Kapelle. Nur wenig später wurde die Basilika und Teile des Klosters im damals modernen Stil des Rokokos umgestaltet. Nach der Aufhebung des Klosters im Jahre 1848 wurde das Gotteshaus als katholische Pfarrkirche weitergenutzt.
Bei Renovierungsarbeiten im Jahre 1963 kam es zu einem verheerenden Brand, bei dem die ehemalige Klosterkirche stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach ihrem Wideraufbau erstrahlte sie aber wieder im alten Glanz und gilt heute als eine der Hauptattraktionen Kreuzlingens. Ein Zimmer im Hausmuseum dokumentiert den Wiederaufbau der Basilika.
Neben der prächtigen Ölbergkapelle sind das aufwendig gestaltete Chorgitter (1737) und das Deckengemälde von Franz Ludwig Herrmann (1761) sehr sehenswert.
Im 10. Jahrhundert wurde durch den Konstanzer Bischof Konrad I. ein Hospital gestiftet, das aber nach einiger Zeit zerfallen und unbrauchbar geworden war. Erst 1125 erneuerte Bischof Ulrich I. von Kyburg-Dillingen die Stiftung und errichtete ein Augustinerkloster-Chorherrenstift, das dem hl. Ulrich (923-973), einstiger Bischof von Augsburg und der hl. Afra gewidmet wurde. Nachdem sowohl Papst Lucius II. als auch Kaiser Friedrich Barbarossa das Kloster Mitte des 12. Jahrhunderts unter ihren Schutz stellten, wurde es zum mächtigen Reichskloster. Zweimal wurden die Klostergebäude in der Folgezeit durch die Konstanzer zerstört. 1653 wurde schließlich am neuen Ort die heutige Klosterkapelle geweiht. Im Jahre 1848 wurde das Kloster jedoch durch die Regierung des Kantons Thurgau aufgehoben. Die beachtliche mittelalterliche Bibliothek wurde in die Kantonsbibliothek integriert. Heute dienen die historischen Gebäude als Erwachsenenschule. Das ehemalige Kloster und die ehemalige Klosterkirche sind heute die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Kreuzlingens.
Der einstige Konvent mit der Basilika, der Ölbergkapelle und der Sakristei mit dem Kirchenschatz kann im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Interessant ist dabei auch das Hausmuseum im dritten Stock über der Sakristei. Hier werden Kunstwerke und Urkunden aus der Klosterzeit präsentiert und der Wiederaufbau der Basilika St. Ulrich und Afra dokumentiert. Das Gotteshaus war bei einem verheerenden Feuer 1963 erheblich beschädigt worden.
Egelshofen war eines von drei Dörfern, aus denen die heutige Stadt Kreuzlingen erwuchs. Bis 1874 war Egelshofen noch eine selbstständige Gemeinde. Erst 1724 hatte der Ort eine eigene reformierte Kirche bekommen. Das stolze weiße Gotteshaus erhielt bei einem umfangreichen Umbau 1898 sein heutiges Aussehen.
An dem historischen Kirchenbau fällt sofort der überproportionale Dachreiter auf, der dem Gotteshaus aber erst 1966 aufgesetzt wurde. Zu dieser Zeit war die evangelische Kirche zuletzt renoviert und nochmals erweitert worden.
Die St. Peters-Kapelle hatte hier bereits im Mittelalter gestanden. Sie wurde der evangelisch-reformierten Gemeinde zur Verfügung gestellt, als diese Mitte des 16. Jahrhunderts im Zuge der Rekatholisierung ihre Kirche in Konstanz verloren geben musste und somit einen neuen Versammlungsort benötigte. 1603 bzw. 1695 – 97 war die Kapelle dann zu einer Kirche ausgebaut worden.
Die im 15. Jahrhundert erbaute Wallfahrtskirche in Bernrain ist das älteste katholische Gotteshaus in Kreuzlingen und seit 1819 auch Pfarrkirche. Im Mittelpunkt der Wallfahrt ist das ‚Wunderkreuz‘ von Bernrain, das auf dem Tabernakel des Hochaltars steht und der Überlieferung nach zum Bau der Kapelle den Anlass gab.
Hinter der Szenerie: Die Sage vom Bernrainer Kind oder “Die Hand am Kruzifix” In Stadelhofen lebte einst ein frecher Bengel mit Namen Schappeler. Er war ein rechter Taugenichts, dem ordentliche Arbeit ganz und gar nicht lag. So wurde der Leichtfuß von seiner Mutter häufig in den Wald geschickt, damit er Holz und Reisig für den Winter sammeln sollte. Das gefiel dem Schlingel, konnte er so doch ungestört dem Müßiggang frönen. Es soll sich im Januar des Jahres 1384 zugetragen haben, dass der Schappeler gemeinsam mit ein paar Freunden beim Holzsammeln nach Bernrain kamen. Sie ruhten sich am Wegkreuz aus. Da fiel der Blick des Schelmes auf die Heilandfigur, an dessen Nase ein Tropfen Wasser hing. Er griff dem hölzernen Christus an die Nase und rief höhnisch: ‚So Herrgott, lass dich einmal schneuzen, dann küss ich dich lieber!‘ Doch mit Schrecken bemerkte er, dass er seine Hand nicht mehr von der Nase lösen konnte. Wie er sich auch mühte und wand, die Hand klebte fest. Die anderen Jungen liefen aufgeregt zurück nach Hause und erzählten aufgelöst von der Begebenheit. So machte sich alsogleich eine Prozession auf den Weg nach Bernrain, darunter mehrere Geistliche und die Mutter des Frechdachses. Am Orte angekommen, hing die Hand des Schappelers noch immer am Kruzifix. Da fiel die Mutter auf ihre Knie hernieder und flehte zu Gott und zur Mutter Maria. Und siehe, die Hand des Frevlers löste sich. Im Gedenken an diese Geschichte soll in Bernrain die Heilig-Kreuz-Kapelle errichtet worden sein und das Wunderkreuz wurde zum Mittelpunkt einer Wallfahrt. Aber die Geschichte um das Benrainer Kind endete trotzdem nicht gut, denn der Schappeler wurde aus dem Schaden nicht klug! Er dachte gar nicht daran, sein aufmüpfiges Verhalten zu ändern. Der Überlieferung nach wurde dem Früchtchen wegen einer Messerstecherei die Zunge herausgeschnitten und er wurde in der Folge auf ewig aus der Stadt verbannt.
Eine erstmalige Erwähnung des Gutshofes ‚Ober-Girsberg‘, wie Schloss Ebersberg einst hieß, findet sich im Jahre 1530. Später wurde das Anwesen bis in das 18. Jahrhundert hinein auch ‚Kunzenhof‘ genannt. Als im Jahre 1816 der berühmte Chirurg Johann Nepomuk Sauter das Herrenhaus erwarb, ließ er es zu einer vornehmen Villa ausbauen. Doch schon 1848 vernichtete ein Feuer das Gebäude, das bald danach im Biedermeier-Stil wieder aufgebaut wurde. Eberhard Graf von Zeppelin, Bruder des berühmten Luftschiffkonstrukteurs, der auf dem benachbarten Schloss Girsberg aufwuchs, erwarb 1869 das Landgut und ließ es zum Schloss ausbauen. In Anlehnung an seinen Vornamen nannte er sein Schloss ‚Ebersberg‘. Der Industrielle Friedrich Flick übernahm 1960 den Besitz, ließ ihn renovieren und neu einrichten, und nutzte ihn dann als Sommersitz.
Der Psychiater Ludwig Binswanger (1820 – 1880) erwarb 1874 das Schloss, ließ es im Stil des Historismus umbauen und benannte es in ‚Brunegg‘ um. Vorher hatte das Anwesen ‚Alt Gyrsberg‘ und ‚Unterer Girsberg‘ geheißen. Um 1300 war ein erster Herrensitz errichtet worden, der 1679 vom reichen Kloster Obermarchtal übernommen wurde. Das baufällige alte Schloss wurde abgetragen und durch das heutige zweistöckige Gebäude mit dem Rundtürmchen ersetzt. Das Kloster blieb bis zur Säkularisierung im frühen 19. Jahrhundert im Besitz des Schlosses. Nachdem Schloss Brunegg Ende des letzten Jahrhunderts dreißig Jahre lang leer stand, beherbergt es heute ein Restaurant.
Im Laufe der Geschichte wurden drei verschiedene Anwesen an verschiedenen Stellen ‚Girsberg‘ genannt, was zu häufigen Verwechslungen führte. Vor dem Bau von diesem Schloss Girsberg, zeitweilig auch ‚Ober-Gyrsberg‘ und ‚Mittel-Girsberg‘ genannt, gab es bereits ‚Alt-Girsberg‘, das heutige Schloss Brunegg sowie etwas später ein weiteres ‚Ober-Girsberg‘, das heutige Schloss Ebersberg. Alle Herrensitze lagen dann auch relativ nahe beieinander, doch nur eines der Schlösser trägt die Bezeichnung ‚Girsberg‘ noch immer. Dieses Anwesen entstand wohl im 15. Jahrhundert und wurde 1582 zum Freisitz. 1679 erwarb das Kloster Zwiefalten das vornehme Gut. Das alte Schlossgebäude wurde 1790 vollständig abgetragen und durch den heutigen Bau ersetzt. Doch bereits 1803 wurde das Kloster säkularisiert und Schloss Girsberg fiel an das Haus Württemberg, wurde aber sofort weiterverkauft. Der berühmte Luftschiffer Ferdinand Graf von Zeppelin lebte hier von 1840 an bis zu seinem Tode im Jahre 1917, wobei er das Gut vor allem als Sommersitz nutzte. In der ehemaligen Gutsscheune ist heute ein Erinnerungszimmer für Graf von Zeppelin und ein Puppenmuseum untergebracht. Das Museum ist an jedem ersten Sonntag im Monat geöffnet.
Mit den Römern hat das schmucke Renaissanceschloss eigentlich nichts zu tun. Den Namen erhielt das Gebäude mit dem doppelten Treppengiebel und den vier runden Erkern an den Ecken erst um 1880. Zuvor wurde das Anwesen, das wohl im 16. Jahrhundert errichtet wurde, Schloss Rempsberg und Schloss Bellevue genannt.
Als 1598 an der Stelle des heutigen Schlosses Seeburg ein erstes Anwesen erbaut wurde, nannte man es Schloss Neuhorn. Es diente den Äbten des Augustinerstiftes Kreuzlingen als Sommerresidenz, bis es 1633 vollständig niederbrannte. Der Neubau von Schloss Seeburg wurde 1664 vollendet und beherbergte im 19. Jahrhundert das Thurgauer Lehrerseminar. 1870 wurde es im Stil des Historismus umgestaltet. Damals stand das Schloss noch direkt am Ufer des Bodensees, doch in den 1960er Jahren wurde der See an dieser Stelle aufgeschüttet.
Das Schloss, das seit 1958 im Besitz der Stadt Kreuzlingen ist, beherbergt heute ein edles Restaurant. Umgeben ist es auch heute noch von einer herrlichen Parkanlage mit Rosengarten, Springbrunnen und Pavillon.
Unterhalb vom Schloss Seeburg erstreckt sich die lange Seeuferanlage. Der größte öffentliche Erholungspark am Bodensee erstreckt sich über eine Länge von 2,5 km vom Kreuzlinger Hafen bis nach Bottinghofen und besitzt neben sehr altem Baumbestand und weiträumigen Grünflächen auch einen kleinen, frei zugänglicher Heilkräuter- und Gewürzpflanzengarten.
Bereits 1292 wurde in einer alten Urkunde das Anwesen Bernegg als Gutshof erwähnt. Nachdem das Gut 1499 durch die Eidgenossen zerstört wurde, baute man es aber bald darauf wieder auf. Im 17. Jahrhundert wird das Gut Freisitz und kam 1702 in den Besitz von Johann Ulrich Merhart-Mallenbrey. Der vierstöckige turmartige Mittelbau, der 1795 ergänzt wurde und die gesamte Anlage überragt, prägt den heutigen Schlossbau, der sich noch immer im privaten Besitz der Familie Merhart befindet.
Ursprünglich diente das 1683 erbaute Schlösschen als Sommerresidenz für die Äbte der Reichsabtei Irsee bei Kaufbeuren. Nach der Säkularisierung im Jahre 1803 fiel das ‚Schlössli‘, wie es im Volksmund hieß, zunächst an die Fürsten von Thurn und Taxis, wechselte aber in der Folgezeit häufig den Besitzer. Der Schriftsteller, Journalist und Revolutionär Dr. Johann Georg August Wirth (1798 – 1848) wollte hier ein revolutionäres Zentrum und eine Druckerei einrichten, ließ den Herrensitz aber schon zwei Jahre darauf wieder versteigern. Zu dem Anwesen gehörten zu diesem Zeitpunkt ein schöner Garten, große Ländereien und mehrere Nebengebäude. Aber im Jahre 1901 wurde das zweistöckige Gebäude mit dem Walmdach zu einem Mietshaus umfunktioniert. Erst nach einer aufwendigen Sanierung in den 1980ern erhielt das kleine Schloss einen Teil seines alten Glanzes zurück.
Die Felsenburg in der Gaissbergstraße entstand Mitte des 18. Jahrhunderts. Ihren Namen bekam sie allerdings erst bei einem umfangreichen Umbau rund hundert Jahre später. Heute beherbergt das historische Gebäude eine Kinderkrippe.
Der hochragende vierstöckige Bau an der Waßenstrasse besitzt einen doppelten Treppengiebel. Er entstand wohl im 17. Jahrhundert und kam bald in den Besitz eines Stiftes, der in dem Gebäude eine Schule einrichtete. Auch heute dient das Schlössli noch als Schulhaus.
Das Gebäude mit der klassizistischen Fassade entstand zwischen 1750 und 1784, wobei es noch einen älteren Teil besitzt, der schon im Jahre 1690 entstand. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Haus ‚Zur Rosenegg‘ zur Schule umfunktioniert. Heute beherbergt es ein Ortsmuseum, das eine Ausstellung zur Kulturgeschichte Kreuzlingens sowie wechselnde Sonderausstellungen präsentiert.
In den historischen Räumen der ehemaligen Kornschütte des Augustinerklosters ist heute das Seemuseum untergebracht. Das in der weiten Region einzigartige Museum hat sich zur Aufgabe gemacht, alles zu bewahren und auszustellen, was mit dem Leben und der Arbeit am Bodensee zusammenhängt. Die Ausstellung beschreibt auf einer Fläche von rund 1500 m² den See als Fischgrund, Transportweg, Vogelrefugium und Sportstätte. Dabei sieht sich das Seemuseum auch als Lern- und Studienort. Die Modelle von 50 Booten und Schiffen geben einen Überblick, was im Laufe der Zeit so alles über den Bodensee geschippert ist.
Auf dem 1 ha großen Gelände im Seepark am Bodensee tummeln sich allerlei Tiere, die hier auch gefüttert und gestreichelt werden dürfen. Der Tierparkverein Kreuzlingen hat es sich zur Aufgabe gemacht, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen zu beherbergen. So finden sich in den weitläufigen Gehegen Esel, Ziegen, Schafe und Hausschweine, Hühner, Gänse und Enten sowie eine Vogelvoliere mit Kauzen, verschiedenen Meisen und Wachteln.
Nahe dem Rathaus befindet sich das alte Feuerwehrdepot, in dem sich heute ein kleines Feuerwehrmuseum befindet. Hier werden alte Gerätschaften wie Wasserspritzen und Pumpen sowie Ausrüstungsgegenstände aus dem 19. und 20. Jahrhundert ausgestellt. Das Museum öffnet im Sommer jeweils am ersten Sonntagnachmittag eines jeden Monats.
Radrouten die durch Kreuzlingen führen:
Gottlieben
it einer Fläche von nur 400 m² ist Gottlieben eine der kleinsten Gemeinden der Schweiz. Sie liegt am natürlichen Ufer des Seerheins, der den Untersee mit dem restlichen Bodensee verbindet. Das geschlossene Ortsbild wird geprägt von hübschen Fachwerkhäusern und dem Schloss. Gehobene Restaurants bieten kulinarische Köstlichkeiten der Region an.
Gottlieben blickt auf eine lange Geschichte zurück. 1251 wurde hier durch Bischofs Eberhard II. eine Wasserburg als Residenz errichtet, in der im 14. Jahrhundert der abgesetzte Papst Johannes XXIII. und der Reformator Jan Hus festgesetzt wurden. Erst 1526 verlor Gottlieben den Status als Residenzstadt. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die nahe Siedlung Bodman, auf die der Name des Bodensees zurückgeht, zerstört. Auch die Burg Gottlieben überstand die Angriffe der Schweden nicht. Dennoch wurde der Ort 1678 zum Markt erhoben und erlebt als Handelsplatz eine Blüte. 1798 wird Gottleben vorübergehend sogar Bezirkshauptort. Die Burg wurde durch Prinz Louis Napoléon, dem späteren französischen Kaiser Napoléon III. als neugotisches Schloss wiederaufgebaut.
Sehenswertes:
Das Schloss am Ufer des Seerheins geht auf eine 1251 von Bischofs Eberhard II. Truchsess von Waldenburg erbaute Wasserburg zurück. Dieser wollte Gottlieben als befestigten Handelsort in Konkurrenz zu Konstanz etablieren. Auffällig sind die beiden landseitigen Ecktürme aus dem 13. Jahrhundert. Der große Palas mit den Seitenflügeln und den Türmen stellte schon im Mittelalter eine eindrucksvolle und mächtige Wehr- und Wasserburganlage dar. Anfang des 15. Jahrhunderts wurden im Westflügel der bekannte Reformator Jan Hus und der abgesetzte Papst Johannes XXIII. gefangen gehalten. Hus wurde nach seiner Gefangenschaft im Jahre 1415 auf einem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt. Sein Tod löste daraufhin die Husittenkriege aus. Im Jahre 1526 verlor Gottlieben seinen Status als bischöfliche Residenz und im Dreißigjährigen Krieg wird die Burg von schwedischen Truppen schwer beschädigt.
Im 19. Jahrhundert erwarb Prinz Louis Napoléon, der spätere französische Kaiser Napoléon III. das Anwesen und ließ es zu einem repräsentativen neugotischen Wasserschloss umbauen. Er wohnte hier jedoch nur kurz.
Auch heute befindet sich das Schloss in privatem Besitz und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Zuletzt gehörte es der 2012 verstorbenen Schweizer Opernsängerin Lisa Della Casa.
Der deutsche Dichter und Schriftsteller Freiherr Emanuel von Bodman (1874 – 1946) ließ sich nach seinem Studium im Schweizerischen Tägerwilen nieder. Das Haus am Dorfplatz war bis zu seinem Tode sein langjähriges Domizil. Heute befindet sich in dem Gebäude die Thurgauische Bodman-Stiftung, die hier eine Gedenkstätte für den Literaten einrichtete. Hier findet man eine Werkauswahl des Autors, eine Ausstellung zu Literaturthemen und eine Buchbinderei. Im Bodman-Haus finden regelmäßig Lesungen statt, außerdem dient das Haus als Unterkunft für Literaturstipendiaten.
Übrigens: Freiherr Emanuel von Bodman entstammt dem ältesten Grafengeschlecht Deutschlands. Ihren Stammsitz hat die Familie in Überlingen. Die Bezeichnung ‚Bodensee‘ bezieht auf den Namen diese Adelsgeschlechtes.
Der Gasthof Drachenburg ist ein sehenswerter Fachwerkbau mit zwei zwiebelhelmbekrönten Erkern unweit des Seerheins. Das Wirtshaus entstand in seiner heutigen Form im Jahre 1715, als die sehr viel älteren Gebäude ‚Unteres Steinhaus‘ und ‚Oberes Steinhaus‘ miteinander verbunden wurden. Gemeinsam mit dem benachbarten ‚Waaghaus‘ beherbergt die Drachenburg heute ein anerkanntes Hotelrestaurant mit gehobener Küche und ist seit Generationen im Familienbesitz.
Radrouten die durch Gottlieben führen:
Tägerwilen
er Seerhein ist ein schmaler Teil des Bodensees, der den Untersee vom Bodensee trennt. Am südlichen Ufer des Seerheins liegt die Schweizer Gemeinde Tägerwilen. Sie grenzt im Norden an die deutsche Stadt Konstanz, die die Geschichte Tägerwilens entscheidend prägte, denn die Ministerialen des Bischofs von Konstanz hatten hier lange ihren Sitz. Sie ließen im 12. Jahrhundert eine große Höhenburg errichten, von der aber nach dem Schwabenkieg 1499 nur noch eine Ruine erhalten blieb. Das unweit davon stehende neubarocke Schloss Castell gilt heute als eines der bedeutendsten Schlossbauten der Schweiz. Die Gegend war bereits zuvor im 7. Jahrhundert durch die Alemannen besiedelt worden.
Zu der Gemeinde gehört auch das Tägermoos, dem eine staatsrechtliche Besonderheit zugrunde liegt. Das einstige 1,5 km² große Sumpfgebiet ist eine Gemarkung der deutschen Stadt Konstanz, gehört aber staatsrechtlich zu Tägerwilen und damit zur Schweiz. Grundlage für dieses Kuriosum ist der Staatsvertrag von 1831, der immer noch Gültigkeit besitzt.
Der für seine ‚Blumenmärchen‘ bekannt gewordene Maler und Graphiker Ernst Kreidolf (1863 – 1956) wuchs in Tägerwilen auf. Eine Gedenkausstellung mit originalen Gemälden befindet sich im Gemeindehaus.
Sehenswertes:
Das hübsche Schloss Castell gilt als eines der bedeutendsten Schlossanlagen der Schweiz. Es wurde 1585 als Herrensitz im Stil der Spätrenaissance errichtet. 1725 wurde es allerdings weitgehend umgebaut und dem modernen Zeitgeschmack angepasst. Zwischen 1878 und 1894 ließ Baron Maximilian von Scherer-Scherenburg das Anwesen erneut umgestalten. Es entstand der repräsentative neobarocke Prachtbau, der noch heute stolz über die Ebene wacht.
Die Ruinen der benachbarten Burg Castell (auch Unter-Castell) zeugen noch von einem Vorgängerbau aus dem 12. Jahrhundert, der aber Ende des 15. Jahrhunderts zerstört wurde.
Das oberhalb des Ortes Tägerwilen auf dem Thurgauer Seerücken liegende Schloss befindet sich in privatem Besitz und kann daher nicht besichtigt werden.
Um 1120 erstand auf einem Hang des Thurgauer Seerückens die Burg Castell. Schon 1128 wurde die Höhenburg wieder zerstört, doch baute man sie kurz darauf schon wieder neu auf. Sie diente zunächst den Ministerialen Schenk von Castell als Sitz und gilt als eine der größten mittelalterlichen Wehrburgen der Bodenseeregion. Das Ausmaß der Anlage besitzt eine Länge von ca. 120 Metern und eine Breite von ca. 30 Metern.
Schon 1128 wurde die Höhenburg durch Bischof Ulrich II. von Castell wieder zerstört, doch baute man sie kurz darauf schon wieder neu auf. Während des Schwabenkrieges in Jahre 1499 wurde die Burg durch die Eidgenossen nochmals zerstört und verkam darauf zur Ruine.
Westlich der alten Burg, getrennt durch ein kleines Tal, entstand das neue Schloss Castell als repräsentativer Ersatz für die alte Wehrburg. Bei einer ersten Sanierung der Ruine im 19. Jahrhundert wurde der Westturm zum Aussichtsturm ausgebaut.
Zur besseren Unterscheidung findet man häufig die Bezeichnung ‚Schloss Ober-Castell‘ für den neobarocken Schlossbau und ‚Burg Unter-Castell‘ für die Ruine. Das Gelände ist für die Öffentlichkeit zugänglich.
Am Allmendbach steht die letzte intakte Wassermühlensäge Tägerwilens. Noch im 19. Jahrhundert hatte es im Ort mehrere Mühlen gegeben, die aber ansonsten alle zerfielen bzw. abgerissen wurden. Der Bau der ‚Alte Säge‘ wird um das Jahr 1830 geschätzt. 1921 hatte das alte Wasserrad ausgedient. Ein Motor übernahm fortan den Antrieb für das Sägewerk, das 1968 schließlich vollständig stillgelegt wurde. Die Gebäude entgingen dem Abbruch und wurden in den 1980er Jahren komplett renoviert. Die Sägemühle ist heute samt Wasserrad wieder voll funktionsfähig und kann auf Anfrage besichtigt werden.
Die Ursprünge der Kirche sind nicht ganz genau nachvollziehbar. Sicher ist, dass es hier bereits im 12. Jahrhundert nachweislich ein Gotteshaus gegeben hat. 1455 entstanden ein neues Langhaus und der Chor. Die Gemeinde trat 1528 zum protestantischen Glauben über und seitdem gehört der Kirchenbau der Evangelisch-reformierten Kirche. 1761 wurde das Gotteshaus umgebaut und erhielt so weitgehend sein heutiges Erscheinungsbild. Der Kirchturm erhielt dabei einen neuen Spitzhelm, der aber schon 35 Jahre später zerstört wurde, als während eines Unwetters der Blitz in den Turm einschlug und diesen teilweise zum Einsturz brachte.
Radrouten die durch Tägerwilen führen:
Ermatingen
alerisch am Berghang des Seerückens und auf dem größten Flussdelta des Untersees liegt der Schweizer Ort Ermatingen. Er besteht aus den beiden Ortsteilen Ermatingen und Triboltingen und liegt genau gegenüber der Insel Reichenau. Während des Schwabenkrieges im Jahre 1499 erlitt das Dorf größeren Schaden. Auch die Kirche St. Albin aus dem 12. Jahrhundert wurde dabei gebrandschatzt. Nach dem Wideraufbau und der Reformation wird sie bis zum heutigen Tage paritätisch von der evangelisch-reformierten und der römisch-katholischen Gemeinde genutzt. Mit dem Gasthaus Adler besitzt der Ort eines der ältesten Wirtshäuser des Kantons Thurgau. Sehenswert sind das hoch über dem Ort liegende würfelartige Schloss Wolfsberg und das heimatkundliche Vinorama Museum, das auch ein reichhaltiges kulturelles Programm anbietet.
Sehenswertes:
Malerisch und hoch über dem Dorf Ermatingen steht das Schloss Wolfsberg. Das kubusförmige Hauptgebäude entstand im Jahre 1571. Im 18. Jahrhundert erhielt das Herrenhaus mit dem Mansardendach bei einem größeren Umbau sein heutiges Aussehen. Die seitlichen Anbauten entstanden allerdings erst später. Der Adelssitz wechselte im 19. Jahrhundert mehrfach den Besitzer und damit auch die Funktion. Es diente als Hotel, als landschaftlicher Betrieb und als Kurhaus. Heute befindet sich in den Räumen des Schlosses das Ausbildungszentrum einer Schweizer Bank. Das Anwesen besitzt zum See hin einen wunderschönen Schlossgarten, der im 19. Jahrhundert angelegt wurde. Einzelbesuchern ist es gestattet, den Garten kurz zu betreten. Vom Anwesen aus hat man einen wunderbaren Blick über den Untersee.
Das Gasthaus Adler wurde schon 1270 erstmals erwähnt. Das heutige Fachwerkgebäude (in der Schweiz: Riegelbau) entstammt dem 16. Jahrhundert und diente auch eine Zeit als Amtssitz des Landvogtes. Sehenswert sind die Fresken von José Manuel Sanz. Zu den illustren Gästen des alten Wirtshauses zählten Prinz Louis Napoléon (der spätere französische Kaiser Napoléon III.), Graf Zeppelin, Thomas Mann, Hermann Hesse, Alexandre Dumas und François-René de Chateaubriand.
Die St. Albinkirche in Ermatingen wird von der evangelisch-reformierten und der römisch-katholischen Konfession gemeinsam genutzt. Daher findet sich häufig die Bezeichnung ‚Paritätische Kirche Ermatingen‘. Die Bausubstanz des Gotteshauses ist zum großen Teil noch frühmittelalterlich, denn der ursprüngliche Bau erfolgte bereits im 6. oder 7. Jahrhundert. Im 15. Jahrhundert wurden das gotische Kirchenschiff und der Chor ergänzt. Nachdem das Langhaus während des Schwabenkrieges abbrannte, wurde es 1501 wieder erstellt. Seit der Reformation nutzten beide Konfessionen das Gotteshaus. Daraus ergaben sich viele Unstimmigkeiten und Streitereien, die auch zu Schwierigkeiten bei den Umbauten im 17. und 18. Jahrhundert führten. Die Innengestaltung mit den Wandgemälden und den Stuckaturen sind dann auch eher katholisch geprägt. Dennoch hält die Parität bis heute an.
Die herrschaftliche Villa wurde 1848 im klassizistischen Stil errichtet. Im 20. Jahrhundert zählte das hübsche Anwesen berühmte Persönlichkeiten, wie Wilhelm Furtwängler, Othmar Schock oder der Kunstmäzen Oskar Reinhart zu den illustren Gästen. Zwischenzeitlich praktizierte der bekannte Dermatologe Dr. Paul Bigliardi in der Villa, ehe sie 1985 zu einem Begegnungszentrum für Unternehmer wurde.
Das historische Gebäude stammt im Ursprung wohl noch aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Nachdem es während des Schwabenkrieges 1499 niederbrannte, wurde es zwei Jahre später bereits wieder aufgebaut. Nach einem Umbau erhielt der Fachwerkbau mit dem markanten Treppengiebel 1686 sein heutiges Erscheinungsbild. Das Schlösschen zählt zu den ältesten Bauwerken in Ermatingen.
Die Kapelle wurde um 1300 im spätromanischen Stil erbaut. Zweihundert Jahre später baute man das Gotteshaus im gotischen Stil um. Dabei wurde der dreiseitigen Chor ergänzt und die Spitzbogenfenster eingebaut. Der Dachreiter mit dem Spitzhelm entstand im frühen 17. Jahrhundert. Bemerkenswert in dem spärlich eingerichteten Innenraum sind die mittelalterlichen Rötelzeichnungen an den Wänden, die noch aus dem 15. Jahrhundert stammen. Die Kapelle wird sowohl von der evangelischen als auch von der katholischen Kirche genutzt.
Das im klassizistischen Stil erbaute Haus Phoenix an der Hauptstraße in Ermatingen beherbergt seit 2011 ein interessantes Wohnmuseum. Die Ausstellung zeigt, wie man um 1900 in der Region gelebt hat. Zum Museum gehört neben dem hübschen Rosenpark auch die Remise, in der die Geschichte des Dorfes Ermatingen, des Weinbaus und der Fischerei am Bodensee, der Wald- und Landwirtschaft sowie des Jagdwesens näher beschrieben wird. Kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte, Lesungen und Vorträge ergänzen das museale Angebot.
Radrouten die durch Ermatingen führen:
Salenstein
ie Gemeinde am Südufer des Untersees, ein Teil des Bodensees, liegt genau gegenüber der deutschen Insel Reichenau. Lange Zeit gehörte Salenstein, im regionalem Dialekt ‚Saleschte‘ ausgesprochen, zum Herrschaftsgebiet des Klosters Reichenau. Erst 1798 wurde der Ort schweizerisch und gehört heute zum Kanton Thurgau. Auf dem Gemeindegebiet, zu dem auch die Dörfer Mannenbach und Fruthwilen gehören, befinden sich noch fünf Schlösser. Das bedeutendste ist Schloss Arenenberg, auf dem der spätere französische Kaiser Napoleon III. aufwuchs und wo dieser auch mehrere wichtige Schriften verfertigte. Heute befindet sich im Schloss das sehenswerte Napoleonmuseum.
Sehenswertes:
Die Ursprünge vom Schloss Arenenberg liegen vermutlich im 15. Jahrhundert. Das Anwesen, das seit 1585 auch Freisitz war, steht auf dem gleichnamigen Berg oberhalb des Untersees mit Blick auf die Insel Reichenau. Lange diente es als Wohnsitz bedeutender Patrizierfamilien. Nachdem die vormalige Königin der Niederlande, Hortense de Beauharnais das gotische Schloss im Jahre 1817 übernommen hatte, ließ sie es der damaligen Mode entsprechend im Stile des Empire klassizistisch umbauen. Auch die gesamte Inneneinrichtung ließ sie französisch umgestalten. Ihr Sohn Louis Napoleon, der hier zeitweilig aufgewachsen war, gab das Anwesen zwar aus finanziellen Gründen 1843 ab, kaufte es aber 1855, nachdem er zum Kaiser Napoleon III. ernannt worden war, wieder zurück. Nach dem Tod des Kaisers schenkte seine Witwe, Kaiserin Eugénie, das Anwesen 1906 dem Kanton Thurgau, der hier seitdem das Napoleonmuseum und ein Bildungs- und Beratungszentrum betreibt.
Napoleon III (1808 – 1873) war vier Jahre lang französischer Staatspräsident, ehe er sich 1852 zum Kaiser krönen ließ. Zuvor waren bereits zwei Putschversuche gescheitert. Obwohl er anfänglich sehr autoritär regierte, trug seine spätere Regierungszeit relativ liberale Züge. Während des Deutsch-Französischen Krieges wurde er 1870 von den Preußen gefangen genommen und abgesetzt. Er starb schließlich in seinem englischen Exil.
Im Museum auf Schloss Arenenberg ist noch der wesentliche Teil des Originalinventars zu sehen. Hier hatte Napoleon III. seinen ersten Putsch geplant und mehrere seiner militärischen und politischen Schriften verfasst. Neben einigen Wohnräumen können unter anderem mehrere Arbeitszimmer, die Bibliothek, der Wintergarten und das Sterbezimmer der Königin Hortense besichtigt werden. Auch der reizvolle 12 ha große Park, der im Stil eines englischen Landschaftsgartens gestaltet wurde, ist sehenswert. Zu ihm gehören eine kleine neugotische Kapelle und ein Aussichtspavillon, von dem man einen prächtigen Blick über den Bodensee genießen kann.
Hoch auf einer Bergkuppe über dem Ort Salenstein und dem Untersee steht stolz das Schloss Salenstein. Das ursprünglich als Abtei dienende Gebäude entstand im 11. Jahrhundert. In Laufe der Geschichte wechselte es häufig den Besitzer und wurde auch häufig umgebaut. Das heutige Aussehen erhielt Schloss Salenstein Ende des 19. Jahrhunderts, als es im Stil der Neugotik nach englischem Vorbild umgestaltet wurde. Es befindet sich im Besitz der Wintherthurer ‚Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte‘.
Am Südufer des Untersees steht das Schloss Eugensberg. Es wird privat bewohnt und ist nur schlecht einsehbar, weil es von hohen Hecken und Zäunen abgeschirmt wird. Schloss Eugensberg wurde von 1819 bis 1821 im klassizistischen Stil durch den Herzog von Leuchtenberg, Eugèn de Beauharnais erbaut. Von seinem Vornamen leitet sich der Name des Schlosses ab. Er hat das Anwesen allerdings nur wenige Male aufgesucht, da er bereits 1924 verstarb. Anfang des 20. Jahrhundert wurden einige bauliche Veränderungen vorgenommen. Das Innere des Palais wurde erheblich umgestaltet und die sachlich strenge Fassade wurde im Stil des Historismus aufgelockert. Das weiße Schloss wird von einem englischen Landschaftspark umgeben.
Auf dem Gelände eines alten Kaplaneigebäudes ließ der französische Brigadegeneral Maquis de Crenay in den Jahren 1834/35 ein herrschaftliches Haus bauen, das er nach der Nichte seiner Frau ‚Schloss Louisenberg‘ benannte. Das dreigeschossige Palais mit dem symmetrisch angelegten Park befindet sich heute im privaten Besitz der Familie Kaestlin.
Der Adelssitz im Dorf Fruthwilen wurde erstmals 1377 urkundlich erwähnt. Der Freisitz, dessen Innengestaltung Anfang des 18. Jahrhunderts barock umgestaltet wurde, wechselte häufig den Eigentümer. Seit 1799 befindet sich das Schloss, das aus zwei Massivstockwerken und einem Fachwerkgeschoss besteht, im bäuerlichen Besitz. Über zwanzig Jahre lang lebte auf Schloss Hubberg der deutsche Dichter Hans Leip. Von ihm stammte der Text zum weltberühmten Soldatenlied ‚Lili Marleen‘. Noch heute befindet sich eine Wandmalerei von ihm im zweiten Stock.
Radrouten die durch Salenstein führen:
Berlingen
ie kleine schweizerische Gemeinde am Südufer des Bodensees wurde 894 erstmals urkundlich als ‚Berenwang‘ erwähnt. Wahrscheinlich bestand hier aber bereits in römischer Zeit eine Siedlung. Grabungen belegen, dass es auch auf dem Gemeindegebiet in Berlingen vorgeschichtliche Pfahlbausiedlungen gegeben hat. Auf dem Panoramaweg kann man eine atemberaubende Aussicht auf den Untersee genießen. Von Mai bis Oktober verkehren hier die Kursschiffe auf dem Bodensee. Das Wahrzeichen des Dorfes ist die reformierte Kirche. Der Bau im neugotischen Stil war zu dieser Zeit noch sehr ungewöhnlich gewesen. Bekanntester Sohn Berlingens ist der naive Maler Adolf Dietrich. Er lebte hier Zeit seines Lebens und in seinem damaligen Wohnhaus ist heute ein Museum zu seinem Gedenken untergebracht.
Sehenswertes:
Der naive Kunstmaler Adolf Dietrich (1877 – 1957) ist der bekannteste Sohn Berlingens. In seinem Geburtshaus in der Seestraße wohnte und arbeitete er zeit seines Lebens. Die Thurgauische Kunstgesellschaft, die Dietrichs Nachlass verwaltet, hat in diesem Haus ein Museum eingerichtet. Hier werden aber nicht nur Bilder des Künstlers ausgestellt. Der Besucher erhält auch Einblicke in seine Malstube, die nach seinem Tode unberührt erhalten blieb, seinen Wohnbereich und seinen Paradies-Garten, den er so oft als Motiv nutzte. Das Museum ist zwischen Mai und November jeweils am Wochenenden nachmittags geöffnet.
Die protestantische weiße Dorfkirche ist das Wahrzeichen Berlingens. Sie wurde 1842 erbaut und gehört damit zu den ältesten neugotischen Kirchenbauwerken der Schweiz. Die Kanzel und der Taufstein wurden vom französischen Kaiser Napoleon III., der auf Schloss Arenenberg im benachbarten Salenstein aufwuchs, gestiftet.
Zuvor hatten an gleicher Stelle bereits die Michaeliskapelle aus dem 13. Jahrhundert sowie eine weitere Kirche aus der Mitte des 17. Jahrhunderts gestanden. Als die Gotteshäuser zu klein geworden waren, waren sie jeweils durch einen neuen größeren Kirchenbau ersetzt worden.
Radrouten die durch Berlingen führen:
Steckborn
ie Kleinstadt am Untersee wurde im Mittelalter von der Abtei Reichenau beherrscht. Selbst als 1515 die Stadt im Zuge der Reformation geschlossen zum protestantischen Glauben übertrat, verblieb die Gerichtsbarkeit zunächst beim Kloster Reichenau. Überreste der alten mittelalterlichen Stadtmauer und zwei Pulvertürme sind auch heute noch zu sehen. Ansonsten wird der Ort von zwei mächtigen Gebäuden beherrscht: dem Turmhof, in dem sich heute ein heimatkundliches Museum befindet und die evangelische Kirche, die alle anderen Gebäude des Ortes überragt. Steckborn besitzt eine reizvolle Altstadt mit zahlreichen sehenswerten Fachwerkhäusern. Hervorzuheben sind die Wohnhäuser Zum Schwanen, Zum Neuen Schloss, Zum Alten Schloss, Zum Kehlhof und Zur Rose sowie das alte Schulhaus, das Riegelhaus und das Rathaus, durch das man hindurch zum hübschen Promenade und zum Anleger gelangt.
Sehenswertes:
Der Turmhof ist das Wahrzeichen der Stadt Steckborn. Das Gebäude steht direkt am Bodenseeufer. Der vierstöckige Hauptbau wird von einer breiten Kuppel bekrönt an dessen Ecken vier kleine Türmchen das markante Dach ergänzen. Am dreistöckigen Anbau steht ein schlanker Rundturm, der von einem Spitzhelm abgeschlossen wird. Der Turmhof wurde 1282 erbaut und 1614 erweitert. Lange war er Sitz der mächtigen Äbte der Reichenau, 1642 übernahm die Stadt Steckborn das Gebäude, das in der Folge als Armenhaus und Schule diente und seit 1937 das ‚Museum im Turmhof‘ beherbergt.
Die Ausstellung widmet sich der Geschichte und der Kultur der Region von der Urgeschichte bis zur jüngeren Vergangenheit des 19. Jahrhunderts und hebt insbesondere den Steckborner Ofenbaus sowie die Handwerke des Klöppelns und Zinngießens hervor. Die Kunstsammlung präsentiert Bilder von Steckborner Künstlern.
Die evangelisch-reformierte Kirche prägt mit ihrem achteckigen spitzen Helm das Ortsbild Steckborns. Ein erstes Kirchengebäude geht auf das 9. Jahrhundert zurück. Die heutige Stadtkirche wurde 1766 bis 1768 neu errichtet. Der mächtige Turm allerdings wurde erst 1835 fertig gestellt. Nach der Reformation war das Gotteshaus sowohl von Protestanten als auch von Katholiken genutzt worden. Erst 1962 zogen die Katholiken in eine eigene Kirche um.
Steckborn besitzt eine hübsche Altstadt mit zahlreichen sehenswerten Fachwerkhäusern. Hervorzuheben sind die Wohnhäuser Zum Schwanen, Zum Neuen Schloss, Zum Alten Schloss, Zum Kehlhof und Zur Rose sowie das Alte Schulhaus und das Rathaus.
Das schmucke Ratsgebäude mit seinem auffälligen roten Fachwerk wurde 1667 erbaut. Es steht etwas eingerückt von der Hauptstraße, so dass sich davor ein kleiner Platz öffnet. Ein sechseckiger Turm, der von einer welschen Haube bekrönt wird, steht dem Gebäude mittig vor. Auf der linken Seite führt ein tonnengewölbter Torbogen zum Ufer des Untersees und zum Schiffsanleger.
Einst besaß Steckborn im Mittelalter eine geschlossene Stadtmauer, um sich feindlichen Angreifern zu erwehren. Einige Reste dieser ungefähr einen Meter dicken Ringmauer, die nur zum See hin geöffnet war, sind bis heute erhalten geblieben. Am besten ist die alte Stadtbefestigung an der Ostseite zu erkennen. Hier steht auch der eckige zweigeschossige Pulverturm mit seinem hohen Zeltdach, der 1497 erbaut wurde. Wann die steinerne Stadtbefestigung entstand, ist hingegen nicht genau bekannt. Man vermutet, dass sie im frühen 15. Jahrhundert errichtet wurde. Sie diente bis in das 19. Jahrhundert der Stadtsicherung.
Etwas landeinwärts am Hang zwischen Steckborn und Mammern steht das Schloss Glarisegg. Das zweistöckige weiß verputzte Gebäude wurde 1774/75 als Ersatz eines Gutes aus dem 16. Jahrhundert erbaut. Im letzten Jahrhundert beherbergte es ein Internat, heute dient es einem esoterisches Seminar und Begegnungszentrum.
Fritz Gegauf, Erfinder der weltweit ersten Hohlsaum-Nähmaschine, gründete in einem ehemaligen Zistertienser-Nonnenkloster bei Steckborn einen kleinen Stickereibetrieb, aus dem sich schließlich die bekannten Bernina-Nähmaschinenwerke entwickelten. Im Hauptsitz an der Seestraße befindet sich heute ein Museum, dass die Produkte der schweizerischen Nähmaschinenmarke präsentiert.
Radrouten die durch Steckborn führen:
Mammern
er schweizerische Ort Mammern liegt nahe dem westlichen Ende des Untersees. Gegenüber liegt das deutsche Ufer der Halbinsel Höri. Das Gebiet war bereit in der Jungsteinzeit besiedelt. Die Ausgrabungsstätten der prähistorischen Pfahlbausiedlungen gehören seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Aber auch keltische Siedlungen sind belegt, alemannische werden vermutet. Die Herrschaft Mammern gehörte im Mittelalter zum Kloster St. Gallen um kam später in den Besitz des Klosters Rheinau. Die Burg Neuburg war im Mittelalter die größte Wehranlage am Untersee. Heute erinnern nur noch Mauerreste an diese glanzvollen Zeiten. Im Zuge der Gegenreformation entstand das Neue Schloss, das heute Teil einer Privatklinik ist und die barocke Schlosskapelle. Sehenswert ist das historisch erhaltene Dorf Gündelhart mit seiner schmucken Zwiebelturmkirche und dem Schloss.
Sehenswertes:
Nach der Reformation geriet Mammern im 17. Jahrhundert wieder in katholischen Besitz. Die neuen Herren erbauten in den 1620er Jahren das ‚Neue Schloss‘ und später auch die Schlosskapelle. Die Nebengebäude, die bei einem Brand zerstört wurden, wurden 1773 neu aufgebaut. Das Herrenhaus blieb bis heute erhalten.
Nachdem das Kloster Rheinau aufgelöst wurde, wechselte das Schloss Mammern im 19. Jahrhundert vielfach den Besitzer. 1866 übernahm der Arzt Dr. Freuler das Anwesen und richtete in den historischen Gebäuden eine Kuranstalt ein.
Innerhalb des ehemaligen Schlosses in Mammern steht die barocke Schlosskapelle. Sie wurde 1749 im Zuge der Gegenreformation erbaut. Die üppige Innenausstattung mit den Altären, den Skulpturen und der Wandbemalungen steht vollständig im Zeichen der Marienverehrung.
Die mächtige Burg Neuburg war einst im Mittelalter die größte Burg am Untersee. Sie wurde im 13. Jahrhundert als Höhenburg erbaut und war lange Lehensgut des Klosters St. Gallen, ehe es 1690 das Kloster Rheinau übernahm. 1745 wurde die Burg abgebrochen.
Heute erinnern nur noch Mauerreste an die stolze mittelalterliche Wehrburg. Von der ehemaligen Ringmauer sind noch recht hohe Reste erhalten. Auch Teile des Fundamentes vom Bergfried sind noch gut zu erkennen.
An der Ruine befinden sich ein Grill- und ein Spielplatz, so dass die Neuenburg vielfach als Ziel für Ausflügler dient.
Klingenzell liegt hoch über dem Untersee und bietet einen herrlichen Blick über den See. Bekannt geworden ist das kleine Dorf wegen seiner Wallfahrtskirche, die der Schmerzensmutter Maria geweiht ist. Unterhalb des 1705 erbauten Gotteshauses befindet sich ein Kreuzweg, der auch an einer Mariengrotte vorbeiführt.
Nur wenig außerhalb des Bauerndorfes Gündelhart steht das gleichnamige Schloss. Der zweigeschossige Giebelbau wurde Ende des 16. Jahrhunderts durch die Lanzen von Liebenfels errichtet. Sie machten Gündelhart zu einer eigenen territorialen Herrschaft. Heute ist das Schloss Teil eines großen landwirtschaftlichen Betriebes.
In Gündelhart ist man stolz auf das unbeschädigte historische Dorfbild, dass durch die Mauritiuskirche mit ihrem markanten Zwiebelturm, dem mitten im Dorf gelegenen alten Pfarrhauses und dem Schloss Gündelhart geprägt wird. Die Ursprünge der Kirche St. Mauritius liegen wohl im 13. Jahrhundert. Ihr heutiges Aussehen erhielt sie allerdings erst bei einem Umbau im frühen 18. Jahrhundert.
Radrouten die durch Mammern führen:
Eschenz
ie Gemeinde Eschenz liegt am Südufer des so genannten Rheinsees, einem Teil des Untersees, der wiederum ein Teil des Bodensees ist. Hier fließt der Hochrhein aus dem Bodensee ab – deshalb nennt sich die Gemeinde auch ‚Eschenz am Untersee und Rhein‘. Dem Ufer vorgelagert liegen die Werd-Inseln (auch ‚Im Werd‘ genannt). Die Hauptinsel ‚Werd‘ ist über eine Holzbrücke mit dem Festland verbunden. Sie wird von Franziskanern bewohnt, die sich auch um die St. Ottmarkapelle kümmern, die hier zu Ehren des ersten Abtes des Klosters St. Gallen errichtet wurde. Fahrräder sind auf der Insel allerdings nicht erwünscht – hier geht es schließlich äußerst gemütlich zu. Besiedelt wurde die Insel bereits vor 7.000 Jahren. Fundstücke, die bei Grabungen an den inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Pfahlbausiedlungen zutage kamen, können im Museum Eschenz bewundert werden.
Sehenswertes:
Im westlichen Teil des Untersees, wenige hundert Meter, bevor der Bodensee offiziell zum Fluss Rhein wird, liegt die Inselgruppe ‚Im Werd‘. Die Insel Werd ist die größte und die einzig bewohnte der drei Inseln. Während die beiden kleineren Inseln ‚Mittleres Werdli‘ und ‚Unteres Werdli‘ zu Stein am Rhein und damit schon zum Kanton Schaffhausen gehören, ist die Hauptinsel Bestandteil der Gemeinde Eschenz im Kanton Thurgau. Sie gehört dem Benediktinerkloster Einsiedeln, wird aber von Franziskanern gepachtet, die hier auch leben. Eine 125 m lange hölzerne Fußgängerbrücke führt auf die Insel auf die St. Otmarkapelle zu. Der hl. Ottmar war der erste Abt des Klosters St. Gallen. 759 wurde er als fränkischer Sträfling auf die Insel Wird verbannt, wo er noch im gleichen Jahr verstarb. Zunächst wurde er auch hier beigesetzt, doch wenige Jahre später holten Mönche des Klosters St. Gallen seine Gebeine heim und begruben ihn ein zweites Mal. An der Stelle seines ersten Grabes errichtete man im 10. Jahrhundert eine Kapelle, die im 15. Jahrhundert durch den heutigen Bau ersetzt wurde. Radfahrer sind auf der gemütlichen Insel nicht erwünscht, aber an der Holzbrücke befindet sich ein Parkplatz, wo man sein Rad abstellen kann. Eine Holzbrücke hatte es hier schon in römischer Zeit gegeben. Die Römer nutzten die Insel als Kopf für einen Übergang zwischen Germanien und Rätien. Aber schon vor 7000 Jahren war die Insel bewohnt. Man fand eine prähistorische Pfahlbausiedlung und förderte zahlreiche vorzeitliche Gegenstände, wie Werkzeuge, Waffen und Keramikscherben ans Tageslicht. Einige Fundstücke werden im Museum Eschenz gezeigt.
Auf einem Felsvorsprung hoch über dem Ort Eschenz erbauten die Herren von Hohenklingen um 1300 die Burg Freudenfels. Sie diente vor allem der Sicherung und Überwachung der vielbefahrenen Straße am Rhein. 1623 erwarb die Benediktinerabtei Einsiedeln das Anwesen. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Wehranlage zu einem barocken Schlösschen umgebaut. Hier befand sich bis ins späte 20. Jahrhundert der Sitz des Statthalters Einsiedelns. Auch heute noch ist das Schloss im Besitz der Benediktinerabtei, dass inzwischen ein Tagungszentrum beherbergt. Der wunderschöne Schlossgarten darf von Einzelpersonen frei betreten werden. Das Schloss selber ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich.
In einem ehemaligen Bauernhaus befindet sich seit 1991 das Dorfmuseum. In Eschenz ist eine kontinuierliche Besiedelung seit der Steinzeit nachweisbar. Schon in der vorgeschichtlichen Zeit siedelten die Menschen bevorzugt an Abflussgebieten von größeren Gewässern. So entwickelte sich auch in dieser Region ein Siedlungsplatz, in dem schon vor 7.000 Jahren Pfahlbausiedlungen nachgewiesen werden konnten. Die Ausgrabungsstätten gehören heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Museum Eschenz zeigt im ersten Stock archäologische Fundstücke aus der Region, die von der Steinzeit bis zur Römerzeit stammen. Im zweiten Stockwerk ist eine heimatkundliche Ausstellung untergebracht.
Das Museum ist den Sommermonaten jeweils am ersten Sonntag im Monat nachmittags geöffnet.
Radrouten die durch Eschenz führen:
Stein am Rhein
ie historisch gewachsene Altstadt von Stein am Rhein ist eines der touristischen Highlights der gesamten Bodenseeregion. Mittelalterliche Häuser mit bemalten Fassaden, Fachwerkbauten, alte Wirtshäuser und Stadttore und der türkis schimmernde Rhein am Schiffsländle prägen das Bild des kleinen schmucken Städtchens im Kanton Schaffhausen. Die Geschichte von Stein ist eng mit dem des Benediktinerkloster St. Georgen verbunden. Anfang des 11. Jahrhunderts ließen sich die Mönche an der Handels- und Wasserstraßenkreuzung am Ende des Untersees nieder und errichteten hier ein Kloster. Aus der Fischersiedlung wurde bald ein Marktort mit Stadtrechten. Obwohl das Kloster bereits 1525 im Zuge der Reformation aufgelöst wurde, blieb es in seiner romanischen und gotischen Bausubstanz nahezu vollständig erhalten und kann heute als Museum besichtigt werden. Hoch über der Stadt entstand um 1200 die Burg Hohenklingen, in der Kastvogt des Klosters seinen Sitz hatte. Obwohl strategisch wichtig, wurde die Feste im Verlauf von kriegerischen Auseinandersetzungen nie ernsthaft beschädigt und konnte so ihr mittelalterliches Erscheinungsbild bewahren. Im 15. Jahrhundert gelang es den Bürgern, den Vögten den Besitz und die Rechte an der Stadt abzukaufen. So wurde Stein am Rhein eine reichsfreie Stadt, schloss sich aber in Bündnissen mit Zürich und Schaffhausen zusammen.
Das von den Einheimischen ‚Staa‘ genannte Städtchen besitzt zwei Stadtteile. Die Altstadt mit dem mittelalterlichen Kloster, der ehemaligen Stiftkirche und dem bezaubernden Rathausplatz wird durch eine Brücke mit dem Stadtteil ‚Stein am Rhein vor der Brugg‘ verbunden. An dieser Brücke mündet der Bodensee offiziell in den Oberrhein. Hier springen die Jugendlichen im Hochsommer vom Geländer in die grün-blauen Fluten, um sich einen Kilometer flussabwärts treiben zu lassen. Östlich der Brücke liegen die drei Werd-Inseln, von denen die beiden unbewohnten zu Stein am Rhein gehören. Südlich der Rheinbrücke befinden sich der Bahnhof und die Überreste des alten römischen Kastells Tasgetium aus dem 3. Jahrhundert. Bereits im frühen Mittelalter errichtete man innerhalb der alten römischen Umgrenzungsmauern die Johanneskirche.
Sehenswertes:
Die Stadtentwicklung von Stein am Rhein hängt eng mit der Geschichte der Benediktinerabtei St. Georgen zusammen. Nachdem das Kloster im frühen 11. Jahrhundert hierher an den Rhein verlegt wurde, entwickelte sich aus dem Fischerdorf allmählich ein befestigter Marktort, der 1267 zur Stadt erhoben wurde. Stein am Rhein erhielt eine Stadtmauer, die die Stadt umschloss und nur das Rheinufer ausgesparte. Zwei große Tore sind noch erhalten. Das Obertor im Norden wurde 1363 und das Untertor im Westen 1367 erstmals urkundlich erwähnt. Das Öhningertor im Osten steht heute nicht mehr. Es fiel 1840 dem Verkehr zum Opfer. Mit dem Rheintörli am Kloster gibt noch ein weiteres, zur alten Stadtbefestigung gehörendes kleines Stadttor.
Der Hexenturm an der Schiffsländle, auch Diebsturm genannt, wurde erstmals 1548 erwähnt. Vermutlich wurde er aber bereits im 14. Jahrhundert errichtet. Der Begriff ‚Diebsturm‘ deutet auf die frühere Verwendung: er diente einst als Kerker. Später wurde der Zinnenkranz zu Fenstern umgestaltet.
Hoch über der Stadt Stein am Rhein, an einem Hang des Schinerberges, steht die stolze mittelalterliche Burg Hohenklingen. Da sie während kriegerischer Auseinandersetzungen nie zerstört wurde, hat sie ihr historisches Aussehen bis heute weitgehend bewahren können.
Ein erster steinerner Wohnturm entstand an dieser Stelle bereits um das Jahr 1200. Man nimmt aber an, dass hier auch schon vorher hölzerne Wohntürme gestanden haben. Die Freiherren von Klingen, Kastvögte des Klosters St. Gallen, bauten die Burganlage im 13. bis 15. Jahrhundert kontinuierlich aus. Es entstanden der Palas und die Ringmauer, der 20 Meter hohe Turm, der Zwinger, die östliche Schildmauer und die Kapelle. 1423 hatte die Höhenburg den Umfang ihrer heutigen Größe erreicht.
Die Burg gehörte als Endpunkt zu den Zürcher Hochwachten und wurde bis in das 19. Jahrhundert hinein von einem Vogt bewohnt, der hier den Hochwächterdienst versah. Im Schwabenkrieg 1499 und im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) besaß die Festung eine strategisch wichtige Rolle und wurde sogar noch im Zweiten Weltkrieg als Beobachtungsposten genutzt. Heute beherbergt Burg Hohenklingen ein Restaurant, das auch wegen der wunderschönen Aussicht ein beliebtes Ausflugsziel geworden ist.
Die ehemalige Benediktinerabtei am Ufer des Rheines gilt als eine der am besten erhaltenden mittelalterlichen Klosteranlagen der Schweiz. Im Jahre 1005 begannen die Mönche, an der strategisch wichtigen Straßen- und Wasserkreuzung am westlichen Ende des Untersees ein Kloster zu errichten. Die heute noch erhaltenen Klostergebäude stammen überwiegend aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Von besonderer bauhistorischer Bedeutung sind der gotische Kreuzgang, der Kapitelsaal aus dem 15. Jahrhundert und der Festsaal mit Fresken aus der Zeit um 1515, die zu den ältesten Zeugnissen der Renaissance nördlich der Alpen zählen.
Die Entwicklung der Stadt Stein am Rhein war immer eng verbunden mit der des Klosters St. Georgien. Doch als die Reformation in die Stadt Einzug hielt, wandten sich die Bürger gegen das katholische Kloster, dass in der Folge 1525 aufgelöst wurde.
Obwohl die Gebäude danach bis in das 19. Jahrhundert hinein als Amtssitz der Stadt Zürich genutzt wurden, blieb der Baubestand weitgehend unverändert. In der Folgezeit diente das historische Gemäuer als Schule, als Fabrik, als Turnhalle und schließlich als Kulturzentrum. Nach einer umfangreichen Renovierung wurde in dem ehemaligen Kloster ein Museum eingerichtet, das auch heute noch Bestand hat.
Die evangelisch-reformierte Kirche in Stein am Rhein war einst die Stiftskirche des Benediktinerklosters St. Georgen und gehörte zu den ältesten Bauteilen des Konvents. Das romanische Langhaus wurde um das Jahr 1100 erbaut, steht aber auf noch sehr viel älteren Fundamenten. Der Kirchturm wurde im 16. Jahrhundert ergänzt.
Als die Reformation in Stein am Rhein Einzug hielt, wandten sich die Bürger der Stadt gegen das katholische Kloster, das in der Folge 1525 aufgelöst wurde. Seit dieser Zeit dient die mittelalterliche Basilika der reformierten Gemeinde als Gotteshaus. Sehenswert sind die Wandmalereien im Chor und in der Liebfrauenkapelle.
Der heutige Rathausplatz ist der ehemalige Marktplatz der Stadt Stein am Rhein. Er wird beherrscht von dem Rathaus mit seinem markanten Glockenturm. Das Gebäude entstand zwischen 1539 und 1542. Die Wandmalereien zeigen Begebenheiten aus der Stadtgeschichte. Einst diente das Ratsgebäude auch als Kaufhaus und Kornhalle, heute sind hier nur noch städtische Einrichtungen untergebracht.
Um den Rathausplatz stehen noch einige bemerkenswerte mittelalterliche Bauten und später hinzugekommene Fachwerkhäuser. Beeindruckend sind die verschiedenen Fassadenmalereien aus der Renaissance, dem Barock und der Zeit um 1900. Ein Haus ist sehenswerter als das andere, sei es das Haus ‚Zur vorderen Krone‘ mit dem steilen Fachwerkgiebel, das Wirtshaus ‚Zum Rothen Ochsen‘, das seit dem 15. Jahrhundert ununterbrochen ein Gasthaus beherbergt, das Wirtshaus ‚Zum weißen Adler‘ mit der ältesten Fassadenmalerei der Stadt (um 1525) oder das Haus ‘Zum steinernen Trauben’ mit seinem hervorstechenden Kastenerker.
Das Wirtshaus ‚Zum Rothen Ochsen‘ gab es nachweislich bereits im Jahre 1446 und damit gehört es zu den ältesten Weinstuben der Schweiz. Zunächst hieß der Gasthof mit der gotischen Fassade nur ‚Ochsen‘. Erst bei der Hausbemalung im Jahre 1615 wurde der Ochse rot. Das Gebäude mit seinem kunstvoll verzierten Steinerker und seinen gotischen Fenstern gehört zu den ältesten Steiner Häusern. Ein genaues Baujahr ist nicht bekannt, doch wird es auf das 14. Jahrhundert geschätzt. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit kaum verändert. Das Gasthaus legt Wert auf sein gemütliches historisches Ambiente. Zu den Schweizer Speisen wird eine Auswahl an regionalen und internationalen Weinen angeboten.
Das Krippenmuseum befindet sich im ältesten noch original erhaltenen Haus in Stein am Rhein. Im Gewölbekeller des 1302 erbauten Gebäudes werden jährlich wechselnde Ausstellungen mit jeweils 500 bis 700 verschiedenen Exponaten gezeigt. Die Krippenschau geht auf die Sammlung der bayrischen Familie Hartl zurück, die über viele Generationen hinweg die Dioramen zusammengetragen hat. Jetzt sind sie auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und weisen auf den eigentlichen Ursprung des Weihnachtsfestes hin – auch wenn die Jahreszeit nicht immer passend ist. Das Museum ist nämlich ganzjährig geöffnet.
Auf der linken Rheinseite im Stadtteil Burg stand auf einer kleinen Anhöhe ein römisches Kastell. Mauerreste des im 3. Jahrhundert entstandenen Kastells Tasgetium sind noch bis heute erhalten und lassen sogar den Grundriss noch weitgehend erkennen. Das Fort wurde durch vier Ecktürme und acht weiteren Türmen geschützt. Das Haupttor befand sich im Süden. Inmitten des 7900 m² großen Areals errichtete man im frühen Mittelalter die Johanneskirche. Es handelt sich dabei um die älteste urkundliche erwähnte Kirche des Kantons Schaffhausen. Ausgrabungen belegen, dass es hier bereits im 6. Jahrhundert ein christliches Gotteshaus gegeben hat. In der Kirche mit dem kleinen Zwiebeltürmchen beeindrucken insbesondere die umfangreichen Wandmalereien im Chor, die noch aus der Zeit von vor 1420 stammen.
In einem alten Bürgerhaus befindet sich das heimatkundliche Museum ‚Lindwurm‘, dass die Wohnkultur sowie die Landwirtschaft im 19. Jahrhundert beschreibt. Von der Wohnstube, dem Schlafzimmer, der Küche bis zur Waschküche im Keller ist alles so eingerichtet, wie es damals wohl ausgesehen haben muss.
Der Begriff ‚Lindwurm‘ stammt übrigens aus dem germanischen und beschreibt einen schlangenförmigen Drachen. Der Museumsname bezieht sich auf das Wappen von Stein am Rhein. Dieses stellt St. Georg, den Schutzpatron der Stadt dar, wie er gerade den Drachen besiegt.
Radrouten die durch Stein am Rhein führen:
Bodensee Radweg
Rhein-Route (Nationale Veloroute Nr. 2)
Rheintal-Radweg
Öhningen
hningen ist die größte Gemeinde der im Untersee liegenden Halbinsel Höri. Im Westen grenzt der Ort direkt an die Schweiz. Alle drei Ortsteile, Wangen, Schienen und Öhningen sind staatlich anerkannte Erholungsorte. Die Naturlandschaft Untersee, ein Teil des Bodensees, mit seinen wunderschönen Ufergebieten laden zum Spazierengehen, Radwandern, Schwimmen oder zum Bootfahren ein. Gerade in der Wangener Bucht gibt es ein breites Angebot von Wassersportmöglichkeiten. Sehenswert ist das kleine Fischermuseum in Wangen, das viele Exponate aus den jungsteinzeitlichen Pfahlbausiedlungen zeigt, die hier am Ufer geborgen werden konnten. Die Ausgrabungsstätten gehören seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Weitere kulturhistorische Sehenswürdigkeiten sind das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift in Öhningen und die romanische Wallfahrtskirche in Schienen. Das Dorf Schienen liegt etwas landeinwärts am Fuße des Schienerberges – einem Paradies für Wanderer und Radsportler mit wunderbaren Ausblicken über den Bodensee und bis in die Schweizer Alpen.
Sehenswertes:
Eine erste Wasserburg stammt wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert. Aber bereits 1166 wurde durch Kaiser Friedrich Barbarossa ‚Cattenhorn‘ als Besitz des Stiftes Öhningen bestätigt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Wasserburg zu einem Schloss umgebaut. Der Turm wurde abgetragen, die Wassergräben zugeschüttet und die Gärten neu angelegt. Das Anwesen war fortan nur noch ein repräsentativer Adelssitz ohne Wehraufgaben. Auch heute befindet sich Schloss Kattenhorn im privaten Besitz und kann nicht besichtigt werden.
Bereits im Jahre 965 bestätigte Kaiser Otto I. dem Grafen Kuno zu Öhningen das Privileg, eine Kirche zu bauen. Im 13. Jahrhundert ist dann auch der Bau eines Klosters nachweisbar. Die heute noch bestehenden Kloster- und Kirchenbauten wurden allerdings erst im 17. Jahrhundert errichtet. Die ehemalige Stiftskirche wurde im Stil der Renaissance erbaut und dient heute als katholische Pfarrkirche St. Hippolyt und Verena. Im Inneren befinden sich noch etliche wertvolle und sehenswerte Kunstschätze. Das Kloster wurde im Zuge der Säkularisierung im Jahre 1803 aufgelöst.
Besonders üppig ausgestattet ist der Konventsaal mit seiner wunderschönen barocken Ausstattung und den Stuckarbeiten aus dem Rokoko. Die ehemalige Klostervogtei dient heute als Rathaus. Die übrigen Konventgebäude werden als Pfarramt, aber auch Künstlerateliers genutzt.
In der Wangener Bucht am Bodensee fand man jungsteinzeitliche Siedlungen, die aus einer Zeit von 4.000 – 2.000 v. Chr. stammen. Diese Pfahlbausiedlungen gehören zu den ältesten Siedlungsspuren im Bodenseeraum und wurden 2011 gemeinsam mit 110 weiteren prähistorischen Ausgrabungsstätten ähnlicher Art in den Kanon der UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.
In einem der ältesten Häusern Öhningens befindet sich im Ortsteil Wangen das Museum Fischerhaus. Das Riegelfachwerkhaus wurde 1618 erbaut. Es präsentiert eine umfangreiche Auswahl von Gegenständen, die man bei den seit 1856 stattfindenden Grabungen geborgen hat. Dazu gehören Ton- und Keramikgefässe, Werkzeuge aus Stein, Knochen und Tiergeweihen sowie verschiedene Textilen, die sich im luftabgeschlossenen Raum unter Wasser erhalten haben.
Ein weiterer Ausstellungsschwerpunkt ist die Fossiliensammlung, deren Exponate aus den Öhninger Steinbrüchen stammen. Hier entdeckte man im versteinerten Zustand mehr als 900 urzeitliche Tier- und 450 Pflanzenarten. Das eindrucksvollste Fundstück ist wohl das eines versteinerten Riesensalamanders.
Am steilen Hang des Schienerberges steht die alte katholische Kirche St. Genesius. Sie wurde um das Jahr 1000 gebaut und gehörte einst zu einem Kloster. Das romanische Gotteshaus wirkt sowohl von außen als auch von innen relativ schlicht. Eine 1430 geschnitzte Holzskulptur stellt das Gnadenbild ‚Maria mit dem Kind‘ dar und ist das Ziel einer Jahrhunderte alten Wallfahrt.
Die einstige Kirche auf dem Käppelberg gehört zu den ältesten Gotteshäusern am Bodensee. Schon im 9. Jahrhundert hatte sie nachweislich an diesem Ort gestanden. Man vermutet sogar, dass sich hier einmal eine frühgeschichtlich keltische Kultstätte befunden hatte. Mauerteile aus diesem keltischen Kultraum wurden vermutlich in den frühen Kirchenraum integriert. Somit stellt das Gotteshaus eine Verbindung der frühen christlichen mit der keltischen Kultur dar. Eine Zeitlang war die Kirche auch Ziel einer Wallfahrt, in deren Mittelpunkt die Reliquien des hl. Genesius standen.
Im Ortsteil Kattenhorn steht mitten im Dorf die kleine Blasiuskapelle. Das Gotteshaus mit dem Zwiebeltürmchen wurde 1520 erbaut und gilt als Juwel unter den Baudenkmälern auf der Halbinsel Höri. In der Blasiuskapelle finden auch heute noch Gottesdienste statt.
Hinter der Szenerie: Die Sage vom aufrecht schwimmenden Blasius Als im 16. Jahrhundert die Reformation auch am Bodensee Einzug hielt, zogen auch hier wilde Horden von Ort zu Ort. Sie entfernten aus den Gotteshäusern Bilder und Statuen, da sie diese als Götzenbilder ansahen. Neben dem einzigen Gott sollten keine weiteren Götter, Heilige oder sonstige Figuren angebetet werden. Der Zorn der Anhänger Zwinglis, Calvins und Hus‘ entlud sich gegen die Katholische Kirche im so genannten Bildersturm. Viele Kunstschätze wurden zerstört oder einfach achtlos in den See geschmissen, darunter auch die Statue des hl. Blasius. Aufrecht schwimmend erreichte die Skulptur das Ufer von Kattenhorn – so erzählt es die Sage. Die Dorfbewohner sahen dies als Zeichen des Himmels an und errichteten für diese Statue eine eigene Kapelle, um die Holzfigur anbeten zu können. Der hl. Blasius wurde fortan in Kattenhorn als Schutzpatron verehrt.
Die evangelische Petruskirche wurde erst 1959 erbaut. Berühmtheit erlangte sie durch die großflächigen Glasfenster des Künstlers Otto Dix. Dix, der im benachbarten Hemmhofen lebte, zählte zu den bedeutendsten deutschen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Die eindrucksvollen farbigen Fenster zeigen Szenen aus dem Wirken des Apostels Paulus. Sie zählen zu den größten Werken von Otto Dix.
Man glaubt es kaum, aber der riesige Findling stammt aus Afrika und entstand dort vor ungefähr 250 Mio. Jahren. Er wanderte durch die Kontinentalverschiebung und der damit verbundenen Auffaltung der Alpen immer weiter nach Norden. Der Rheingletscher der letzten Eiszeit versetzte ihm den letzten Schub, so dass er bis in das Gebiet des heutigen Öhningens weiterbewegt wurde. Hier wurde er von jüngeren Erdschichten bedeckt, aber im Jahre 2002 entdeckt und wieder ausgegraben.
Eine aufregende Wanderung verspricht der 11 km lange Rundweg durch die wunderschöne wildromantische Klingenbachschlucht. Vom Kattenhorner Bühl hat man eine tolle Aussicht auf den Untersee, auf Öhningen und das schweizerische Stein am Rhein.
Allerdings werden knöchelhohe Wanderschuhe mit gutem Profil empfohlen, denn der Pfad mit seinen Bohlenwegen, seinen engen Stegen und Brücken ist gerade bei nasser Witterung nicht ganz einfach.
Der Schienerberg liegt auf der Halbinsel Höri oberhalb des Untersees. Am Fuße liegt das Dörfchen Schienen, versteckt in den dichten Wäldern verbirgt sich die Ruine Schrotzburg. Früher fanden hier einmal Autorennen statt. Heute ist der Berg bei Rennradfahrern sehr beliebt und bei Hobbyfahrern gefürchtet, denn seine Passstraße erfordert radfahrerisch doch enorme Kletterqualitäten. Die nördliche Rampe, die in Serpentinen bis zur Passhöhe führt, beträgt eine durchschnittliche Steigung von 7%, die Südrampe auf 7 km immerhin noch 4,5 %. Trotz der Anstrengungen lohnt sich eine Fahrt auf den Schienerberg, denn sie bietet atemberaubende Weitblicke über den Bodensee und in den Hegau sowie in die schweizerischen Alpen.
Der jüdische Dichter Jacob Picard (1883 – 1967) wurde im Öhninger Ortsteil Wangen geboren. Er wurde mit seinen Gedichten zum Chronisten des deutschen Landjudentums. Eine Gedenkausstellung im alten Rathaus von Wangen erinnert an den Lyriker. Hier bietet eine Bibliothek und eine Hörstation die Möglichkeit, sich mit dem Werk und den Texten Picards auseinanderzusetzen.
Radrouten die durch Öhningen führen:
Gaienhofen
ie ‚Höri‘ ist eine Halbinsel im Untersee, einem Teil des Bodensees, zwischen Radolfzell und Stein am Rhein. An der Süd- und Ostseite liegt die Gemeinde Gaienhofen. Gegenüber liegt im Nordosten die Insel Reichenau und im Süden das schweizerische Steckborn. Die Höri-Fähre verbindet jeweils sonn- und feiertags Gaienhofen und Steckborn.
Auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde fand man prähistorische Pfahlbausiedlungen, die auf ein Alter von fast 6000 Jahre datiert wurden. Die Ausgrabungsstätten ‚Hornstaad I-V‘ gehören seit 2011 zum UNESCO Weltkulturerbe.
In Gaienhofen haben eine Reihe bekannter und bedeutender Literaten und Künstler gelebt: Hermann Hesse, Otto Dix, Max Ackermann, Erich Heckel, Luwig Finckh und Helmuth Macke. Die Wohnhäuser von Hermann Hesse und Otto Dix sind als Museen der Öffentlichkeit zugänglich.
Sehenswertes:
Die ‚Höri‘ ist eine Halbinsel im Untersee, einem Teil des Bodensees, zwischen Radolfzell und Stein am Rhein. Im Winkel der Halbinsel, dem ‚Horn‘, liegt die Gemeinde Gaienhofen. Im Zentrum des Ortes befindet sich ein Museum, das in zwei Gebäuden das Hermann-Hesse-Museum und das Höri-Museum miteinander vereint. Hesse, der berühmte deutsch-schweizerische Schriftsteller und Dichter, lebte zwischen 1904 und 1912 in Gaienhofen. Sein erstes Wohnhaus wurde 1993 dem Höri-Museum angegliedert und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hier finden sich alte Schriftstücke, persönliche Gegenstände, Fotos, Erstausgaben und sein damaliger Schreibtisch. Ein weitere Schwerpunkt des Museums ist die Gemälde- und Skulpturengalerie im unmittelbar daneben liegenden ehemaligen Schul- und Rathaus, die Werke der auf der Höri wirkenden Künstler zeigt, darunter Bilder von Otto Dix, Max Ackermann, Erich Heckel und Helmuth Macke. Eine weitere Abteilung informiert über die prähistorischen Pfahlbauten im Untersee und das Leben in der Jungsteinzeit.
Der deutsch-schweizerische Schriftsteller und Dichter Hermann Hesse (1877 – 1962) ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Berühmt geworden ist er mit seinen Werken ‚Der Steppenwolf‘, ‚Das Glasperlenspiel‘, ‚Unterm Rad‘ und ‚Siddhartha‘ sowie seinen Gedichten (u.a. ‚Stufen‘). Er erhielt 1946 den Nobelpreis für Literatur und 1954 den Orden ‚Pour le mérite für Wissenschaft und Künste‘.
Hesse lebte zwischen 1904 und 1912 in Gaienhofen unweit der Schweizer Grenze. 1907 ließ er hier für sich und seine Familie ein neues Wohnhaus bauen, dass sich nach einer umfangreichen Sanierung zwar immer noch im privaten Besitz befindet, aber dennoch nach vorheriger Anmeldung zu besichtigen ist. Ein großer Teil der baulichen Ausstattung ist noch original erhalten.
Otto Dix (1891 – 1969) gehört zu den bekanntesten und bedeutendsten deutschen Malern und Grafikern des 20. Jahrhunderts. Obwohl er in den 1920er Jahren zu einem der führenden Vertretern der Neuen Sachlichkeit wurde, blieb er stets wandelbar und ließ sich nicht auf eine einzige Stilrichtung festlegen. Dennoch blieb er dem Realismus treu. Während der Herrschaft der Nationalsozialisten im Dritten Reich verlor er seine Professur in Dresden, wurde als ‚entartet‘ gebrandmarkt und zog sich schließlich an den Bodensee zurück, wo er 1936 mit seiner Familie sein Haus in Hemmhofen bezog. Hier wohnte und arbeitete er bis zu seinem Tod im Jahre 1969. Seit 1991 ist das ehemalige Wohnhaus und Atelier des Künstlers für die Öffentlichkeit zugänglich. Das ‚Museum Haus Dix‘ gehört heute zum Kunstmuseum Stuttgart und zeigt das breite Spektrum seiner Werke in wechselnden Ausstellungen.
Die Ursprünge von Schloss Gaienhofen liegen im Mittelalter. Um das Jahr 1100 ließ Bischof Gebhard III. von Zähringen auf der Halbinsel Höri eine Burg als Jagdsitz erbauen. Das Anwesen am Ufer des Untersees wurde mehrfach eingenommen und besetzt, so im Schweizerkrieg 1499, im Bauernkrieg 1524/25 und im Dreißigjährigen Krieg. Um 1700 ließ man die Burg repräsentativ zu einem barocken Schloss mit neun Türmen umbauen, wobei bereits Mitte des 19. Jahrhunderts der letzte Turm wieder abgebrochen wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Anwesen lange als evangelisches Mädcheninternat und wurde zu diesem Zwecke auch mehrfach umgebaut. Seit 2013 beherbergt es ein evangelisches Schulzentrum.
Die Horner Kirche liegt erhöht auf der Spitze der Halbinsel Höri. Von hier aus hat man einen weiten Blick über den Untersee in Richtung der Insel Reichenau bis nach Konstanz. Die katholische Pfarrkirche ist Johannes dem Täufer und St. Veith geweiht. Sie wurde als Saalkirche im spätgotischem Stil unter Verwendung eines alten romanischen Mauerwerkes errichtet und 1717 barock umgebaut. Die üppige Innenausstattung ist zum überwiegenden Teil im Barockstil gehalten. Die beiden wertvollen Altarflügel stammen allerdings bereits aus der Zeit um das Jahr 1500.
Radrouten die durch Gaienhofen führen:
Moos (am Bodensee)
emütlich und ursprünglich, natürlich und bodenständig – so kann man die Gemeinde Moos beschreiben, die hübsch am südwestlichen Ende des Bodensees, der hier auch Untersee genannt wird, auf der Halbinsel Höri liegt. Weite Teile des schilfreichen Ufers stehen unter Naturschutz, da es ein Refugium für eine artenreiche Tierwelt, insbesondere für Wasservögel, darstellt. Nördlich des Ortes mündet die Radolfzeller Aach, die aus Sickerwasser der Donau besteht, in den Bodensee und bildet dabei ein kleines Flussdelta. Ein Naturlehrpfad mit verschiedenen Schautafeln versucht die Zusammenhänge in der Natur zu erklären. Die Gemeinde mit den Ortsteilen Moos, Iznang, Bankholzen und Weiler bietet ein ausgeprägtes Wander- und Radwandernetz durch die wunderschöne ufernahe Landschaft des Aachenriedes mit Gemüsefeldern und Streuobstwiesen bis hin zum Schienerberg, der von Rennradlern viel zum Bergtraining genutzt wird, bei Hobbyradlern allerdings höchst gefürchtet ist.
Sehenswertes:
Die Radolfzeller Aach ist ein linker Nebenfluss des Rheins. Sie entspringt bei Aach im so genannten Aachtopf und bildet dort die wasserreichste Quelle Deutschlands. Sie wird zum überwiegenden Teil aus Donauwasser gespeist, denn der Oberlauf der Donau versickert in der Karstklüfte von Immendingen teilweise vollständig und tritt erst nach einem 12 km langen unterirdischen Verlauf im Quelltopf der Aach wieder an die Oberfläche. Nach 32 km mündet die Radolfzeller Aach schließlich in den Bodensee und bildet dort ein kleines Flussdelta, das einem ständigen Wandel unterzogen ist. Der Unterlauf verläuft frei und unkanalisiert und bildet so eine naturnahe und schützenswerte Flusslandschaft. Das Delta wird im Frühjahr als Brutstätte von vielen Wasservögeln genutzt, außerdem dient es als Rastplatz für Zugvögel und im Winter als Lebensraum für zahlreiche überwinternde Vogelarten.
Am Hafen von Moos steht ein futuristisch anmutender 18 m hoher Turm. Er ist das Ergebnis eines Designwettbewerbs der Fachhochschule Konstanz. Die Edelstahlkonstruktion wurde von Ruth Anton entworfen und dient mit seiner Solartechnik auch der Stromerzeugung.
Radrouten die durch Moos am Bodensee führen:
Radolfzell am Bodensee
ie Kur- und Große Kreisstadt strahlt eine erfrischende Gemütlichkeit aus. Überall im Zentrum begegnet einem die 1.200 Jahre alte Geschichte der einst einflussreichen Stadt am Untersee. Bischof Radolf von Verona hatte 826 eine Basilika erbauen lassen, die Keimzelle des heutigen Radolfzell. Im 13. Jahrhundert wurde der Ort Münzstätte des Klosters Reichenau, ab 1540 übte Radolfzell das Münzrecht selber aus. Von der mittelalterlichen Stadtbefestigung blieben noch der Höllturm und der Pulverturm erhalten. Der ehemalige Stadtgraben wurde in den 1920er Jahren zum Stadtpark umgestaltet und einst wegen seiner Nähe zum Bahnhof als ‚schönster Wartesaal Deutschlands‘ bezeichnet. In der Stadtmitte Radolfzells prägen das Münster ‚Unser Lieben Frau‘, das Österreichische Schlösschen und das Rathaus den zentralen Marktplatz. Das futuristisch anmutende Konzertsegel prägt die Promenade am Bodenseeufer. Hier finden in den Sommermonaten häufig Konzerte statt. Vom Anleger wird ein regelmäßiger Schiffsverkehr auf die Insel Reichenau mit Anschlüssen nach Stein am Rhein, Schaffhausen und Konstanz angeboten. Auf der Halbinsel Mettnau findet der Kurbetrieb der renommierten Herz- und Kreislaufklinik statt. Ein großer Teil der Halbinsel ist jedoch dem Vogelschutz vorbehalten und darf in der Brutzeit nicht betreten werden. Auch der Mindelsee im Norden des Stadtzentrums ist ein bedeutendes unter Naturschutz stehendes Feuchtgebiet für Wasservögel.
Sehenswertes:
Das Radolfzeller Münster ULF wurde zwischen 1436 und 1488 im spätgotischen Stil als Nachfolgebau einer kleineren romanischen Kirche errichtet und im 16. Jahrhundert noch einmal ausgebaut. Dieser erste Kirchenbau wurde um 826 durch Bischof Radolf von Verona, nach dem die Stadt benannt wurde, gestiftet. Die heutige dreischiffige Pfeilerbasilika besitzt mit 82 m den höchsten Turm am Bodensee. Dieser wurde allerdings erst 1903 fertig gestellt. Die katholische Pfarrkirche im Zentrum Radolfzells ist das Wahrzeichen der Stadt und beherbergt die Reliquien der heiligen Hausherren Theopont, Senesius und Zeno. Noch heute wird jeden Mittwoch eine Wallfahrtsmesse abgehalten. Neben den gotischen Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert ist die Kreuzigungsgruppe besonders sehenswert. Sie wurde um 1625 durch den Bildhauer Hans Schenk (um 1585 – 1648) geschaffen. Das Meisterwerk wurde 2011 vorübergehend nach Freiburg verbracht, um dort als Kulisse für eine von Papst Benedikt XVI. gehaltene Messe zu dienen. Weitere Kunstwerke sind der Marienaltar von 1632, die Plastiken der Stadtpatrone in der Hauskapelle (17. Jhd.) sowie der neugotische Hochaltar.
In der alten Stadtapotheke in Radolfzell befindet sich heute das Stadtmuseum. Das dreistöckige Gebäude wurde 1834 im Biedermeierstil umgebaut. Das Museum präsentiert eine umfangreiche Ausstellung über die Stadtgeschichte und geht auch insbesondere auf die Geschichte des Hauses als Apotheke ein. Mehrere Räume zeigen Apothekenausstattungen aus verschiedenen Epochen, die aus heutiger Sicht recht abenteuerlich anmuten! Die älteste Einrichtung stammt aus dem Jahre 1689. Das Museum besitzt eine Sammlung von Gemälden Carl Spitzwegs – schließlich war auch dieser in seinem beruflichen Leben Apotheker gewesen. Zwischenzeitlich werden in den Museumsräumen auch immer wieder interessante Wechselausstellungen gezeigt.
Das markante dreistöckige Ratsgebäude im Zentrum Radolfzells fällt durch seine vielen Rundbogenfenster auf. Es wurde 1848 erbaut. Durch seine großen Tore wurden früher die Waren in das Gebäude gebracht, denn das Erdgeschoss des Rathauses diente einst auch als Frucht- und Markthalle.
Das Schloss am Marktplatz von Radolfzell besitzt eine bewegte und wechselvolle Geschichte, aber als repräsentativer Adelssitz diente es nie. Unter Übernahme der Bausubstanz zweier mittelalterlichen Chorherrenhäuser ließ Erzherzog Leopold V. von Österreich im Jahre 1619 mit dem Bau des Schlosses beginnen. Doch Geldmangel und der Dreißigjährige Krieg sorgten dafür, dass zunächst nur der Gewölbekeller und das Erdgeschoss fertig gestellt wurden. In diesem Zustand wurde das Gebäude nur als Speicher und Weinlager genutzt. Erst im frühen 18. Jahrhundert vollendete man den Bau, der nun als Rathaus und später als Schule diente. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beherbergte es die Altertümersammlung. Heute ist hier die Stadtbibliothek untergebracht.
Radolfzell war schon im 15. Jahrhundert ein beliebter Rittersitz. Ab 1557 tagte hier sogar regelmäßig die Hegauritterschaft, die die Stadt zum Verwaltungszentrum erhob. Das eindrucksvolle Ritterschaftshaus, das in unmittelbarer Nähe des Münsters im 16. Jahrhundert für diese Sitzungen erbaut wurde, zeugt noch heute von dieser städtischen Blüte Radolfzells im ausgehenden Mittelalter. Heute dient das Gebäude als Amts- und Arbeitsgericht.
Der Stadtgraben, der im Mittelalter noch der Verteidigung diente, wurde 1922 zu einem langgezogenen Park umgestaltet. Er umgibt einen Großteil der historischen Altstadt mit einer Vielzahl von prächtigen bunten Blumenbeeten und großen seltenen Kübelpflanzen. Da der Bahnhof in unmittelbarer Nähe zum Park liegt, bezeichnete ihn der Dichter Ludwig Finckh einmal als den schönsten Wartesaal Deutschlands.
Von der mittelalterlichen Stadtbefestigung Radolfzells sind noch zwei alte Türme erhalten. Der Höllturm, im Volksmund auch ‚Hölle‘ genannt, ist ein nach außen wuchtig wirkender Rundturm, der zur Stadtseite viereckig ausgebaut ist. Er wird oben von Zinnen abschlossen.
Da im Zuge des Eisenbahnbaus während der 1860er Jahre weite Bodenflächen angehoben werden mussten, verschwand auch der untere Teil des Pulverturms im aufgeschütteten Erdreich. So wirkt er heute nicht mehr so stattlich wie noch im Mittelalter. Der Zustand des Stadtgrabens und der Stadtbefestigung ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts unverändert erhalten geblieben.
Die Mettnau ist eine langgezogene Halbinsel im Bodensee bei Radolfzell. Sie ist 3,5 km lang und besitzt eine Breite von 800 m. Ein Großteil dieser Halbinsel ist als Naturschutzgebiet deklariert, da sich hier ein wichtiges Brutgebiet für Wasservögel befindet. Daher ist die Mettnauspitze zwischen April und August für Spaziergänger und Wanderer gesperrt. Das gilt auch für die im Süden vorgelagerte Liebesinsel. Am äußersten Ende des öffentlichen Floerickeweges steht der Mettnauturm, von dem man einen wunderschönen Blick über den Untersee nach Markelfingen genießen kann.
Die übrige Mettnau ist bebaut und wird durch die vier Häuser der Mettnau-Kur genutzt. Diese hat sich auf Herz- und Kreislaufkrankheiten spezialisiert und gehört zu den bedeutendsten Bewegungstherapiezentren in Deutschland. Die Kurverwaltung befindet sich im Scheffelschlösschen, der ehemaligen Villa des Dichters Joseph Victor von Scheffel.
Joseph Victor von Scheffel (1826 – 1886) war im 19. Jahrhundert ein bekannter Schriftsteller und Dichter. Zeit seines Lebens hatte er regelmäßig die Halbinsel Mettnau besucht. 1876 erwarb er, frisch geadelt, das Gut Mettnau und baute es zu einem kleinen Schloss im Stil der Neo-Renaissance aus. Heute sitzt hier die Kurverwaltung und daher ist das Scheffelschlösschen nur eingeschränkt zu besichtigen.
Der Apotheker Karl Josef Bosch (1809 – 1881) ließ 1865 eine Villa als Wohnhaus erbauen. Heute befindet sich das Haus im Besitz der Stadt Radolfzell und dient als Städtische Kunstgalerie. Die Institution kümmert sich insbesondere um die Pflege zeitgenössischer Kunst. Daneben finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen, wie klassische Konzerte renommierter Künstler, Lesungen und Kleinkunstvorstellungen statt.
Das heutige Weltkloster erhielt sein heutiges klassizistisches Aussehen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der damalige Bürgermeister die alte Klosterkirche des Kapuzinerordens zu einem Wohnhaus umgestaltete. Die alten Wohngebäude aus dem 17. Jahrhundert ließ er abreißen. Zwischenzeitlich diente das alte Klostergebäude auch einem Weingroßhandel, bevor hier das Weltkloster einzog. Die Institution des Weltklosters ist ein Ort interreligiösen Lebens, die auf die friedensstiftende Kraft des Dialogs zwischen den Religionen und Kulturen vertraut.
Im Wasserschloss Möggingen befindet sich heute die Vogelwarte Radolfzell des Max-Planck-Instituts für Ornithologie. Daneben wird es von der Familie Bodman noch privat bewohnt.
Der Ursprung der Wehranlage liegt im frühen 12. Jahrhundert, als auf einer erhöhten Landzunge ein erster Burgturm entstand. Um das Jahr 1600 errichteten die Herren von Bodman an dieser Stelle einen von Wassergräben umgebenen Schlossbau. Nachdem dieser im Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt wurde, baute man ihn Ende des 17. Jahrhunderts wieder neu auf. Bei einem letzten Umbau im Jahre 1834 erhielt das Wasserschloss sein heutiges Aussehen.
Die auch als ‚Landkirche‘ bezeichnete katholische Pfarrkirche St. Zeno steht im Stadtteil Stahringen. Der schlichte Bau mit der klassisch gegliederten Fassade und dem kleinen Türmchen stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und gilt als typisches Beispiel für den frühen Historismus. Im Radolfzeller Münster werden noch immer die Reliquien des Schutzpatrons Zeno bewahrt.
Die heutige katholische Kirche in Güttingen erhielt ihr heutiges Aussehen bei einem Ausbau 1886. Teile von ihr sind aber erheblich älter. Ein erster Kirchenbau stammt wahrscheinlich noch aus dem 11. Jahrhundert. Dieser wurde jedoch wegen Baufälligkeit im 18. Jahrhundert fast vollständig abgetragen. Allein die Südmauer blieb erhalten. Sie wurde in den 1736 fertig gestellten Neubau übernommen. In den 1970er Jahren entdeckte man alte Fresken, die zum Teil noch aus der Frühgotik stammen. Von der ehemaligen barocken Ausstattung blieben nur noch ein Altarbild sowie einige Barockepitaphe erhalten.
Die katholische Pfarrkirche mit dem wuchtigen Turm wurde vermutlich 1462 erbaut. Eine Vorgängerkirche hatte hier schon seit 1000 bestanden. Das heutige Aussehen erhielt das Gotteshaus im Jahre 1612, als es noch einmal erheblich erweitert wurde. Aus dieser Zeit stammen auch die Fresken, die Jesus, Maria und die 12 Apostel darstellen. Das mittelalterliche Kreuz und die Figuren Maria und Johannis stammen noch aus dem 16. Jahrhundert.
Nach einer alten Urkunde schenkte König Ludwig der Deutsche im Jahre 860 Kirche und Land dem Kloster St. Gallen. Seitdem war das Kirchengebäude jedoch zahlreichen Um-, Auf- und Ausbauten unterworfen. Im Bauernkrieg 1525 sowie während des Dreißigjährigen Krieges 1632 und 1636 fügten Brände der Kirche erhebliche Schäden zu. Vom 1747 abgeschlossenen Wiederaufbau zeugen noch heute viele barocke Ausstattungsgegenstände. Eine letzte Erweiterung des schlichten Kirchengebäudes mit seinem charakteristischen seitlich angefügten Zwiebelturm stammt aus der Zeit nach 1879, als wiederum ein Feuer Teile der Bausubstanz zerstört hatte.
Die Kirche in Böhringen fällt durch ihren charakteristischen Zwiebelturm und ihre außergewöhnliche Architektur auf, da es sich bei ihr um eine seltene Winkelkirche handelt. Beide Flügel bilden einen gemeinsamen Innenraum. Der ältere barocke Kirchenteil wurde 1749 fertig gestellt. 1954 wurde an der Nordseite im rechten Winkel ein weiterer Flügel angefügt, um das Gotteshaus zu vergrößern. Zu der Ausstattung gehört der Hochaltar von 1735, zwei Seitenaltäre sowie ein sehenswertes Mosaikbild, das von Hans Baumhauer in den 1950ger Jahren geschaffen wurde.
Der Mindelsee gilt als bedeutendes Feuchtgebiet für Wasservögel und steht daher unter Naturschutz. Hier brüten 98 verschiedene Vogelarten. Im Randbereich des Sees tummeln sich eine Vielzahl von Amphibien und Reptilien. Mehr als 700 Blütenpflanzen, darunter mehr als 20 Orchideenarten, wurden am Mindelsee gezählt. Der gut 2 km lange und 560 m breite See ist am Ufer kaum bebaut. Ein alter Mischwald säumt den südlichen Teil des hügligen Uferbereiches. Ein idyllischer Fuß- und Radweg führt einmal um den Gletscherzungensee herum und lädt so zu einem kleinen Abstecher ein.
Die ‚Narrizella Ratoldi‘ wurde 1841 gegründet und ist damit die älteste Narrenvereinigung der Umgebung. Das Museum im Zunfthaus erzählt von der alten Tradition des Vereins und der Radolfzeller Fasnacht. Präsentiert werden Masken, Narrenhäs und Larven, aber auch alte Fotografien.
In diesem Museum werden Kommunikationsgeräte gezeigt, von denen die ältesten aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts stammen. Neben historischen Telefonapparaten, Schreibmaschinen und alten Schalttafeln werden die ersten Rechenmaschinen bis hin zu modernen Computern präsentiert. So wird die Entwicklung der technischen Kommunikation und die des Computers verständlich und nachvollziehbar erklärt.
Radrouten die durch Radolfzell am Bodensee führen:
Bodensee Radweg
Rheintal-Radweg
Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Weg
Reichenau
ie Klosterinsel Reichenau ist die größte Insel im Bodensee. Sie ist 4,5 km lang und lässt sich auf einem 10 Kilometer langen Rundweg auch gut mit dem Fahrrad umrunden. Auf einem 1.300 m langen Damm, der 1838 auf Initiative von Napoléon III. aufgeschüttet wurde, gelangt man bequem sowohl mit dem Auto als auch mit dem Rad die Insel. Am Ende der Pappelallee, die schon von weitem zu sehen ist, steht die Ruine der Wasserburg Schopfen.
Im Jahr 724 wurde auf der ‚reichen Au‘ durch den Wanderbischof Pirmin ein Benediktiner-Kloster gegründet. Die Abtei entwickelte sich im Mittelalter zu einem wesentlichen religiösen und kulturellen Zentrum des Heiligen Römischen Reiches. Sie gehörte zu den bedeutendsten Klöstern der karolingischen Zeit. 1757 wurde der Konvent aufgelöst. Die drei sehenswerten romanischen Kirchen aus dem 9. bis 11. Jahrhundert zeugen von der frühmittelalterlichen Bedeutung. Die ehemalige Klosterkirche, das Münster St. Maria und Markus besitzt eine bemerkenswerte Ausstattung, die zum großen Teil noch aus der Gotik und dem Barock stammt. In der Schatzkammer werden wertvolle Reliquienschreine und Kultgegenstände bewahrt. Seit 2000 gehört die Klosterinsel zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Reichenau besteht auch drei verstreuten Dörfern: Oberzell, Mittelzell und Niederzell. Es gibt aber auch Gemeindegebiete auf dem Festland. Die Gemeindeverwaltung sitzt in den im 16. Jahrhundert errichteten Konventsgebäuden am Münster in Mittelzell. Heute wird die Insel vom Gemüseanbau geprägt, denn das Klima ist hier aufgrund der temperaturausgleichenden Wirkung des Bodensees und der erhöhten Anzahl von Sonnentagen besonders mild. Tomaten, Gurken und Salate werden bevorzugt angebaut. 25% des Eilandes werden von Gewächshäusern bedeckt, 160 ha werden landwirtschaftlich genutzt.
Sehenswertes:
Das Münster geht auf eine Benediktiner-Klostergründung im 8. Jahrhundert zurück. Eine Holzkirche wurde noch im gleichen Jahrhundert durch einen ersten Steinbau ersetzt. Im Jahre 816 wurde eine neue Basilika geweiht, von der noch heute Teile erhalten sind. In der Folgezeit wurde die Abteikirche noch mehrfach um- und ausgebaut. Heute ist das Münster von den drei romanischen Kirchen der Insel Reichenau das größte Gotteshaus. 1757 wurde der Konvent, das neben St. Gallen und Fulda zu den bedeutendsten Klöstern der karolingischen Zeit gehörte, aufgelöst. Die ehemalige Klosterkirche dient heute als katholische Pfarrkirche. In den Anfang des 17. Jahrhunderts durch Fürstbischof Jakob Fugger hinzugefügten Konventsgebäuden sind heute das Pfarrhaus und die Gemeindeverwaltung untergebracht. Die bemerkenswerte Ausstattung stammt zum großen Teil noch aus der Gotik und dem Barock. Sehenswert sind der Flügelaltar im gotischen Hochchor (1498), der Markusaltar (1477), der Heilig-Blut-Altar (1739), die Sandsteinskulptur der Maria mit dem Jesuskind (um 1300) und die Wandgemälde aus der Spätgotik. In der Schatzkammer des Münsters, einem hübschen gotischen Raum aus dem 15. Jahrhundert, werden mehrerer Reliquienschreine und Kultgegenstände aus dem 5. bis 18. Jahrhundert bewahrt.
Der Reichenauer Abt Walahfrid Strabo verfasste im 9. Jahrhundert ein Lehrgedicht über den Kräutergarten des Inselkonvents. Nach seiner Beschreibung wurde 1991 ein neuer Kräutergarten im ehemaligen Klostergarten angelegt.
Hinter der Szenerie: Pirmin und die Klostergründung Der Wanderbischof Pirmin kam auf die ‚reiche Au‘ im Bodensee. Hier traf er auf Schlangen und allerlei übles Gewürm, die er erst einmal vertreiben musste. Dann schlug er seinen heiligen Stab in den Boden, worauf eine heilende Quelle aus dem Boden sprudelte. An dieser Stelle gründete Pirmin ein Kloster, das sich in den nächsten Jahrhunderten zu einem bedeutenden Zentrum der abendländischen Kultur nördlich der Alpen entwickelte.
Die romanische Kirche wurde 888 durch den Abt Hatto III. als Säulenbasilika erbaut und wurde seitdem nur wenig verändert. Berühmt sind die acht großflächigen ottonischen Wandmalereien aus dem ausgehenden 10. Jahrhundert. Sie messen über 4 x 2 m und zeigen Wundertaten des Jesu Christus. Die Wandbilder gehören zu den ältesten ihrer Art nördlich der Alpen. St. Georg dient auch heute noch als katholische Pfarrkirche.
Die katholische Pfarrkirche wurde im 11. Jahrhundert als Nachfolgebau einer Kirche aus dem 8. Jahrhundert errichtet. Der Innenraum der dreischiffigen Basilika wurde Mitte des 18. Jahrhunderts im Stil des Rokoko umgestaltet. Sehenswert und beeindruckend sind die alte Orgel sowie die Malereien in der Apsis, die aus dem frühen 12. Jahrhundert stammen.
Drei Museumsgebäude, die sich alle in unmittelbarer Nähe zu den romanischen Kirchen befinden, bilden ein ‚Informationsnetzwerk‘, um über die besondere kulturhistorische Bedeutung der Klosterinsel Reichenau zu informieren, die seit 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der Inselbesucher wird eingeladen, sich auf Entdeckungstour über die Insel zu begeben. Er kann die alten Kirchen besuchen und sich daneben in den dezentralen Museumsgebäuden ergänzend über wissenswerte Hintergründe informieren und damit die Insel Reichenau als herausragende Kulturlandschaft erleben.
Auf dem 1838 aufgeschütteten Damm, der die Insel Reichenau mit dem Festland verbindet, stehen die Reste der mittelalterlichen Wasserburg Schopflen. Ihren Ursprung hatte die Wehranlage im 11. Jahrhundert, als sie von den Äbten des Klosters Reichenau erbaut wurde, um die Insel auch bei Niedrigwasser verteidigen zu können. Im Jahre 1312 entstand ein neues zweigeschossiges Burggebäude, das aber bereits 1366 im Konstanzer Fischerkrieg wieder zerstört wurde. Die bis zu 2,5 Meter dicken Mauern sind heute noch teilweise erhalten. Im Inneren der Ruine befindet sich eine frei zugängliche Plattform, die dem Naturschutzbund NABU als Beobachtungsposten dient.
Das zweistöckige Schloss auf der Insel Reichenau, das an der Vorder- und Hinterfront von je zwei Rundtürmen flankiert wird, wurde im 16. Jahrhundert durch den Reichsgrafen von Königsegg erbaut. Zuvor war das Gut Sitz eines Ministerialen der Abtei Reichenau. Es kam im 17. Jahrhundert zum Kloster Beuron, bis dieses im Zuge der Säkularisierung aufgelöst wurde. Bei einem Umbau 1840 erhielt das Schloss sein neuromanisches Aussehen und beherbergt heute eine medizinische Schule für Logopädie (Sprachheilkunde). Jeden Juni finden im Schlosspark Freilichtspiele statt.



















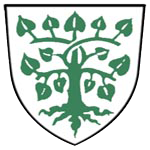
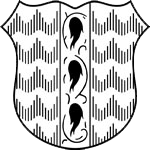





















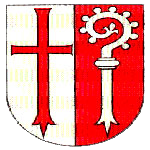

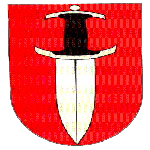






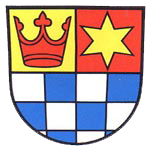

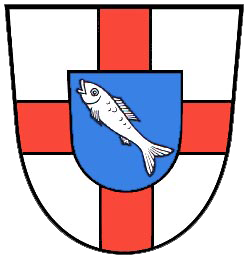
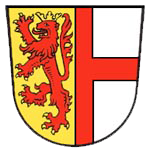







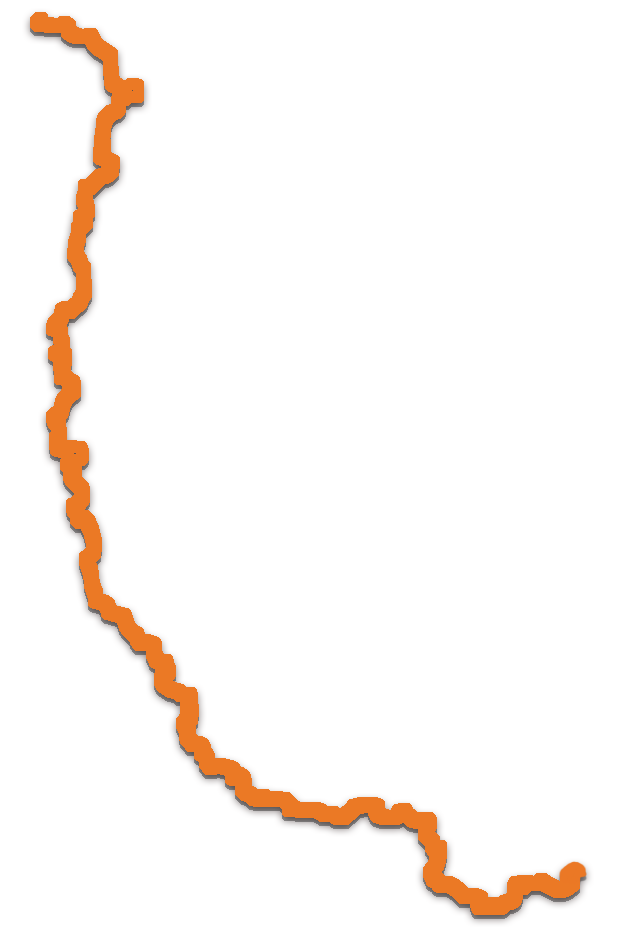
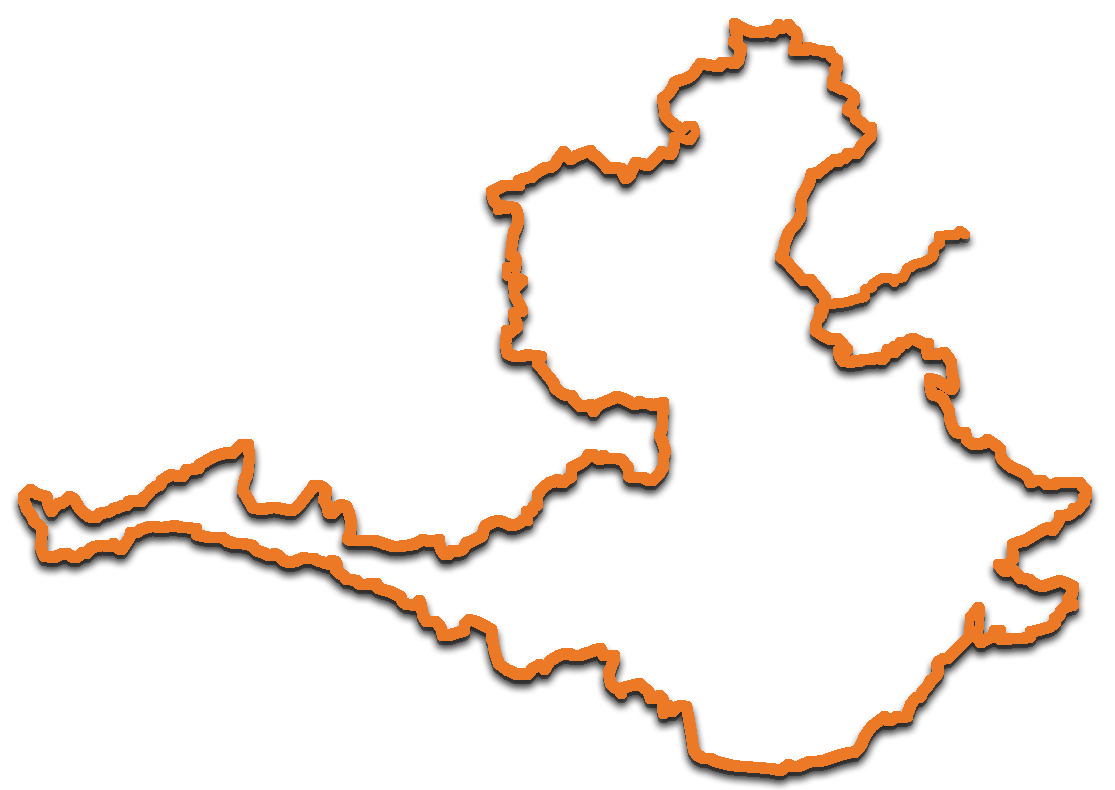
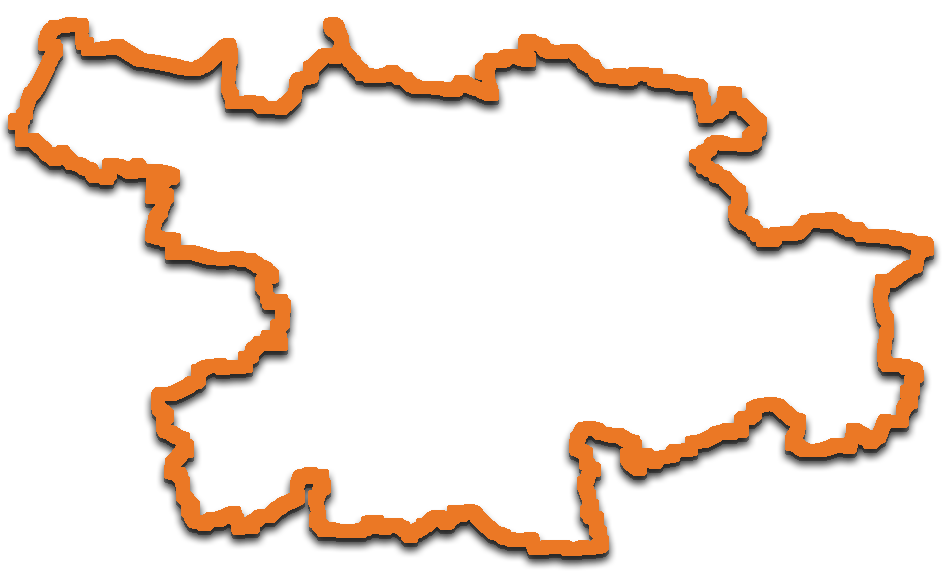

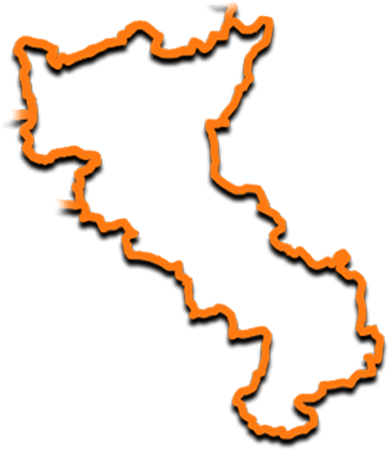
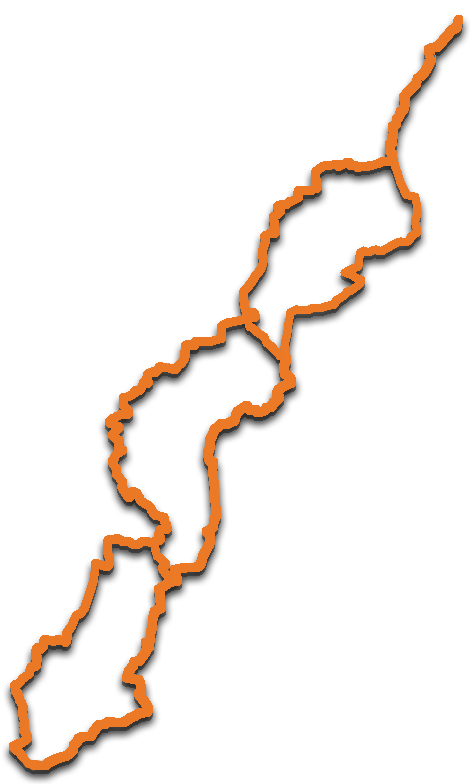


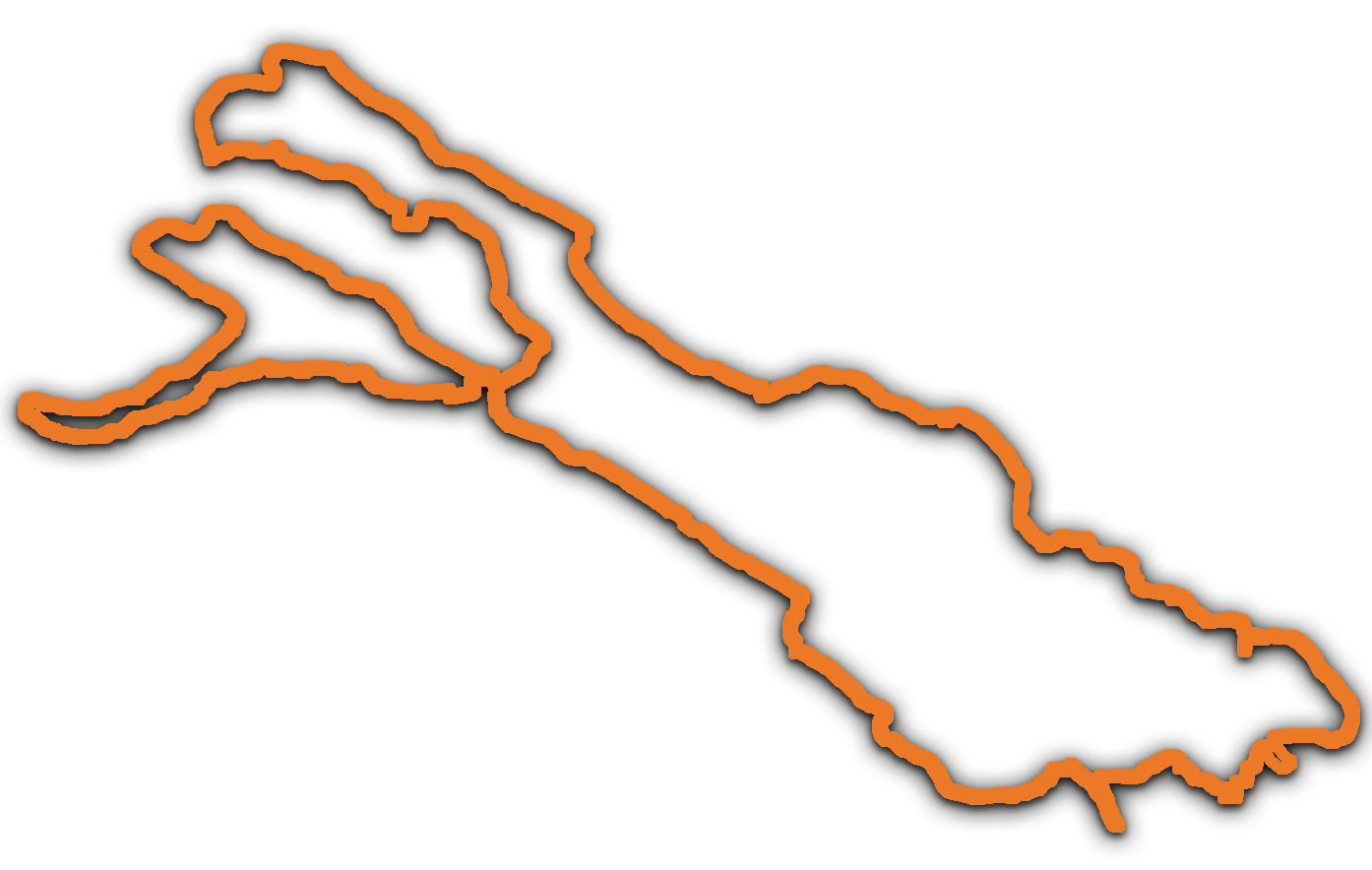

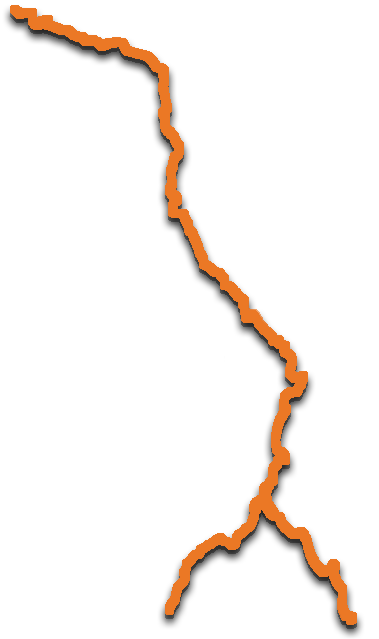
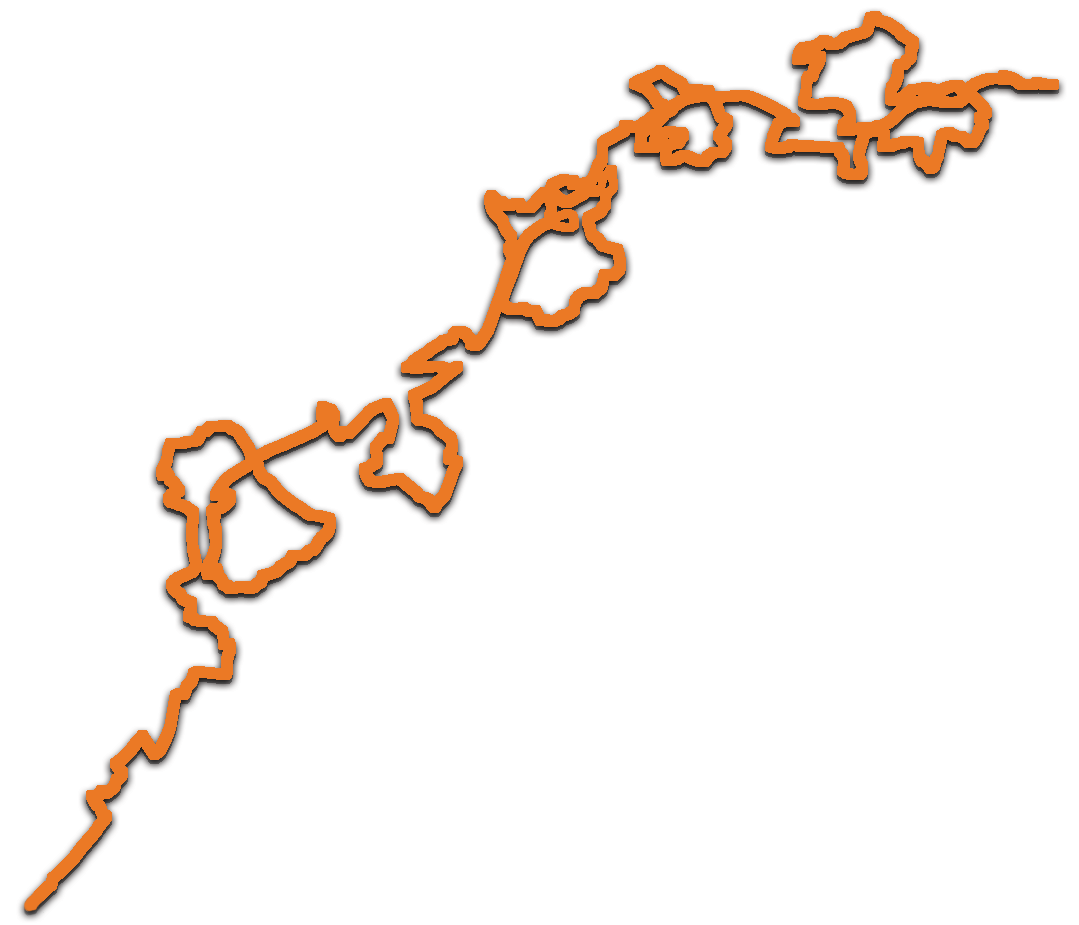
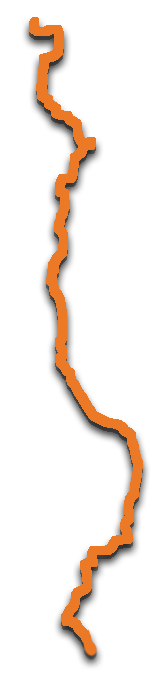












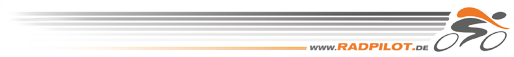







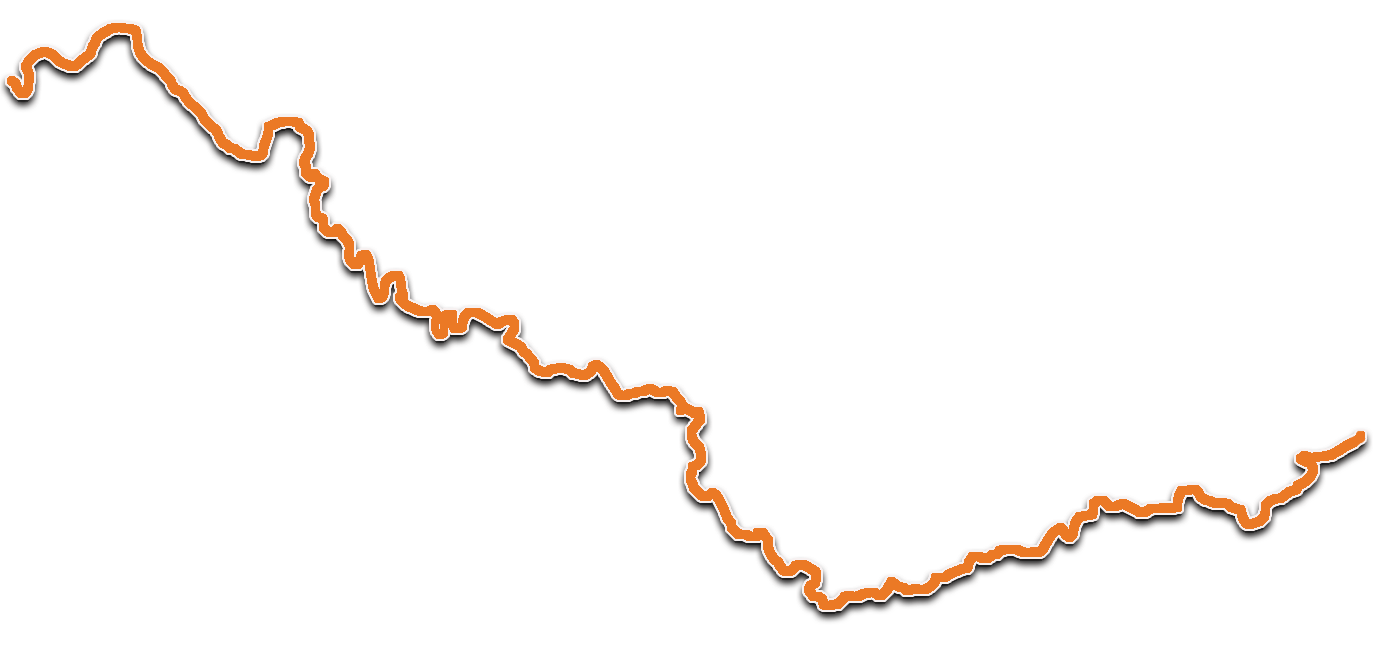

















































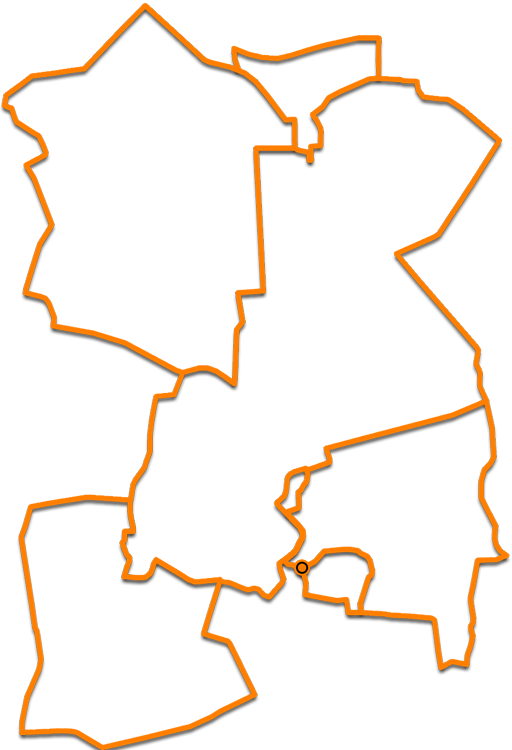





















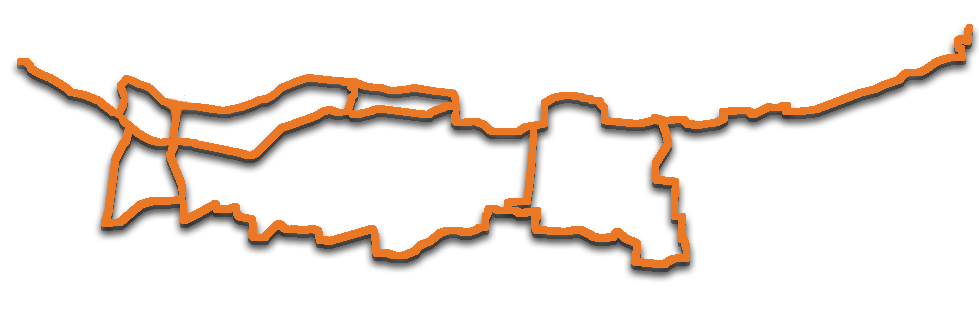











































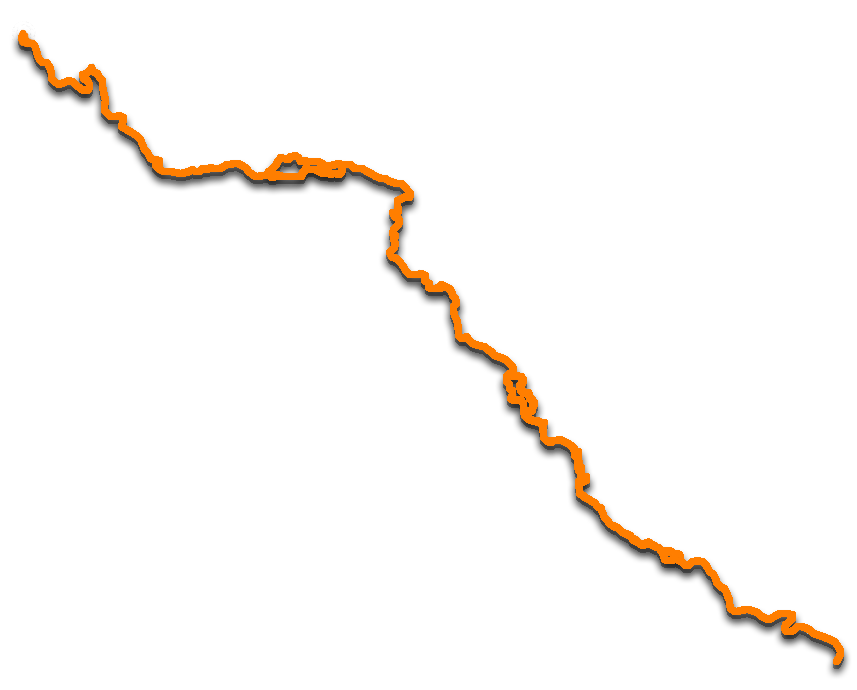










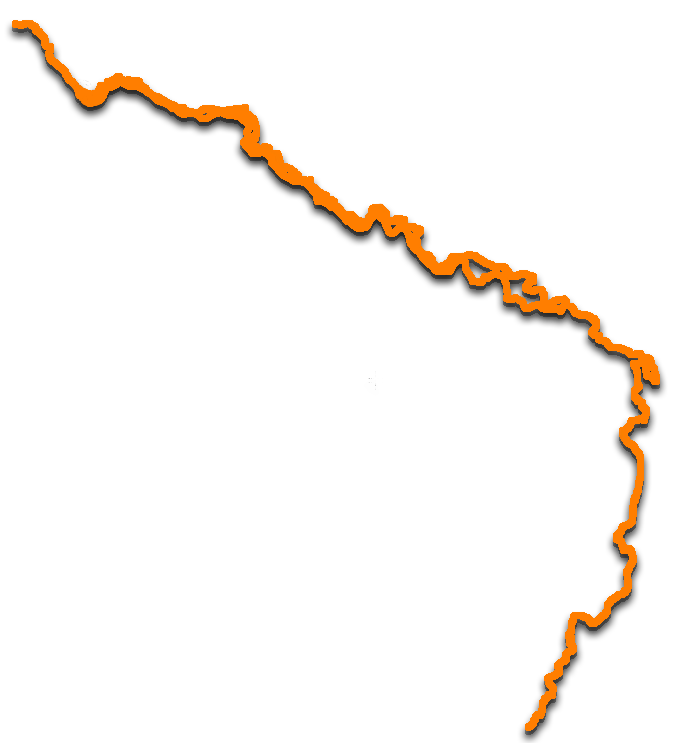











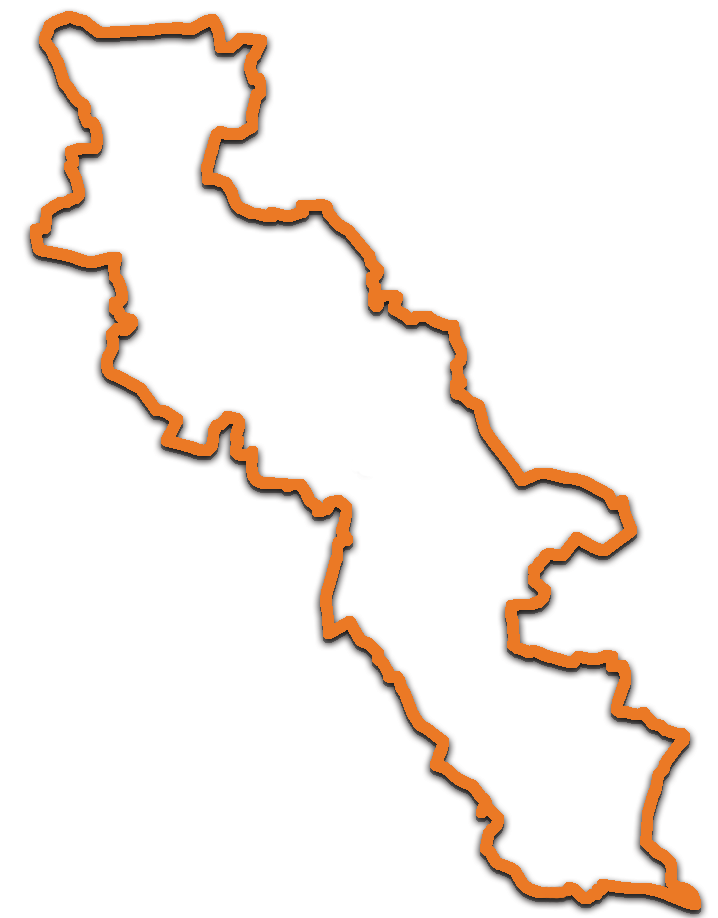

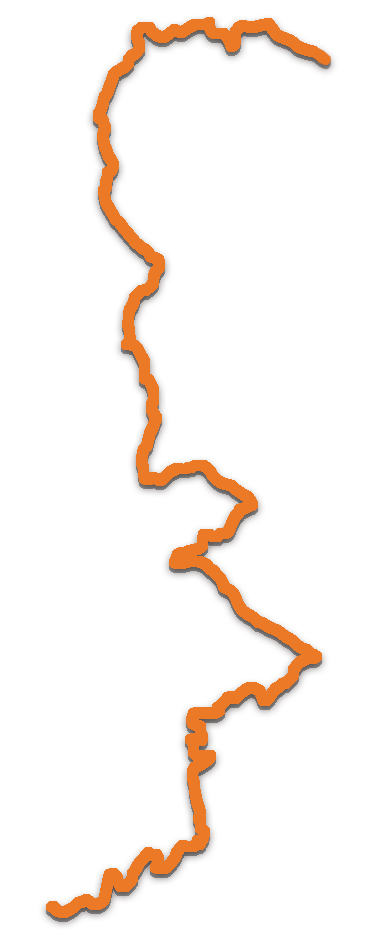














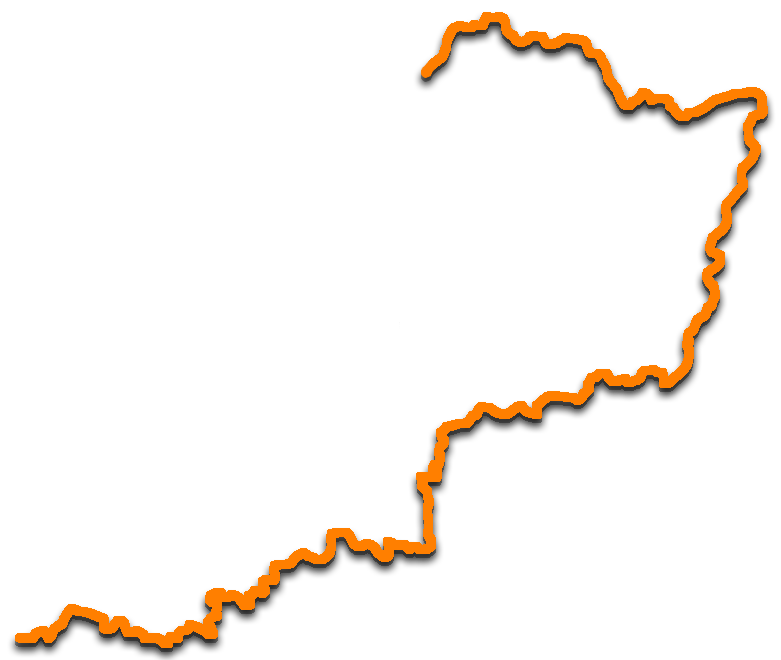
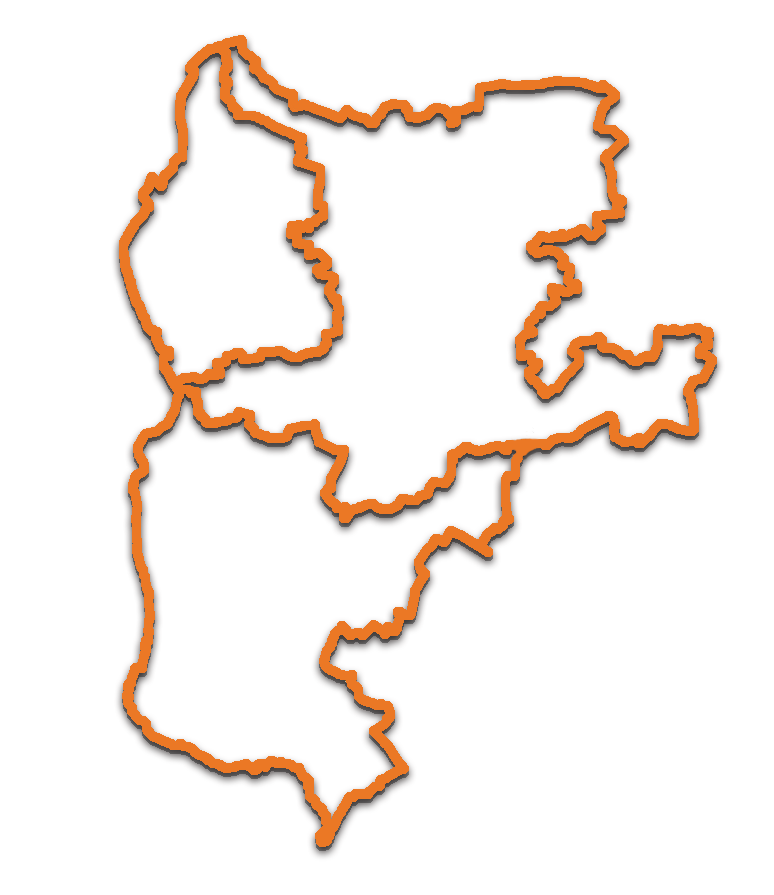
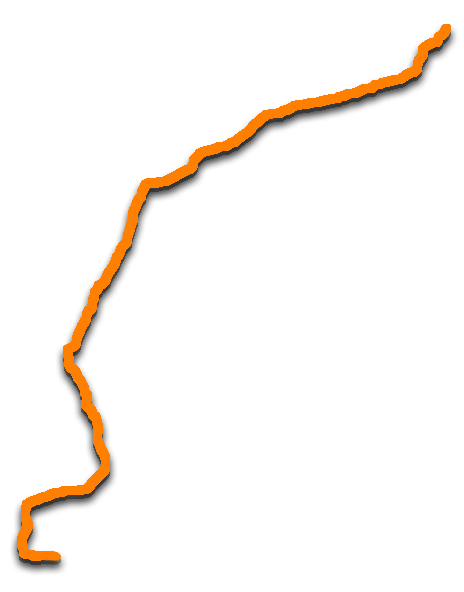
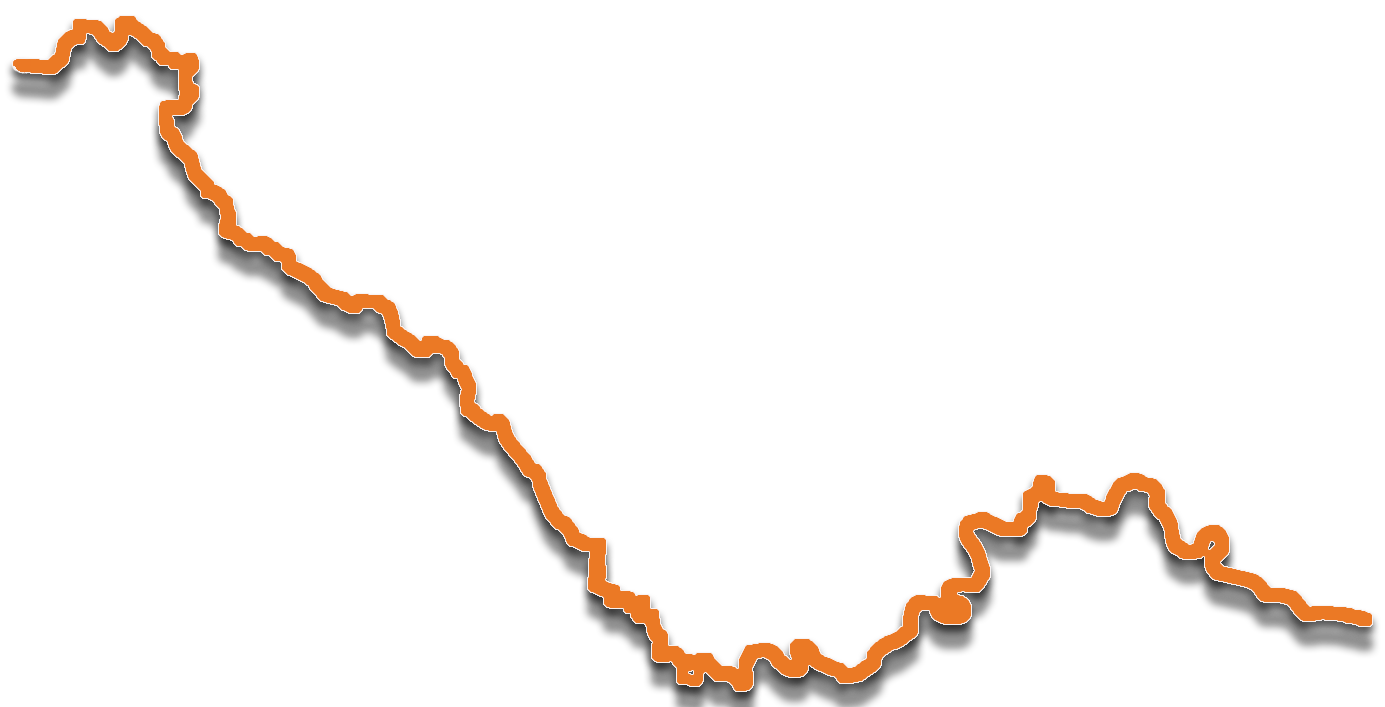
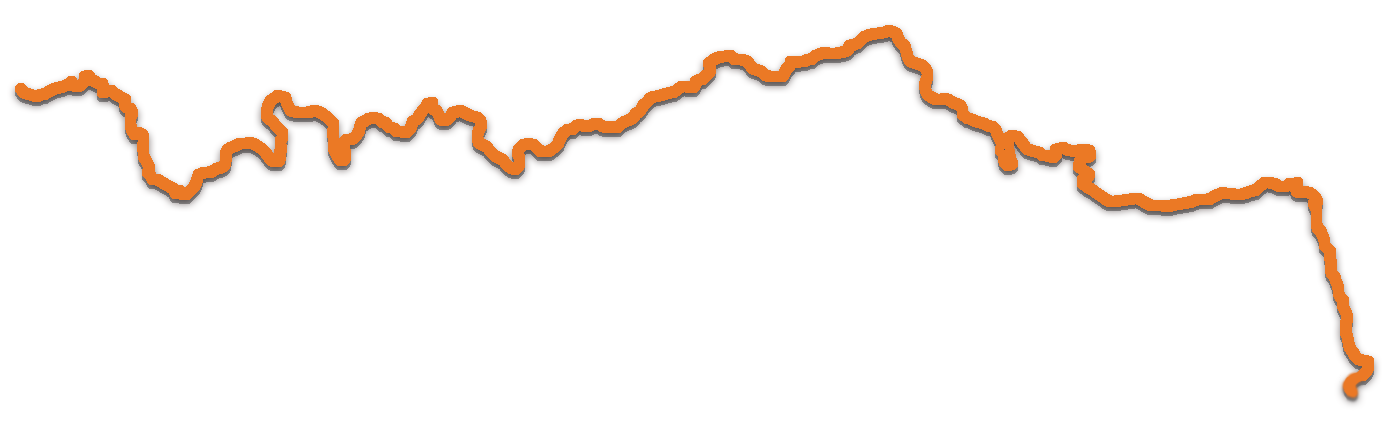
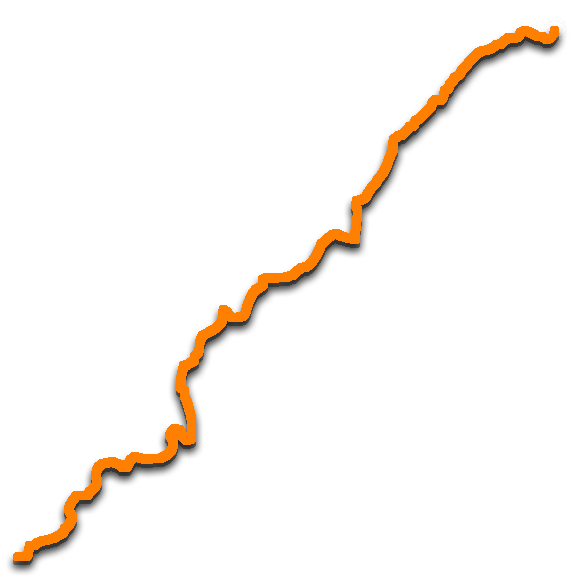




 e
e